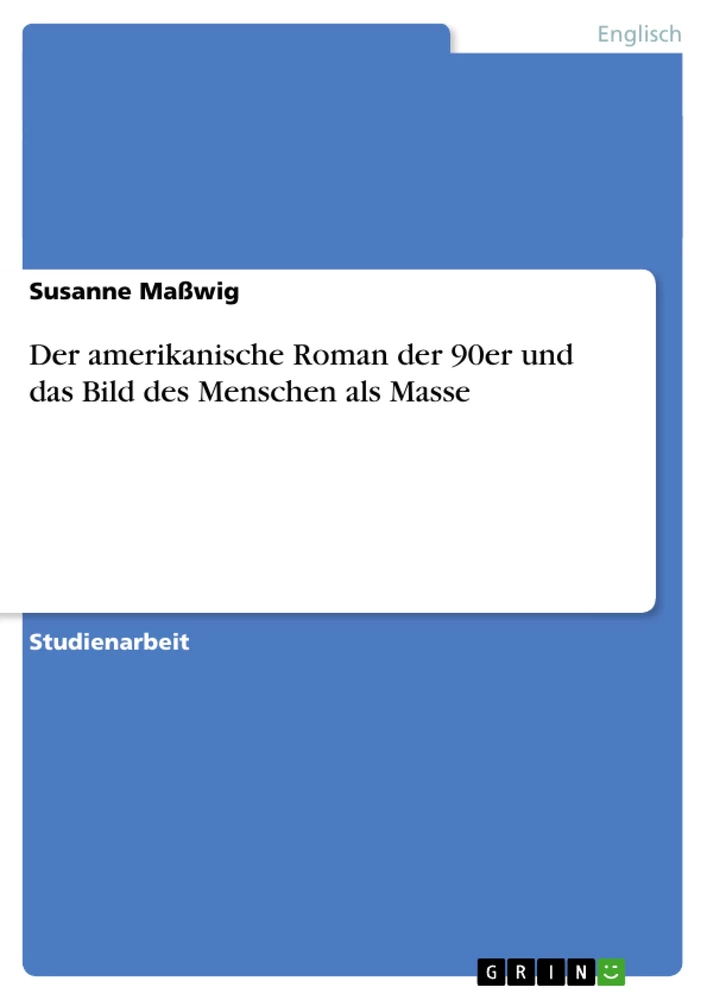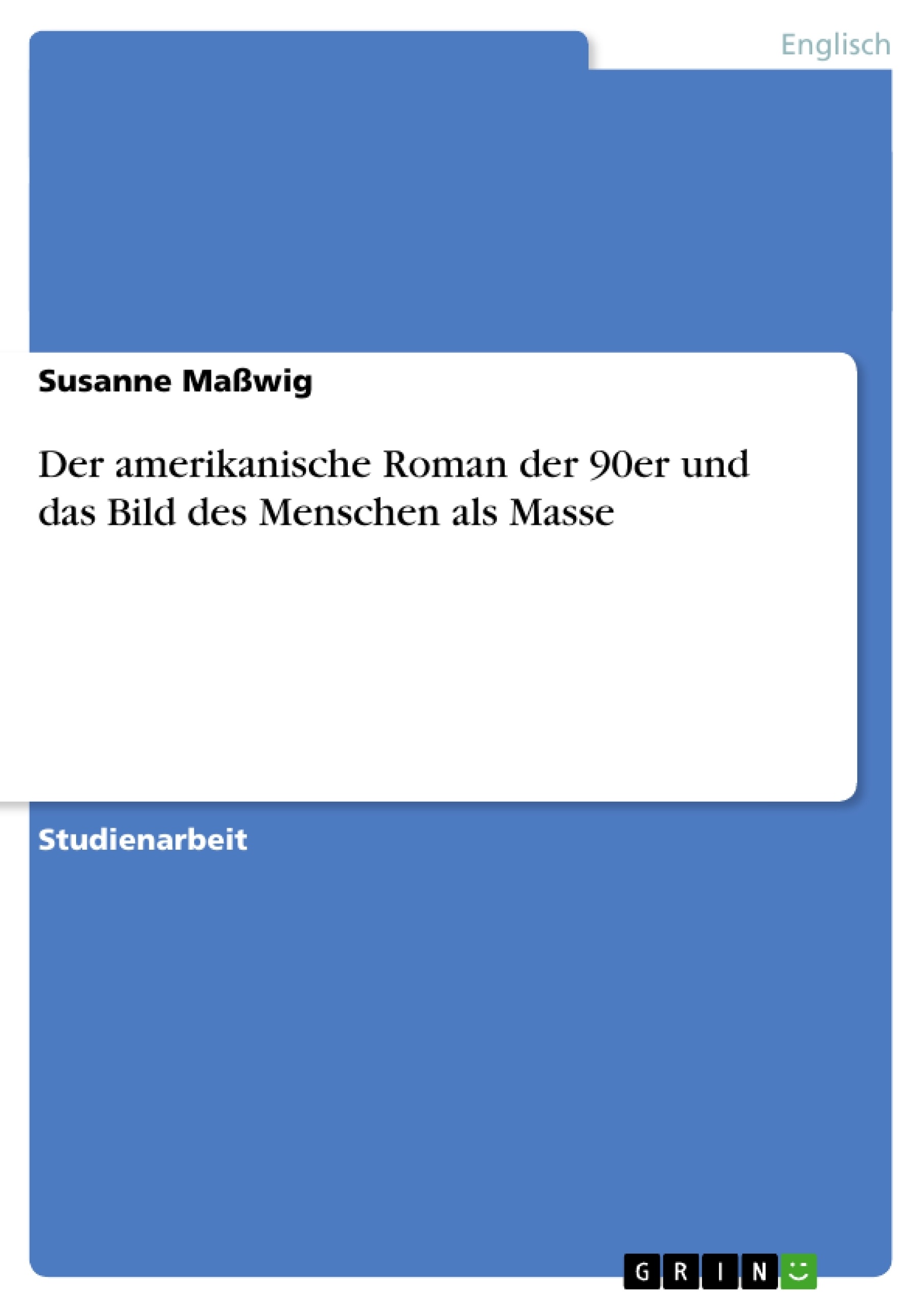,,Der amerikanische Roman der 90er und das Bild des Menschen als Masse anhand Don DeLillos Mao II"
Seminararbeit für das Proseminar
,,The American Novel of the 90s : Themes, Characteristics, and New Directions" von Susanne Maßwig
Der amerikanische Roman der 1990er Jahre steht im Erbe der Postmoderne. Viele Autoren der Gegenwart haben ihre literarischen Wurzeln in dieser Periode. Sie versuchten in den 1960ern wachsenden ökonomischen Problemen, sozialen und politischen Krisen mit neuen Techniken und Themen zu begegnen und schufen damit eine Literatur der Imagination und Reflexion, die sich in vielfältigen Formen ausdrückte. Oftmals als "Weltuntergangsliteratur" bezeichnet, standen die geistige Konfusion und der Verlust von Orientierungsvermögen in der neuen technisierten und komplizierten Welt im Mittelpunkt. Mit der Thematisierung von z.B. Atombombengefahr, Zweitem Weltkrieg und seinen Folgen, der Explosion der Weltbevölkerung, Umweltzerstörung, Armut und Rassendiskriminierung im eigenen Land, sowie der Unterdrückung der Frau und den politischen Protesten während des Vietnamkrieges vermittelten sie ein Krisenbewusstsein, mit dem sie auf die Fehlentwicklungen der Gegenwart hinzuweisen versuchten. Allgegenwärtiger Verfall, die "Verdinglichung" von Mensch und Umwelt durch fortschreitende Technisierung, sowie die Diskrepanz zwischen den propagierten Idealen und der gelebten Realität der amerikanischen Gesellschaft sollten sichtbar gemacht werden, um vor verhängnisvollen Tendenzen zu warnen. Vielfach wurde dabei das Geschehen in die Zukunft projiziert, was neuen Genres Auftrieb verlieh, wie etwa der Science Fiction. Das Bild dieser Zukunft gestaltete sich jedoch düster und beinahe hoffnungslos. Offene Enden gaben ein Gefühl der Unwissenheit wieder, zeigten die Unmöglichkeit wirklicher Erkenntnis und der Mangel an befreienden Kräften, die der klassische Held seit jeher besaß, nur die Wahl zwischen schlechten Alternativen. Diese befreienden Kräfte machten Helden platz, die keine mehr waren. Es wurden verschrobene Antihelden erschaffen, die sich ihrem Leben teils im Drogenrausch ergaben und der umgreifenden Hoffnungslosigkeit und Entropie der modernen Welt nichts entgegenzusetzen hatten. Kommunikationsunfähigkeit und Entfremdung spiegelten sich in zunehmender Selbstreflexivität der Autoren, die nun begannen, sich mit der Literatur selbst und ihren Prozessen zu beschäftigen, und sich mit ihrem Zweck und dem kreativen Prozess des Schreibens auseinander zu setzen. Es entstand quasi eine Literatur über Literatur und ihre Prozesse, die jedoch das Erzählen von Geschichten vernachlässigte.
Stilistisch hoben sich die postmodernen Autoren besonders durch die Vermischung verschiedener Genres und Erzählstrukturen sowie durch das Verschmelzen von Konzepten wie Fakt und Fiktion, Mythos und Geschichte von den literarischen Konventionen der Moderne ab. Moderne Formen wurden radikalisiert, parodiert und überspitzt wiedergegeben. Der Text wurde zum Spielobjekt der Sprache, Fragmente verschiedener Texte wurden zu neuen zusammengefügt, Genres entdefiniert, deformiert und wiederum verschmolzen. Man arbeitete zum Teil textlich unzusammenhängend, bezog sich im eigenen auf andere literarische Werke und unterschied nicht mehr zwischen Fakt und Fiktion, Erinnerung und Geschichte, story und history. Auch wurden oftmals die Lesererwartungen nicht mehr erfüllt. Der Text ließ Fragen offen, lose Handlungsstränge führten wie in einem Labyrinth zu keinem befriedigenden Schluss. Obwohl sich die postmodernen Autoren auch konventioneller Erzählweisen bedienten und den gesellschaftlichen Zerfall nicht immer auch in sprachlichem Zerfall darlegten, war ihre Literatur vielmehr auf den Aspekt des Schreibens selbst ausgelegt, nicht auf die Bedürfnisse der Leser, was dazu führte, dass die Postmoderne oft als zu anstrengend und unlesbar empfunden wurde.
Die extreme Fragmentarisierung mancher Texte durch Collagen, Montagen, die Hinwendung zum Paradoxon und zur Unbestimmtheit des modernen Lebens (die sich in Zweideutigkeiten, Brüchen und Verschiebungen ausdrückte) , das Verspotten von Autoritäten und Institutionen, die Dekonstruktion von etablierten Werten und Mythen, der Verlust des Ichs oder auch der Konstruktcharakter, der vielen postmodernen Werke anhaftet, wirkte oftmals erdrückend auf die Leser. Der Zugang zum Werk wurde durch die Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten nur noch erschwert, da man Realitäts- und Wahrheitsprinzipien der literarischen Moderne durch ein Möglichkeitsprinzip ersetzte, das bewusst auf Missverstehen und Fehlinterpretation hinarbeitete.
Dass die Postmoderne sich mehr und mehr um sich selbst und ihre Prozesse drehte und immer weniger um die objektive Realität und das Leben, fasste John Barth 1967 in seinem Essay The Literature of Exhaustion1 zusammen, der die Postmoderne als literarischen Begriff prägte. 1979 schrieb er mit The Literature of Replenishment2 einen zweiten Essay, der dieses Thema erneut aufgriff. Hierin vertrat er die Ansicht, dass der eigentliche Text immer über literarischen Kategorien und Zusammenhängen stehen müsse, und somit der wahre postmoderne Roman genreübergreifend und nicht klar einzuordnen sei. Hatte er noch 1967 festgestellt, dass sich die alten literarischen Konventionen überholt und aufgebraucht hatten, so schrieb er nun, dass die Wurzeln des idealen postmodernen Romans stets auch in der literarischen Vergangenheit zu finden seien. Das moderne Erbe sollte daher nicht ignoriert oder als gänzlich überholt verworfen werden, sondern mit in die Strömungen gegenwärtiger Literatur einfließen. Diese Synthese von alten und neuen Formen und Mitteln des Schreibens mache den postmodernen Roman erst aus. Barth sah in der Postmoderne nicht mehr nur den Ausdruck kultureller Stagnation und den Versuch die used-upness, die "Aufgebrauchtheit" literarischer Mittel, zu überwinden, noch sah er sie als eine geschlossene Bewegung.
Vielmehr stellte sie ein Gefühl dar, mit dem die zeitgenössischen Autoren auf gesellschaftliche Tendenzen reagierten, die sie als bedenklich oder gar gefährlich empfanden. Es gibt also nicht "Den Postmodernen Autoren", sondern viele Schriftsteller, die auf ähnliche Weise auf ihre Umwelt reagieren. Die Literatur wurde somit verstärkt zu einem Medium kritischer Betrachtung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft. Auch in den folgenden Jahrzehnten ließ die Tendenz zur Anwendung postmoderner Techniken nicht nach. Autoren wie Paul Auster schlachteten in ihren Geschichten die gesamte Bandbreite postmodernen Könnens aus, erschufen mit City of Glass3 labyrinthhafte Konstruktionen, die die Konzepte der Genres sowie der Autorität des Autoren über seinen Text zum Einsturz zu bringen suchten. In City of Glass gibt es keine führende Kraft mehr, die den Leser durch das Werk geleitet, das Genre, hier der Detektivroman, wird gegen sich selbst gerichtet. Der Roman zerstört sich selbst in seinem Verlauf, bis der Leser am Ende weniger über das Geschehen weiß als am Anfang. Die Erwartungen des Lesers werden völlig ignoriert, er ist dem Autoren auf der Suche nach des Rätsels Lösung ausgeliefert. Auster scheint dem Leser jegliches Erfolgsgefühl versagen zu wollen, denn auch das Ende ist offen und unbefriedigend. Die Subversion von Genres, die Verweigerung von Autorität, sowie das Verschwimmen der Identitäten von Austers Charakteren zeigen die Krise, in der sich die Gesellschaft Anfang der 80er Jahre befand. Auster rief mit City of Glass ein Gefühl des Alleingelassenseins hervor, eines Ausgesetztseins in einer fremden Welt und der Entfremdung von eben dieser, das vielleicht als typisch für postmoderne Literatur der 80er und 90er Jahre bezeichnet werden könnte. Denn auch in der Formenvielfalt des Multikulturalismus, der sich in verstärktem Auftreten von native- und Asian-American literature ausdrückte, waren Themen wie die eigene Identität und die Probleme mit der modernen Gesellschaft vorherrschend.
Anfang der 90er lässt sich jedoch beobachten, dass viele Schriftsteller nach und nach zur Tradition des Geschichtenerzählens zurückfinden. Die Grenzen der Lesbarkeit eines Textes werden zwar weiterhin ausgetestet, sie werden aber nicht mehr überreizt und eingerissen. Das Erzählen von Geschichten wird zum Hauptaspekt, der Text bleibt zusammenhängend und wird nicht mehr fragmentiert und zerspielt. Autoren wie Tim O'Brien, der 1994 mit In the Lake of the Woods4 einen weiteren Roman u.a. zum Thema des Vietnamkrieges vorlegte, bedienen sich zwar nach wie vor postmodernen Techniken, doch sind diese nun vielmehr eingebunden in eine Geschichte, die dem Leser viel leichter zugänglich ist als die postmoderne Experimentalliteratur. Nach wie vor werden Konzepte wie das des Unterschiedes zwischen Fakt und Fiktion hinterfragt, Erzählweisen werden vermischt, prosaische Passagen wechseln mit Passagen polizeilicher Beweisführung, Interviews und Zitaten, hypothetische Kapitel mit denen der "realen" Fiktion O'Briens. Die Postmoderne unterschied zwischen Fakt und Fiktion, sie waren klar getrennt und leicht zu unterscheiden. Sie spielte mit dem Leser, während O'Brien ihn ganz bewusst täuscht. Auch gibt es in In the Lake of the Woods den Autoren als Instanz der Autorität über Protagonist und Leser nicht mehr. Der scheinbare Autor verliert sich nach und nach in Fakten, die möglicherweise auch Fiktion sein könnten, die Grenze zwischen Erinnerung und Geschichte wird immer dünner und das Vertrauen in die Objektivität des Autoren ebenso. Während die Postmoderne noch Autoritäten in Frage stellte, könnte nun der Autoritätsverlust des Autors bzw. die Infragestellung des Autors als verlässliche Instanz für den Roman der 90er Jahre bezeichnend sein; so wie der Integritätsverlust der Regierenden gegenüber den Regierten bezeichnend für die Gesellschaft der 90er Jahre ist. Der Protagonist in O'Briens Roman ist ein Politiker, aber auch ein Hobbyzauberer und ein Vietnamveteran. O'Brien entwirft eine detaillierte Charakterstudie, die diesen Menschen erklären soll, jedoch nur noch mehr zum Fragen anregt. In den hypothetischen Kapiteln gibt O'Brien Lösungen, die er kurz darauf zurücknimmt; alles wird möglich, um das mysteriöse Geschehen um das Verschwinden der Kathy Wade zu erklären. In the Lake of the Woods ist ein psychologischer Roman, eine sog. mystery novel und ein Antikriegsroman. Wie auch Paul Austers Music of Chance5, der Elemente der road novel, aber auch einer anti-road-novel enthält, da der Protagonist als freier Mensch seine Reise beginnt und als Gefangener und Leibeigener zweier Millionäre endet. Diese Hybridität kann auch bei anderen Autoren der Gegenwart beobachtet werden, z.B. bei E. Annie Proulx, die in ihren The Shipping News6 die Selbstfindung ihres Protagonisten mit einem Reiseroman und Elementen der mystery novel verbindet. Auch Proulx arbeitet wie O'Brien mit dem Spiel von Fakt und Fiktion. Sie bezieht sich vor jedem Kapitel auf The Ashley Book of Knots, das 1944 erstmals veröffentlicht wurde, und den thematischen Einstieg in das jeweilige Kapitel darstellt. Andererseits verwendet sie "gefälschte" Zeitungsartikel. Das Individuum in der Gesellschaft scheint auch in The Shipping News ein zentrales Thema zu sein. Der Protagonist fühlt sich zeit seines Lebens von seiner Umwelt ausgegrenzt und verspottet. Seine Größe und wuchtige Gestalt scheinen fehl am Platz, in der Kleinstadt, in der er aufwächst. Menschen die er liebt, verletzen ihn, verlassen ihn oder nutzen ihn einfach aus. Dies ändert sich, als er mit seinen beiden Töchtern und seiner Tante in das Land seiner Vorfahren zurückkehrt: Neufundland. Hier plötzlich scheint er gar nicht mehr ein solcher Außenseiter zu sein, was sich anfangs als Verlust von Familie und Heimat und ein Fortgehen in die Fremde darstellt, wird letztendlich zur Heimkehr in eine bald vertraute Welt. Proulx zeichnet in The Shipping News ein viel positiveres Bild der Gegenwart als O'Brien. Sie schließt ihren Roman mit einem happy end, das aber einen melancholischen Unterton nicht vermissen lässt und ohne den üblichen Kitsch auskommt, und daher sehr zum rauhen Meer und dem felsigen Grün der Insel Neufundland passt.
Stewart O'Nan wirft in seinen Snow Angels7 einen detaillierten Blick unter die Oberfläche einer normalen Vor- oder Kleinstadt, unter deren industrialisierten Gesicht die Frustration und Depressionen der Einwohner schwelen. Der Roman spielt hauptsächlich im Jahr 1974, einer politisch turbulenten Zeit, und wird bevölkert von Menschen, die in ihrer Antriebslosigkeit gefangen sind. Ihre Inaktivität ist auf ein Leben im Durchschnitt zurückzuführen, ein Leben, in dem nichts außergewöhnliches passiert und die Arbeit oder Arbeitslosigkeit erdrückend ist. Auch in den 90ern sind solche Probleme noch immer existent, wenn nicht sogar in noch drastischerem Ausmaß. Arbeitslosigkeit, Armut, Umweltzerstörung, Kriege und allmähliche Abstumpfung und Vereinsamung des Menschen vor dem heimischen Fernsehgerät und vor dem Computer sind allgegenwärtig. Diesen Themen hat sich unter anderem der Autor Don DeLillo verschrieben. Seine ersten Kurzgeschichten veröffentlichte er in den 1960ern, als die Postmoderne in ihrer Blüte stand. 1971 erschien sein erster Roman, Americana8, bis 1997 folgten elf weitere, dazu kamen einige Kurzgeschichten und Essays, sowie ein Pamphlet9 zusammen mit Paul Auster zur Verteidigung des verfolgten Schriftstellers Salman Rushdie. Die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft ist ein Aspekt, der DeLillo sehr zu beschäftigen scheint. Wie er in verschiedenen Interviews sagt, sollte ein Schriftsteller außerhalb der Gesellschaft stehen. In der Opposition zum Staat liege seine Stärke. Besonders in repressiven Gesellschaften, in denen der Schriftsteller sich nicht in die Massen der Schweigenden einreiht, sondern mit Worten und Taten dagegen angeht, könne der Schriftsteller seinen Einfluss auf die Gesellschaft bewahren. In einer Gesellschaft aber, die wie die westliche von ewigen Wiederholungen, Übersättigung und Konsum geprägt wird, werde jeder Schriftsteller absorbiert. Seine Stimme bleibe ohne Einfluss, da er kompromisslos in die Struktur der Gesellschaft eingegliedert und somit zu einem Teil der Gesellschaft werde.
Heute habe der Terrorismus die Rolle der Literatur übernommen, denn nur der gewaltsame Akt der Zerstörung könne noch zum Individuum durchdringen. Terroristen infiltrierten und veränderten nun das Bewusstsein, was früher Aufgabe der Schriftsteller gewesen sei. Die Literatur stehe heute am Abgrund zur Neutralität, sagt DeLillo weiter, und sei kurz davor im allgemeinen Gemurmel einer kurzlebigen Welt unterzugehen.
Dieser Gedanke hat auch in DeLillos Mao II10 eine wesentliche Rolle eingenommen. Der Protagonist, Bill Gray, ist ein Schriftsteller, der sich seit Jahren völlig aus einer Welt zurückgezogen hat, in der die Haupterscheinungsform der Menschen die einer unüberschaubaren Masse ist. Er versteckt sich in einem Haus, in dem er ganz und gar von seinen literarischen Werken und allem, was damit zu tun hat, umgeben ist. Alle erhältlichen Ausgaben seiner beiden Romane, Übersetzungen, Reviews, Abhandlungen über Bill Gray und Unmengen von Leserbriefen haben ihm ein Gefängnis erschaffen, in dem er vor sich hin arbeitet, schreibt um des Schreibens willen und sich nur mit sich und seiner Arbeit beschäftigt. Er hat jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen, seine Familie ist ihm gleichgültig, Freunde hat er nicht mehr. Der Verlust bzw. die Transformation der traditionellen Familie, die sich auch in anderen Romanen der 90er Jahre beobachten lassen, wird hier deutlich. Sein ganzes Leben dreht sich um den neuen Roman an dem er arbeitet, und den er kontinuierlich überarbeitet. Seine Unsicherheit treibt ihn sogar dazu die Zeichensetzung zu revidieren.
Die besessene Einstellung gegenüber seiner Arbeit teilt er mit Scott, der ihm als Fan hinterherjagte und schließlich zu Bills Archivisten und Assistenten wurde. Scott und seine Freundin Karen haben selbst auch keine Familien oder haben den Kontakt abgebrochen. Bevor Scott Karen von der Straße holte, war sie Mitglied in der Moon-Sekte und verdiente sich ihr Heil und ihre Erlösung mit dem Verkauf von Blumen und Erdnüssen in den Kleinstädten Amerikas. Ihre Eltern entführten sie aus dieser Sekte, hatten aber mit dem Versuch Karen zu deprogrammieren und die Gehirnwäsche rückgängig zu machen nur mäßigen Erfolg. Karen und Scott werden als Angestellte vorgestellt, erscheinen jedoch mehr wie Familienangehörige, die sich um Bills Wohl kümmern. Wie Eltern glauben sie zu wissen, was das beste für Bill sei, und behandeln ihn teilweise wie ein Kleinkind. Scott drängt Bill immer wieder dazu am Roman zu arbeiten. Er hat es sich zum Ziel gemacht, den Mythos um Bill Gray noch zu vergrößern. Einen Mythos zu erweitern, dem der Mensch Bill Gray schon lange nicht mehr gewachsen ist. Seine Abwesenheit in den Medien ist weit wichtiger geworden als Bill selbst. Doch dieser scheint zufrieden mit seinem Leben, bis er eines Tages entscheidet die Fotografin Brita einzuladen, um sich in der Öffentlichkeit zurückzumelden.
Auch Brita hat keinerlei familiäre Bindungen. Sie lebt für die Fotografie und hat sich zum Ziel gemacht, jeden Schriftsteller der Welt abzulichten. Auch hier schafft DeLillo einen Charakter, dessen Arbeit keinen wirklichen Sinn mehr hat, da es eine endlose Aufgabe ist. Brita fotografiert nur des Archivs wegen, was sie Scott ziemlich ähnlich macht, der Bills Leserbriefe chronologisch und geographisch ordnen möchte. Alle außer Karen sind besessen von ihrer Arbeit.
Brita inspiriert Bill auf eine neue Weise. Sie zieht ihn zurück in die Realität, er nimmt Kontakt zu seinem Verleger auf und fährt nach New York. Diese Tatsache verärgert und beunruhigt Scott zutiefst. Er widmete Bill sein Leben, versuchte in dessen Gedanken zu tauchen, versuchte wie Bill zu sein. Der Mythos, den er mit aufgebaut hatte, war nun in Gefahr. Im wesentlichen konzentrierte sich dieser Mythos um den unbekannten Aufenthaltsort und den gesundheitlichen Zustand des Schriftstellers, Gerüchte um dessen Tod und neue Romane. Beispiele für den in Zurückgezogenheit lebenden und arbeitenden Autoren, könnten Schriftsteller wie Thomas Pynchon oder Jerome Salinger sein, die öffentliche Auftritte seit Jahren meiden und sich der Konsumgesellschaft weitgehend entziehen. Bills Verleger überredet diesen zu einer Pressekonferenz in London, die zur Befreiung eines von libanesischen Terroristen entführten UN-Angehörigen angesetzt wurde. Die Geisel selbst ist auch Schriftsteller, und stellt in seinen Ansichten ziemlich das Gegenteil von Bill dar. Die Pressekonferenz muss jedoch wegen einer Bombendrohung und eines folgenden Anschlags abgesagt werden. DeLillo zieht hier wieder den Vergleich zwischen Schriftstellern und Terroristen. Schriftsteller würden ihre Umwelt durch ihre Gedanken und Worte beeinflussen, während sich die Terroristen mit brutaler Gewalt Gehör verschafften. Je unschuldiger dabei die Opfer seien, desto mehr Kraft bekäme die Aussage und desto höher werde die Resonanz in den Medien. Nur die Terroristen seien heute noch imstande die Gleichgültigkeit der Menschen aufzubrechen und die allgegenwärtige Gewalt wieder in ihr Blickfeld zu rücken. Besonders in den Großstädten fällt die Gewalt nicht mehr auf, sie verschwindet vielmehr im Hintergrund und bildet eine düstere Grundlage für den amerikanischen Alltag. Die Gewalt wird als gegeben hingenommen. In Mao II wandert Karen auf der Suche nach Bill durch New York und sieht das Elend in den Straßen, die Gewalt, die Drogen. Sie unternimmt den Versuch, etwas dagegen zu tun, sammelt Leergut für die Obdachlosen und spricht mit ihnen. Doch sie kann nicht wirklich etwas gegen die Armut und die Hoffnungslosigkeit tun. Es sind zu viele, die Hilfe benötigen und so muss ihr Versuch unausweichlich scheitern. Schließlich kehrt sie zu Scott in die Abgeschiedenheit von Bills Haus zurück, wo die beiden weiter an dessen Mythos feilen.
Bills Schritt in die Realität jedoch endet für ihn auf der Überfahrt von Zypern nach Beirut, wo er den Führer der libanesischen Terroristen treffen wollte. Er stirbt einen gleichgültigen Tod, an inneren Verletzungen, die zu behandeln er sich nicht hatte durchringen können. Auch hatte er diese Reise nicht unternommen, um seinem Leben einen Sinn zu geben oder etwas Gutes für andere zu tun. Vielmehr kamen die Impulse von außen, erst von Brita, dann von seinem Verleger, der Bill nach London holte. Der Kontaktmann der Terroristen führte Bill nach Athen, von wo aus er in Richtung Beirut aufbrach. Bill selbst mangelt es an jeglicher Motivation. Es scheint fast so, als wähle er nur zwischen zwei schlechten Alternativen, denen er eigentlich gleichgültig gegenüber steht. Er stirbt, seines Passes beraubt, ohne Identität. In der Postmoderne war der "Death of the Author" noch ein Konzept, mit dem sich der Autor durch stilistische Mittel aus seinem Text herausnahm, bei DeLillo jedoch wird der Tod des Autoren Teil des Plots.
DeLillos Romane sind sehr gesellschaftskritisch, er versucht seinem Ideal eines Schriftstellers zu entsprechen und will in Opposition zur Gesellschaft den Leser zum Nachdenken bringen. Schon 1984 brachte er in White Noise11 unter anderem die abstumpfende Wirkung des Fernsehens und die Gleichgültigkeit der Zuschauer gegenüber den täglichen Katastrophen zur Sprache. Nachdem er nach einige Jahre in Europa gelebt hatte, fiel ihm bei der Rückkehr dieses Phänomen in der Fernsehlandschaft auf. Ebenso wie die Nachrichten und das Wetter gehörten Umweltkatastrophen u.ä. zum täglichen Bild. Außer auf die direkt Betroffenen hatten sie jedoch wenig bis keine Auswirkungen. Die Repräsentation von Realität in den Medien schien den Menschen von der Umwelt und von sich selbst zu distanzieren. Dies und die darin liegende Gefahr sei eine motivierende Kraft für White Noise gewesen. Eine solche Gesellschaftskritik liegt auch in Mao II. Sie drückt sich vor allem in der Gegenüberstellung von Individuen und den alles beherrschenden und vernichtenden Massen. "The future belongs to the crowds" schreibt DeLillo am Ende des ersten Kapitels, in dem er den Roman mit der Massenhochzeit einer christlichen Sekte im Yankee Stadium in New York einleitet. Karen taucht dort erstmals als Teil einer homogenen Masse auf, in der das Individuum zu einem einzigen riesigen Körper zu verschmelzen scheint. Endlose Reihen von jungen Männern und Frauen, alle in blau und weiß gekleidet, erwarten den Segen ihres geistigen Führers, Master Moon. Diese undifferenzierte Masse wirkt auf den Zuschauer äußerst unangenehm; DeLillo spricht von anschwellenden Wellen, Wellenbewegungen, die der Menge zwar eine gewisse Ruhe verleihen, nichtsdestotrotz aber einen bedrohlichen Eindruck vermitteln. Die Massenhochzeit scheint ein extremes Symptom des Zustands der Gesellschaft im ausklingenden Jahrtausend. Journalist Martin Amis schreibt dazu in einem Review, dass die postmoderne Welt das Ich bis zum Punkt der Unerträglichkeit erhebt, und dass diejenigen, die nicht mithalten können, auf eine Idee oder besser noch auf eine Persönlichkeit zurückgreifen müssen12. Dies tun die Anhänger Master Moons, indem sie ihn über sich bestimmen und sich ihr Leben diktieren lassen. Sie reduzieren ihr Ich bis zum Stadium der Kindheit, lassen seine Kirche das Denken übernehmen, folgen Anweisungen, um wie als reines, unschuldiges Kind zu Gott zurück zu finden. Die Sekte nutzt die verbleibende Zeit zur Jahrtausendwende, um so viele Menschen wie möglich zu "erretten". Die allgemeine Hysterie eines drohenden Weltuntergangs und die Hoffnungslosigkeit des meist städtischen, industrialisierten Lebens werden für höhere Ziele in Profit umgewandelt, der von den entmündigten Mitgliedern der Sekte erwirtschaftet wird. Nur wer hervorragende Leistungen erbringt, wird erlöst werden.
Doch DeLillo klagt die Sekte und diese zweifellos weltlichen Motive nicht an, er verurteilt auch die Gläubigen nicht, sondern nimmt sie als Teil seiner Vision der Gesellschaft an. Er akzeptiert das Verlangen in der Masse zu verschwinden, Teil eines größeren zu werden auch wenn es die Aufgabe der eigenen Individualität bedeutet. Er tut es nicht als moralisch verwerflich ab, noch pocht er auf Individualismus und die Kraft des Einzelnen. Wie Scott treffend bemerkt, ist der Grund für Massenhochzeiten wie diese, dass sich die Menschen zeigen, dass sie als Gemeinschaft überleben müssen und nicht als Individuen, die die moderne Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten allein bewältigen müssen. Für DeLillo liegt die Kraft des Einzelnen in der Fähigkeit sich in eine Masse zu integrieren, was jedoch nicht bedeutet, dass er dies gutheißt. Im Gegenteil. Besonders ein Schriftsteller sollte, wie er immer wieder betont, außerhalb der Gesellschaft stehen und sie mit kritischem Blick prüfen. Oberflächlich gesehen scheint dies eine eher gleichgültige Haltung zu sein, auf dem Leser aber hinterlässt sie einen stärkeren Eindruck und führt zu einem bewussteren Wahrnehmen des Zustands der Gesellschaft am Ende des Jahrtausends, als es eine subjektive Wertung je könnte. Trotzdem gelingt es DeLillo, das Bild der Menschenmenge gerade durch diese objektive, beobachtende und fast schon neutrale Sichtweise negativ einzufärben.
Die monumentale Inszenierung der Massenhochzeit, auf der 13.000 Stimmen in einem Baseballstadium in einem gemeinsamen Gesang zu einer Stimme, der Master Moons, verschmelzen, verläuft jedoch friedlich und strukturiert ab. Die Paare reihen sich auf, passieren ihren Meister, der den Segen gibt, dann gehen sie ab. Anders ist der Ablauf bei den Ausschreitungen während des Fußballspiel, das Karen in den Nachrichten sieht13. Dort herrscht ein wildes Durcheinander, der Einzelne verschwimmt, wird auf wenige sichtbare Körperteile reduziert, die die Kamera erfassen kann. Es gibt keine ordnenden Kräfte mehr, nur Gewalt und das gegenseitige Erdrücken. Im Vordergrund werden Menschen gegen Zäune und Absperrungen gepresst, ihre Körper verrenken sich, so dass sie gar nicht mehr richtig als Menschen zu erkennen sind. Sie sind eine Anzahl von Armen, die sich über eine breite, den Fernsehbildschirm vollständig füllende Masse erhebt. Weiter hinten versuchen andere, über Köpfe und Schultern zu klettern, der Druck auf die in den Zaun gepressten Körper verstärkt sich. Einige sind schon tot oder gerade im Begriff zu sterben. Auf der anderen Seite des Zauns dagegen stehen andere und schauen ruhig zu. Karen vergleicht dieses Bild einer Menschenmasse, die in Panik und Agonie zusammengedrängt wird, mit einem religiösen Bild, einem Fresko an einer Kirchenwand. Es erscheint ihr wie ein Gemälde, das künstlerisch ausgewogen aufgebaut und mit leidenden Menschen gefüllt wurde. Auch hier besteht eine Verbindung zwischen der Masse und der Religion, die jedoch hier nicht zu Erlösung führt. Die Augen der Menschen sind gefüllt mit Hoffnungslosigkeit und dem Wissen um ihren Tod. Wie DeLillo selbst sieht auch Karen dem grausamen Spektakel gleichgültig zu. Das Leiden der anderen hat scheinbar keinen Effekt auf sie, auch hier fehlt jegliche Wertung außer jener, die schon in der trockenen Erzählweise enthalten ist.
Die abstumpfende Wirkung des Fernsehens wurde auch schon in White Noise angesprochen und wird hier wieder aufgegriffen. Anders als bei der Massenhochzeit der Moon-Sekte, bei der DeLillo teilweise aus der Sicht eines Augenzeugen berichtet und so den Leser in das Geschehen einbindet, schafft der Fernsehbericht eine Distanz zwischen dem Zuschauer und den Betroffenen. Diese Distanz wird Karen erst bewusst, als sie später Fernsehaufnahmen vom Begräbnis Ayatollah Khomeinis14 sieht. Sie sieht diese enorme Masse von Trauernden, die den Tod ihres religiösen Führers nicht akzeptieren wollen und deren Trauer zu Gewalt gegen sich selbst führt, und muss sich fragen, warum nicht auch sie ein Gefühl der Trauer empfindet. Wenn andere diese Bilder sehen, fragt sie, wenn die Zahl der Zuschauer denen der Klagenden gleichkommt, müssten sie nicht etwas Gemeinsames fühlen? Etwas Verbindendes wie Trauer? Karen versucht sich in die Trauernden hineinzuversetzen, versucht mitzufühlen. Sie setzt diesen Versuch um, indem sie in New York mit Obdachlosen spricht und den Weg Master Moons predigt. Auch bei den trauernden Iranern handelt es sich um eine homogene Masse, alle sind in tiefes Schwarz gekleidet, sind vereint in ihrer Trauer, wie die Moonies in ihrer Zeremonie. Ihre Trauer drückt sich jedoch in Hysterie aus, die der der Fußballfans sehr ähnelt. Sie wird zu einer alles überrollenden Kraft, einer alles verschlingenden Welle, die sogar vor dem Toten selbst nicht Halt macht. Die Trauer ist so beherrschend, dass die Klagenden den Tod ihres Führers nicht wahrhaben wollen. Sie versuchen ihn mit aller Kraft davon abzuhalten in sein Grab gelegt zu werden. Der Respekt vor den Toten scheint den Trauernden völlig verloren gegangen zu sein. Ihre Verzweiflung macht den Einsatz von Militär erforderlich, das ein angemessenes Begräbnis nur mit Mühe und viel Gegengewalt ermöglichen kann. Wie im Kriegszustand müssen die Soldaten mit Wasserwerfern und Maschinengewehren gegen die Massen vorgehen. Immer wieder durchbrechen diese Barrikaden, sogar den Hubschrauber, der den Sarg transportiert, bringen sie fast zum Absturz. DeLillos Beschreibung der Beerdigung Ayatollah Khomeinis enthält Elemente der Massenhochzeit als auch des Fußballspiels. Das Individuum geht in diesen beiden Arten von Menschenmenge völlig verloren, wird in einen Körper integriert, in dem es keinerlei Kontrolle über das Geschehen mehr hat. Auch verbindet DeLillo die Massen stets mit Formen von Gewalt; während die Sekte psychische Gewalt gegen ihre Mitglieder anwendet, d.h. ihnen Doktrinen einimpft, sie zum Wohl der Sekte umprogrammiert, werden die anderen physischer Gewalt ausgesetzt. Sie müssen nicht um das Wohl ihrer Seele fürchten, sondern um ihre Gesundheit und ihr Leben. Karen erscheint als einzige der Charaktere in Mao II als Teil einer Masse. Bill, Scott und Brita sind Individuen, die alle an einer Art von Obsession leiden. Dass ihre Aufgaben keinen wirklichen Sinn haben, zeigt die Endlosigkeit ihres Bestrebens nach perfektem Ausdruck, Archivierung und Sammlung. Diese drei Menschen arbeiten nur noch der Tätigkeit wegen. Es ist im Grunde völlig belanglos, was sie tun, denn es hat seinen Sinn verloren.
Im Gegensatz zur Masse, in der die Identitäten zu einer einzigen zusammenschmelzen, existieren die Individuen völlig unabhängig voneinander. Sie haben keinerlei Verbindung, sind unfähig wirklich zu kommunizieren. Dies findet besonders in den Dialogen Ausdruck, die DeLillo um alltägliches Geschehen wie etwa ein Abendessen entwirft15. In diesem Beispiel findet keine oder kaum Interaktion zwischen den Charakteren statt. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Gedanken und Handlungen. Es wird kaum noch auf den Gegenüber eingegangen. Bill will dem Tischgespräch ein Thema geben, doch niemand reagiert. Karen erzählt von einem Verkehrsschild, das sie gesehen hat. Scott glaubt, Bill bis ins Detail zu kennen, und Brita versucht auf jeden Beitrag genauer einzugehen. Die Kommunikation scheint absurd, da alle aneinander vorbeireden. Dies ändert sich sobald nur noch zwei Individuen miteinander sprechen. Brita und Bill z.B. führen, während sie ihn fotografiert, eine ernsthafte Unterhaltung über Bills abgeschiedenes und ihr turbulentes Leben in New York. Auch wird hier die Verbindung zwischen Schriftstellern und Terroristen zum ersten Mal angesprochen, die später im Gespräch mit dem Kontaktmann der Terroristen weiter ausgeführt wird. Es kann also durchaus Kommunikation zwischen Individuen stattfinden. Der Autor Thomas Pynchon jedoch schrieb schon 1937 in seiner Kurzgeschichte Entropy16, dass sich die moderne Gesellschaft in einem Zustand der Entropie befinde.
Pynchon entlieh diesen Begriff der Thermodynamik und übersetzte ihn in den Bereich der Kommunikation. Er bezeichnet ein geschlossenes System, in dem alle Elemente auf einen gleichwertigen, "demokratischen" Zustand hinarbeiten. Alle geschlossenen Systeme aber haben die Tendenz zur Selbstauflösung. Sie werden statisch und "sterben", da ihnen zwar ständig Energie von außen zugeführt wird, sie aber nicht wieder abgegeben werden kann. Wenn Menschen, so Pynchons Theorie, geschlossene Systeme -also Individuen- sind, und sie stets Informationen empfangen, jedoch keine senden können, dann kann keine Kommunikation stattfinden. Er wird seiner Umwelt entfremdet. Ich denke, dass sich Pynchons Theorie sehr gut auf Mao II übertragen lässt.
Don DeLillo ist heute zweifellos einer der einflussreichsten Schriftsteller der 90er Jahre. Er schafft es, den Zustand der Gesellschaft präzise zu erfassen und gefährliche Tendenzen und bedenkliche Entwicklungen, die sie nimmt, zu entlarven. Seinen Romanen liegt eine Art Galgenhumor inne, der dem Leser das Lachen im Halse steckenbleiben lässt. Die Komik, mit der DeLillo die Unfähigkeit zur Kommunikation ausdrückt, wirkt umso bedrohlicher, je alltäglicher und bekannter er die Situation beschreibt. Der Leser erkennt sich dabei selbst wieder und wird sich gleichzeitig seiner eigenen Unfähigkeit bewusst. Allgemein gesehen ist der Roman der 90er sehr leserfreundlich. Die Autoren bedienen sich eines einfacheren Erzählstils und die Romane sind zusammenhängend gestaltet und nicht mehr in postmoderner Tradition fragmentiert. Dem Plot wird wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was die Lesbarkeit um ein vielfaches verbessert. Der Effekt, den Sprache auf den Leser hat, wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Tim O'Brien schafft in seinem In the Lake of the Woods einen düsteren und sehr atmosphärischen Roman, der den Leser schnell in seinen Bann zieht. Sprachlich fallen einige der Romane durch Situationskomik und beinahe kauzigen Humor auf. Bei E. Annie Proulxs The Shipping News zum Beispiel fasst ihr Protagonist die Ereignisse seines Lebens in Zeitungsüberschriften zusammen, was sogar ernsten Situationen eine ungeheure Komik verleiht. Ferner zeichnen sie sich durch eine Mischung von Genres aus, die allen im Kurs gelesenen Büchern gemein ist. Elemente der Fiktion werden mit solchen aus der realen Welt vermischt. So kann der in Austers Music of Chance der Weg des Protagonisten durch die USA bis zu dem Punkt genau verfolgt werden, an dem er die beiden seltsamen Millionäre trifft. Tim O'Brien benutzt falsche Beweismittel und Interviews, um den Leser auf eine falsche Fährte zu locken, die Orte der Handlung sind jedoch real. Ebenso bei E. Annie Proulx. Während aber in ihrem Roman das Individuelle, Persönliche angesprochen und die Geschichte Quoyles erzählt wird, schlägt Don DeLillo einen eher politischen Ton an. Stewart O'Nan erzählt mit nüchterner Sachlichkeit, während Tim O'Brien mit aller Sprachgewalt zu beeindrucken sucht. Der Roman der 90er ist vielfältig. Bei allen fällt jedoch die Auflösung der alten Vorstellungen von Heim und Heimat auf. Die Protagonisten verlassen ihre Heimat, reisen durch das Land, leben in gemieteten Häusern, Wohnungen, Wohnwagen. O'Brien lässt am Ende seines Romans das Haus seiner Protagonisten einreißen, bei Proulx reißt ein Sturm das Wohnhaus ins Meer. DeLillo macht das Haus seines Protagonisten zu seinem Gefängnis. "Zu Hause" hat seine Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlende Kraft verloren. Die Familien selbst sind dabei sich aufzulösen. Da sind Mütter, die ihre Kinder verlassen, Ehemänner, denen ihre Familie egal ist, und Ehepaare, die kinderlos bleiben, weil die politische Karriere des einen Partners vorgeht. Sie alle kämpfen mit dem Alltag, ihren Gefühlen, ihren Unsicherheiten, der Hoffungslosigkeit, dem Leben eben. Das macht für mich den Roman der 90er aus. Die kritische Betrachtung des Alltags und die unterschwellige Warnung, die in den Beobachtungen der Schriftsteller liegt. Dazu ist es jedoch nötig, dass sie versuchen einen Platz außerhalb des mainstreams einzunehmen, der jeden Schriftsteller in die undifferenzierbare Masse der Menschen zu absorbieren droht.
Denn dieser gehört die Zunkunft.
[...]
1 Barth, John. "The Literature of Exhaustion". The Atlantic, 1967.
2 Barth, John. "The Literature of Replenishment". The Atlantic, Januar, 1980.
3 Auster, Paul. City of Glass. New York : Viking Penguin Inc., 1987.
4 O'Brien, Tim. In the Lake of the Woods. New York : Houghton Mifflin, 1994.
5 Auster, Paul. Music of Chance. London : Faber & Faber, 1991.
6 Proulx, E. Annie. The Shipping News. London : Fourth Estate Ltd, 1993.
7 O'Nan, Stewart. Snow Angels. New York : Penguin Books Ltd, 1995.
8 DeLillo, Don. Americana. Boston : Houghton Mifflin, 1971.
9 DeLillo, Don, und Auster, Paul. "Salman Rushdie Defense Pamphlet". New York : Rushdie Defense Committee USA. 14 Feb. 1994. New York : Penguin Books Ltd, 1991.
10 DeLillo, Don. Mao II. New York : Penguin Books USA Inc., 1991.
11 DeLillo, Don. White Noise. New York : Viking Penguin Inc., 1984.
12 Amis, Martin. "Throroughly post-modern millenium", The Independent, Sep. 8, 1991, p.29.
13 DeLillo, Don. Mao II. New York : Penguin Books USA Inc., 1991, p. 32-34.
14 DeLillo, Don. Mao II. New York : Penguin Books USA Inc., 1991, p. 188-193.
15 DeLillo, Don. Mao II. New York : Penguin Books USA Inc., 1991, p. 68-74.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Seminararbeit „Der amerikanische Roman der 90er und das Bild des Menschen als Masse anhand Don DeLillos Mao II“?
Die Seminararbeit analysiert den amerikanischen Roman der 1990er Jahre, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung des Menschen als Teil einer Masse. Sie betrachtet, wie Autoren auf gesellschaftliche Tendenzen reagieren und wie die Literatur zu einem Medium der kritischen Betrachtung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft wird. Ein besonderer Fokus liegt auf Don DeLillos Roman Mao II.
Welche Themen werden im amerikanischen Roman der 90er Jahre behandelt?
Zu den zentralen Themen gehören die Auseinandersetzung mit postmoderner Literatur, Identität, Multikulturalismus, die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft, Terrorismus, der Verlust der traditionellen Familie, die Abstumpfung durch Medien, die Gleichgültigkeit gegenüber Katastrophen, die Gegenüberstellung von Individuum und Masse, der Verlust von Heimat und Geborgenheit sowie die Auflösung traditioneller Familienstrukturen.
Welche postmodernen Techniken werden von den Autoren der 90er Jahre verwendet?
Obwohl viele Autoren zur Tradition des Geschichtenerzählens zurückfinden, bedienen sie sich nach wie vor postmodernen Techniken. Dazu gehören die Vermischung von Genres und Erzählstrukturen, das Spiel mit Fakt und Fiktion, das Hinterfragen der Autorität des Autors, die Subversion von Genres und das Verschwimmen von Identitäten.
Welche Rolle spielt der Terrorismus in Don DeLillos Roman Mao II?
In Mao II wird der Terrorismus als eine Kraft dargestellt, die die Rolle der Literatur übernommen hat. Nur der gewaltsame Akt der Zerstörung könne noch zum Individuum durchdringen und das Bewusstsein verändern, was früher Aufgabe der Schriftsteller gewesen sei.
Wie wird die Masse in Mao II dargestellt?
Die Masse wird ambivalent dargestellt. Einerseits wird die Tendenz, in der Masse zu verschwinden und Teil eines Größeren zu werden, als ein Symptom der modernen Gesellschaft akzeptiert. Andererseits wird die Masse mit Gewalt und dem Verlust der Individualität in Verbindung gebracht. Beispiele dafür sind Massenhochzeiten, Ausschreitungen bei Fußballspielen und die Trauernden bei Ayatollah Khomeinis Beerdigung.
Welche Bedeutung hat das Haus für den Protagonisten in Mao II?
Das Haus wird für den Protagonisten Bill Gray zu einem Gefängnis, in dem er sich von der Außenwelt abschottet und sich nur noch mit seiner Arbeit beschäftigt. Es symbolisiert den Verlust von Heimat und Geborgenheit und die Entfremdung von der Gesellschaft.
Welche Autoren werden neben Don DeLillo in der Seminararbeit erwähnt?
Neben Don DeLillo werden unter anderem Paul Auster, Tim O'Brien, E. Annie Proulx, Stewart O'Nan, John Barth, Thomas Pynchon und Salman Rushdie erwähnt.
Was sind die Kernthesen der Seminararbeit?
Die Seminararbeit argumentiert, dass der amerikanische Roman der 90er Jahre die Tradition des Geschichtenerzählens wieder aufgreift, aber gleichzeitig postmoderne Techniken verwendet, um gesellschaftliche Probleme und Tendenzen kritisch zu reflektieren. Ein zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Individuum und Masse und die Rolle des Schriftstellers in einer von Medien und Gewalt geprägten Welt.
- Citar trabajo
- Susanne Maßwig (Autor), 1998, Der amerikanische Roman der 90er und das Bild des Menschen als Masse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99127