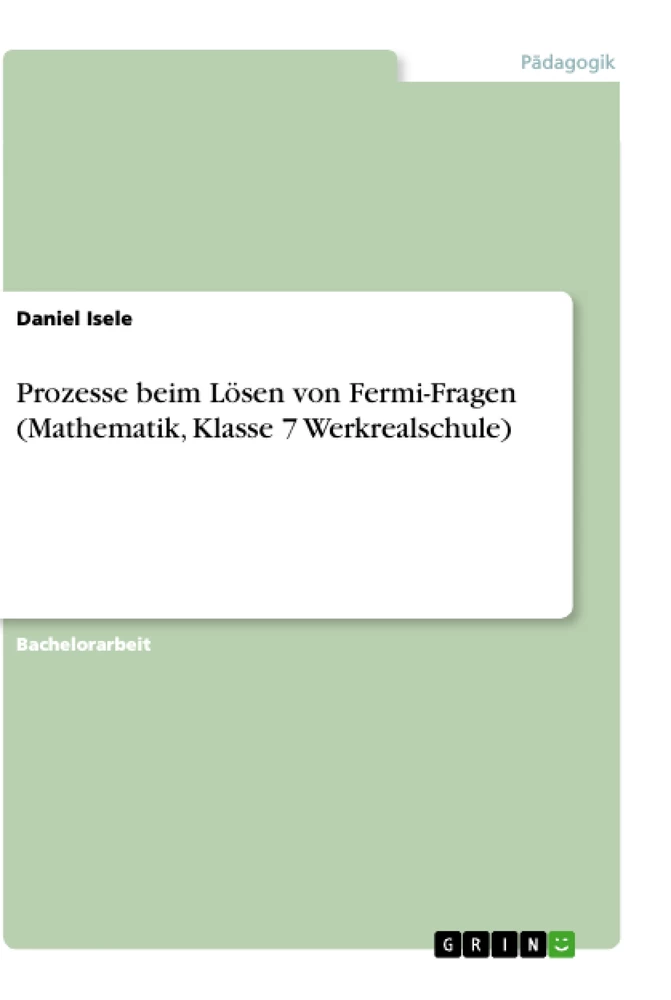In dieser Arbeit wird das Vorgehen von einzelnen Schülergruppen beim Lösen von Fermi-Aufgaben beobachtet und dokumentiert, da es vor allem in Bezug auf den mathematikdidaktischen Kontext betrachtet bedeutsam ist, verstehen zu können, wie Schüler sich Möglichkeiten zum Lösen Fermi-Aufgaben schaffen. Dadurch soll es ermöglicht werden, Schlüsse aus dem Denken und Handeln der einzelnen Schüler zu ziehen.
Um dies zu tun, muss zuerst der theoretische Hintergrund aufgezeigt werden. Es wird erklärt, was Fermi-Fragen sind und was sie auszeichnet. Anschließend werden zwei unterschiedliche Modelle zur Auffassung der Gedankenprozesse vorgestellt und erklärt. Daraufhin beginnt die Beschreibung der durchgeführten Untersuchung. Dazu wurde mit einer Schule zusammengearbeitet und eine Klasse zum Lösen von Fermi-Fragen untersucht und aufgezeichnet. Die Schüler wurden dabei Gruppen zugeordnet, um so ihre Prozesse beim Bearbeiten einordnen zu können. Die daraus resultierenden Erkenntnisse spiegeln sich in dieser Arbeit wider. Dabei werden mathematische Modelle, die sich nicht explizit auf Fermi-Fragen berufen außen vorgelassen. Denn nur Modelle, die sich auf diese Fragen beziehen, sind für diese Untersuchung von Relevanz, um darstellen zu können, ob diese Fehler oder Ungereimtheiten aufweisen.
Wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? Eine solche Frage mittels Mathematik zu lösen, stellt vor verschiedene Herausforderungen. Wie wird bei derartigen Fragen vorgegangen und was muss berücksichtigt werden? Wer solche offenen Aufgaben, sogenannte Fermi-Fragen zum ersten Mal hört, dem fehlt vermutlich jegliche Vorstellung, wie diese überhaupt zu lösen sind. Durch nicht gegebene relevante Angaben fehlt zunächst eine strategische Herangehensweise. Die Frage scheint gar unlösbar, denn ausschlaggebende Werte, wie etwa die Einwohneranzahl in Chicago, werden nicht genannt. Doch solche offenen Aufgaben sind lösbar und der Weg zur Lösung ist meist interessanter als die Lösung selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Fermi-Fragen
- 2.2 Modelle zur Analyse der Lösungen von Fermi-Fragen
- 2.2.1 Modell nach Ärlebäck
- 2.2.2 Fermi-Task-Modell
- 3. Schulische Voraussetzungen
- 3.1 Schule
- 3.1.1 Ziele und Schwerpunkte
- 3.1.2 Leitgedanken Werkrealschule
- 3.1.3 Besonderheiten der Schule
- 3.1.4 Trainingswochen Werkrealschule
- 3.2 Beschreibung der Klasse WR7
- 4. Untersuchung
- 4.1 Rahmenbedingungen
- 4.2 Ablauf
- 4.3 Analyse der Einführungsstunde
- 4.4 Analyse der Untersuchung
- 5. Prozesse der Auswertungen
- 5.1 Transkripte
- 5.2 Einteilung in die Modelle
- 5.2.1 Einteilung in das Modelling Activity Diagram nach Ärlebäck
- 5.2.2 Einteilung in das Fermi-Task-Modell
- 6. Vergleich der Gruppenprozesse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Beobachtung und Dokumentation von Prozessen beim Lösen von Fermi-Fragen. Ziel ist es, die Anwendung zweier Modelle – das Modell nach Ärlebäck und das Fermi-Task-Modell – bei der Analyse der Lösungsstrategien von Schülern zu untersuchen und zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Modelle im schulischen Kontext.
- Analyse von Lösungsstrategien beim Lösen von Fermi-Fragen
- Anwendung und Vergleich des Modells nach Ärlebäck und des Fermi-Task-Modells
- Beobachtung von Gruppenprozessen im schulischen Kontext
- Dokumentation und Auswertung der Ergebnisse mithilfe von Transkripten
- Bewertung der Eignung der Modelle für die Analyse von Schülerlösungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt den Forschungsansatz. Sie benennt die Fragestellung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz der Untersuchung von Fermi-Fragen im Mathematikunterricht hervorgehoben und die gewählte Methodik begründet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes und der Zielsetzung der Arbeit.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden Fermi-Fragen definiert und verschiedene Modelle zur Analyse ihrer Lösungen vorgestellt, insbesondere das Modell nach Ärlebäck und das Fermi-Task-Modell. Die Kapitel erläutern die jeweiligen Modellansätze detailliert und beleuchten ihre Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Anwendung im schulischen Kontext. Es werden die theoretischen Grundlagen gelegt, um die spätere empirische Untersuchung zu verstehen und zu interpretieren.
3. Schulische Voraussetzungen: In diesem Kapitel werden die schulischen Rahmenbedingungen der Untersuchung beschrieben. Die gewählte Schule, die Klasse und die Schüler werden vorgestellt. Es werden die Ziele und Schwerpunkte der Schule, ihre Besonderheiten und die durchgeführten Trainingswochen im Detail erläutert. Die Beschreibung dient dem Verständnis des Kontextes der empirischen Untersuchung und ermöglicht die Einordnung der Ergebnisse.
4. Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung der empirischen Untersuchung. Es werden die Rahmenbedingungen, der Ablauf der Untersuchung und die Analyse der Einführungsstunde detailliert dargestellt. Die Beschreibung umfasst die gewählten Methoden, die eingesetzten Materialien und den Ablauf der Datenerhebung. Es wird die Vorgehensweise bei der Analyse der Schülerlösungen erläutert und die methodischen Entscheidungen begründet.
5. Prozesse der Auswertungen: Dieses Kapitel beschreibt die Auswertung der erhobenen Daten. Es wird erläutert, wie die Transkripte erstellt und die Schülerlösungen in die beiden Modelle (Ärlebäck und Fermi-Task-Modell) eingeordnet wurden. Die Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Codierung und Analyse der Daten und erläutert die verwendeten Kategorien und Kriterien. Die detaillierte Beschreibung der Auswertungsmethodik gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Fermi-Fragen, Fermi-Task-Modell, Modell nach Ärlebäck, Modelling Activity Diagram (MAD), Lösungsstrategien, Gruppenprozesse, Mathematikunterricht, Sekundarstufe I, empirische Untersuchung, qualitative Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse von Lösungsstrategien bei Fermi-Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Prozesse beim Lösen von Fermi-Fragen und analysiert die Anwendung zweier Modelle – das Modell nach Ärlebäck und das Fermi-Task-Modell – zur Analyse der Lösungsstrategien von Schülern. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Modelle im schulischen Kontext der Sekundarstufe I.
Welche Modelle werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet zwei Modelle zur Analyse der Lösungsstrategien: das Modell nach Ärlebäck und das Fermi-Task-Modell. Die Arbeit vergleicht die Anwendung und die Eignung beider Modelle für die Analyse von Schülerlösungen.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung und -auswertung verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung in einer Werkrealschule. Die Datenerhebung erfolgte durch Beobachtung und Dokumentation der Lösungsfindungsprozesse in Gruppen. Die Auswertung umfasst die Erstellung von Transkripten und die Einordnung der Lösungsstrategien in die beiden Modelle. Es handelt sich um eine qualitative Datenanalyse.
Welche Fragestellung wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Fragestellung ist, wie die beiden Modelle (Ärlebäck und Fermi-Task-Modell) die Lösungsstrategien von Schülern beim Bearbeiten von Fermi-Fragen abbilden und wie gut sie sich für die Analyse im schulischen Kontext eignen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen (inkl. Definition von Fermi-Fragen und Beschreibung der Modelle), Schulische Voraussetzungen (Beschreibung der Schule und der teilnehmenden Klasse), Untersuchung (Durchführung der empirischen Untersuchung), Prozesse der Auswertungen (Beschreibung der Datenanalyse) und Vergleich der Gruppenprozesse.
Was sind Fermi-Fragen?
Fermi-Fragen sind Schätzaufgaben, die das Abschätzen von Größenordnungen im Alltag erfordern, oft ohne vollständige Informationen. Sie fördern das schlussfolgernde Denken und die Anwendung von mathematischen Kenntnissen in realen Kontexten.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Schülerlösungen unter Anwendung der beiden Modelle. Es wird ein Vergleich der Modelle hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Aussagekraft im Kontext der Untersuchung gezogen. Die Ergebnisse werden durch Transkripte und eine detaillierte Beschreibung der Auswertungsmethodik belegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Fermi-Fragen, Fermi-Task-Modell, Modell nach Ärlebäck, Modelling Activity Diagram (MAD), Lösungsstrategien, Gruppenprozesse, Mathematikunterricht, Sekundarstufe I, empirische Untersuchung, qualitative Datenanalyse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I, die an innovativen Lehrmethoden interessiert sind und die Anwendung von Fermi-Fragen im Unterricht fördern möchten. Sie ist ebenfalls relevant für Wissenschaftler, die sich mit der Analyse von Problemlöseprozessen und der Entwicklung von Modellen zur Beschreibung dieser Prozesse beschäftigen.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im einführenden Teil der Arbeit und beinhaltet alle Kapitel und Unterkapitel mit ihren jeweiligen Inhalten.
- Quote paper
- Daniel Isele (Author), 2019, Prozesse beim Lösen von Fermi-Fragen (Mathematik, Klasse 7 Werkrealschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990826