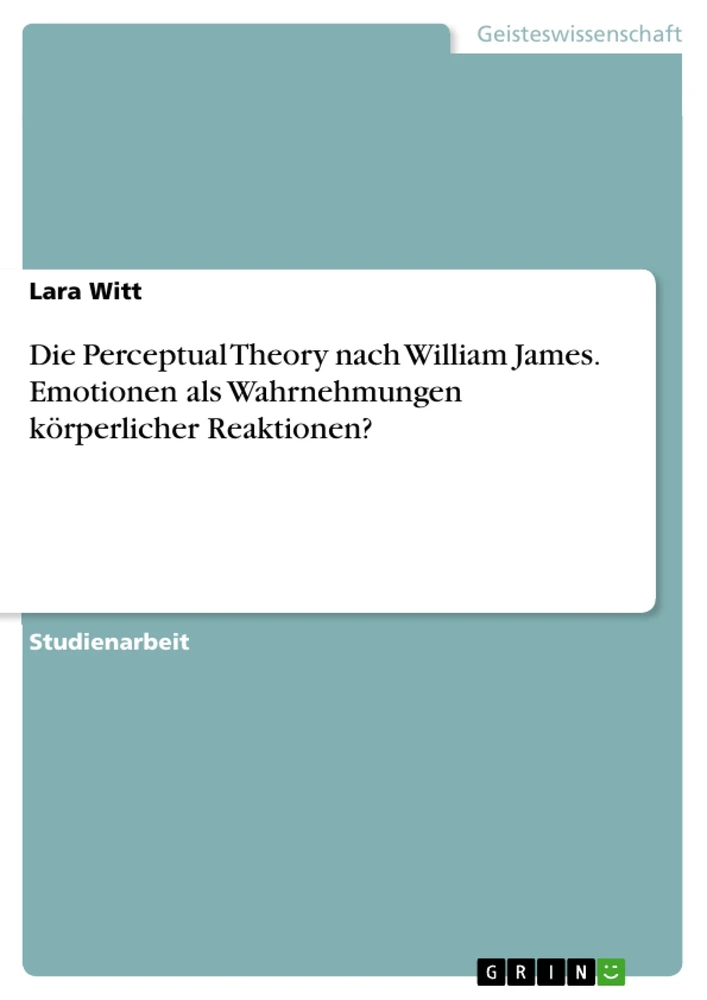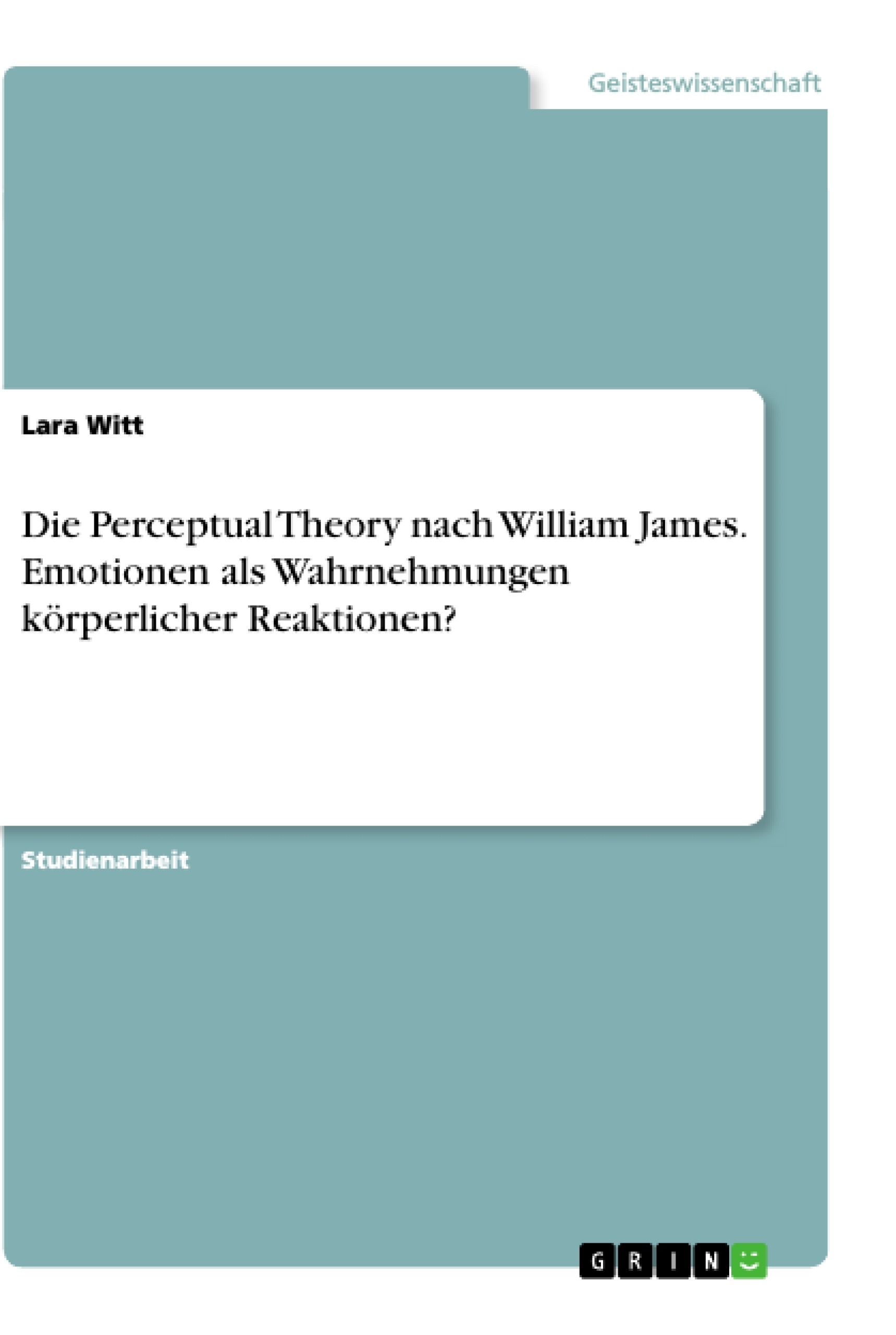Diese Arbeit wird sich mit dem Ansatz der Emotionstheorie nach William James beschäftigen, einer sogenannten "Perceptual theorie". Die Philosophie der Emotionen erstreckt sich beinahe über die gesamte Menscheinheitsgeschichte. Das emotionale Leben eines jeden einzelnen Menschen ist umfassend und variabel, vor allem aber sehr schwer zu ergründen.
Emotionen stellen ein zentrales Phänomen in unserem Leben dar. Zunächst wird dies unterstreichen durch die Häufigkeit des Erlebens von Emotionen; sie sind präsent und begleiteten unser alltägliches Leben. Zweitens intensivieren Emotionen das Ausmaß der persönlichen Bedeutsamkeit von Ereignissen oder Erlebnissen. Zuletzt, wie in einigen Emotionstheorien bestätigt, können Emotionen Handlungsimpulse liefern oder diese selbst darstellen.
Seit jeher widmeten Philosophen sich der Thematik der Emotionen und ergründeten diese auf verschiedenste Weise; bereits klassische Philosophen wie Platon oder Aristoteles befassten sich umfassend mit dieser Thematik. Die Verschiedenheit der Epochen und Jahrhunderte prägte selbstverständlich auch die Verschiedenheit der Emotionsphilosophie, da unteranderem unterschiedliche Erkenntnisinteressen herrschten. Die theoretische Auseinandersetzung mit Emotionen begann beispielsweise erst im 17. Jahrhundert. Es ist jedoch festzustellen, dass die Philosophie bezüglich der Gefühlsproblematik in den letzten Jahren eine Renaissance erfuhr. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die Fusion verschiedener Wissenschaften, welche hier ineinandergreifen. Gefühle oder Emotionen sind nun auch Bestandteile der psychologischen, biologischen und neurologischen Forschungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Philosophie der Emotionen
- 2 Die Emotionstheorie von William James
- 2.1 Die James-Lange-Theorie
- 2.2 Die modifizierte Fassung
- 3 Die Gegenposition von Walter B. Cannon
- 4 Die Vor- und Nachteile der Emotionstheorie nach William James
- 5 Neo-jamesianische Theorien: Facial-feedback-Hypothese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Emotionstheorie von William James und analysiert deren zentralen Ansatz, Emotionen als Wahrnehmungen körperlicher Reaktionen zu verstehen. Sie untersucht die James-Lange-Theorie, ihre modifizierte Fassung und die Gegenposition von Walter B. Cannon.
- Die James-Lange-Theorie und ihre Kernaussagen
- Die Rolle der Physiologie in der Emotionsphilosophie
- Die Beziehung zwischen Emotionen und körperlichen Veränderungen
- Die Kritik an der James-Lange-Theorie und alternative Theorien
- Die Bedeutung der Emotionstheorie für die heutige Emotionsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Philosophie der Emotionen ein und beleuchtet die historische Entwicklung dieses Forschungsfeldes. Es verdeutlicht die zentrale Bedeutung von Emotionen im menschlichen Leben und die vielfältigen Ansätze, die in der Geschichte der Emotionsphilosophie verfolgt wurden.
Das zweite Kapitel behandelt die Emotionstheorie von William James. Die James-Lange-Theorie, die James' zentrale These formuliert, wird vorgestellt und ihre Kernaussagen erläutert. Der Fokus liegt auf der Behauptung, dass Emotionen durch die Wahrnehmung körperlicher Veränderungen entstehen. Außerdem wird die modifizierte Fassung der Theorie behandelt und die Grenzen und Einschränkungen dieser Sichtweise diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Emotionstheorie von William James, insbesondere auf die James-Lange-Theorie. Schlüsselbegriffe sind Emotionen, Wahrnehmung, körperliche Veränderungen, Physiologie, Geist, Kognition, Emotionsphilosophie, Geschichte der Emotionen, und die Beziehung zwischen Körper und Geist.
- Quote paper
- Lara Witt (Author), 2019, Die Perceptual Theory nach William James. Emotionen als Wahrnehmungen körperlicher Reaktionen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990817