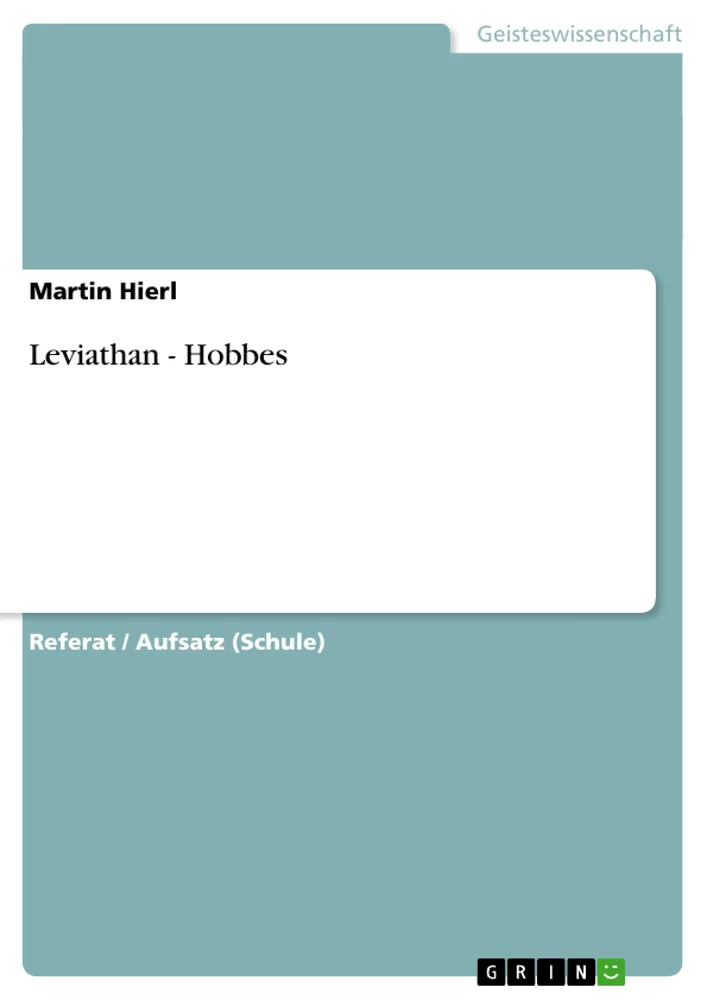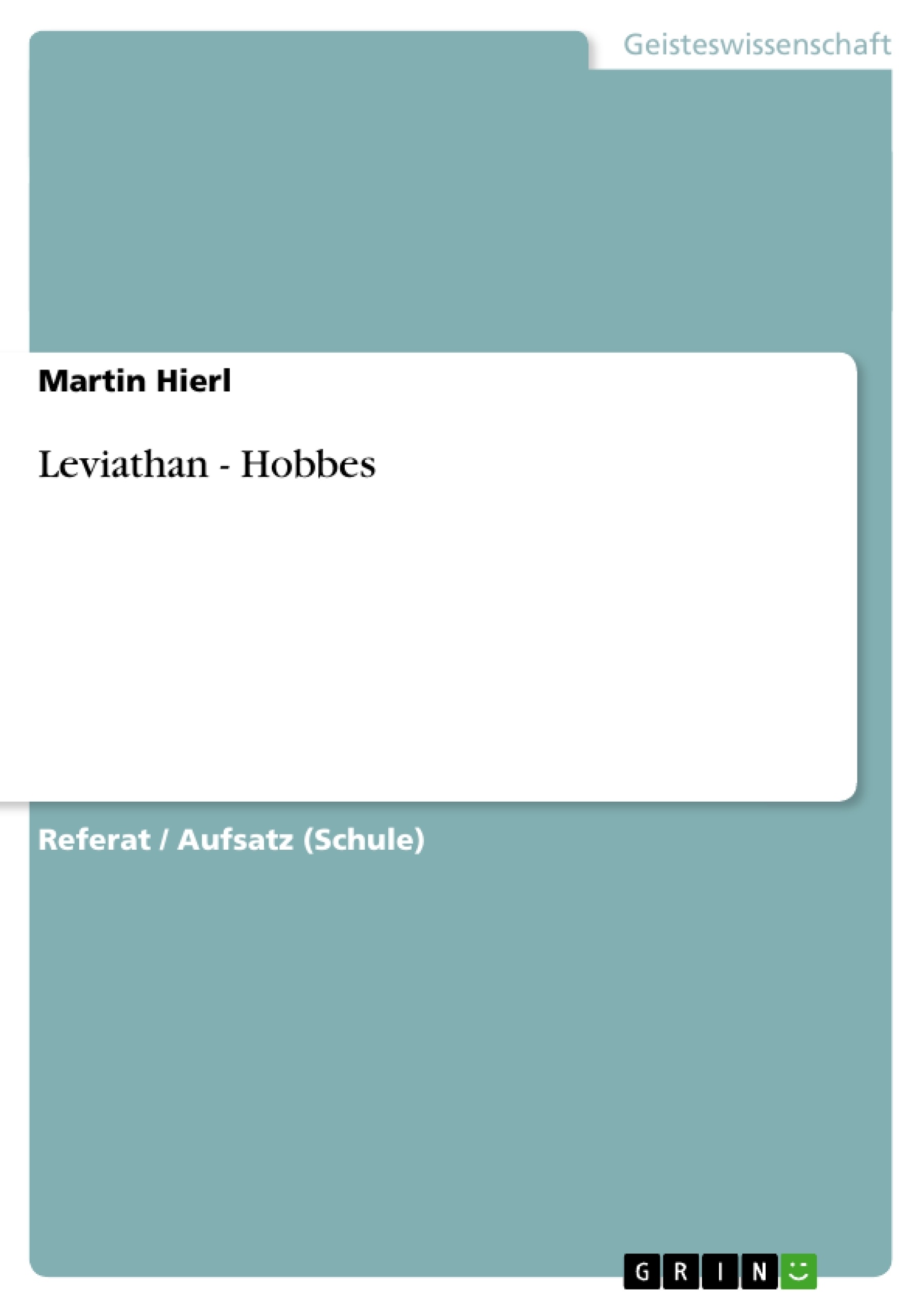Thomas Hobbes: Leviathan
1. Einleitung und Ziel der Arbeit Es gibt sicherlich ebenso viele Wege, sich Thomas Hobbes und seinen Werken zu nähern wie es Autoren gibt. Unbestritten ist gerade der „Leviathan“, sein letztes sozial- politisches Werk, zu einem Klassiker geworden, dessen Einfluss seit der Veröffentlichung bis in die heutige Zeit hineinreicht, ohne dass sich eine Interpretationslinie durchsetzen konnte. Damals wie heute sind die von Hobbes vertretenen Thesen und Ansätze so stark umstritten wie es sonst vielleicht nur noch bei Machiavelli der Fall ist. Zweifellos muss zum Verständnis seines An- satzes und seiner Überlegungen zunächst auf sein historisches politisches Umfeld eingegangen werden. Nur aus dem Schrecken den englischen Bürgerkrieges heraus lässt sich sein Menschenbild erklären und die Theorie, die er darauf aufbaut. Anschließend soll dieser Ansatz kurz erläutert wer- den, den Hobbes im ersten Teil des „Leviathan“ („Vom Menschen“) darstellt. Dieses Fundament ist zum Verständnis seiner Staats- und Vertragstheorie unentbehrlich hier nur kurz beleuchtet, da der Schwerpunkt dieser Hausarbeit auf Hobbes Staatstheorie liegt Daraufhin soll kurz zusammengefasst werden, wie Klaus von Beyme das Wort „Leviathan“ in seinem Buch „Die politische Klasse im Parteienstaat“ gebraucht, um so einen Einblick über die Position Thomas Hobbes in der heutigen Politikwissenschaft zu vermitteln. Schließlich wird diese Interpretation mit der Vorlage verglichen und die Position von Beymes hinterfragt, unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob eine solch eingeengte Sichtweise des Staatsentwurfes des „Leviathan“ gerechtfertigt ist. Das Ziel der gesamten Hausarbeit ist die Hinterfragung der These, Thomas Hobbes sei in erster Linie entschie- dener Vertreter einer absoluten (monarchischen) Regierungsform.
2. Die historischen Bestimmungsfaktoren zu Hobbes „Leviathan“ „Und eine solche Furcht empfing da meine Mutter, dass sie zwei Kinder gebar, mich und die Furcht“ . Gemeint ist der Armada- Angriff auf England im Geburtsjahr von Thomas Hobbes, 1588. Nach eigenen Angaben war ihm also das Gefühl der Furcht so nahe, dass er es als einen Bruder ansah, den er im gesamten Leben (also 91 Jahre) nicht los wurde und ihn und vor allem seine Arbeiten stark beeinflusste. Trotzdem verliefen seine ersten 40 Lebensjahre nicht außergewöhnlich. Bürgerlich geboren, besuchte er mit ca. 15 Jah- ren die Universität von Oxford und verinnerlichte den dort gelehrten Nominalismus. Durch enge Kontakte zu einer adligen Familie stieg er in die Kreise führender Gesellschaftsschichten ein, reiste viel und sammelte Welterfahrung, so, wie es viele bürgerliche Gelehrte taten. Ab ca. 1630 ändert sich dieses beschauliche „normale“ Leben. „Er wird verstrickst in die politischen Revolutionen sei- ner Zeit, nimmt Stellung, muss aus England fliehen, kehrt zurück, versöhnt sich mit dem Protekto- rat, dann mit dem restaurierten Königtum; zugleich aber findet er in diesen Jahren das große wis- senschaftliche Thema seines Lebens: Moral und Politik“ . Mit ausschlaggebend waren die Erfolge der Mathematik, deren Methode er auf den sozialen und politischen Bereich übertragen wollte. „Es gilt an Ethik, Politik und Naturrecht wie an mathematische Probleme heranzugehen; dann werden die Widersprüche, die in den traditionellen Lehren alles verdunkeln, verschwinden“ . Zu diesem Willen, die noch nicht wirklich begründete politische Wissenschaft zu systematisieren kommt ein genaues Gespür für die politischen Ereignisse und Umbrüche seiner Zeit, in England die Herrschaft der Stuarts und Oliver Cromwells, in Frankreich Richelieu und den Anfang Louis XIV. Seine poli- tische Ansichten, die er auch offen vertrat, machten ihm von Anfang an Probleme, 1640 musste er schließlich aus England nach Paris flüchten, da er die Souveränität des Königs vor dem Parlament in der Abhandlung „Elements of Law Natural and Politic“ verteidigt hatte. Aus dem Exil verfolgte er die politische Situation in England, die sich bis zu Ausbruch des Bürgerkrieges 1642 zuspitzte, der ihn und seine Einstellung zum Menschen und zum Staat stark beeinflusste. Der Prozess und die anschließende Hinrichtung Karls I. geben Thomas Hobbes den Anstoß für den Beginn der Arbeit am „Leviathan“. Als das Buch in englischer Sprache 1651 in London erscheint, wird es am Hofe Karls II. sehr ungünstig aufgenommen, Hobbes wird des Verrats und des Atheismus beschuldigt, das bislang gute Verhältnis zum englischen Hof in Paris ist zerstört, er kehrt in das vom Bürger- krieg verwüstete England zurück. Noch zu Lebzeiten werden einige seiner Werke (darunter auch der „Leviathan“) auf den Index der römischen Kirche gesetzt. Drei Jahre nach seinem Tod (1679) werden „De cive“ und „Leviathan“ „in feierlicher Zeremonie verbrannt, und die Studenten tanzten um den Scheiterhaufen“ .
3. Das Menschenbild im „Leviathan“ Im ersten Teil des „Leviathan“ beschreibt Hobbes sein Men- schenbild, das die Grundlage für alle weiteren Schritte seiner später ausgeführten Herrschafts- und Vertragstheorie bildet. Es ist geprägt von dem Schrecken des bereits neun Jahre andauernden engli- schen Bürgerkrieges, den er aus dem Exil in Paris verfolgt. Der zweite entscheidende Einfluss ist der Versuch, auch soziale und politische Überlegungen nach mathematischen Methoden anzustel- len. Um dieses zu erreichen muss Hobbes sämtliche Individualität der Menschen ausklammern und den einzelnen auf seinen Grundantrieb reduzieren, die Furcht oder positiv ausgedrückt den unbe- dingten Willen zur Selbsterhaltung. Vom Menschen schafft er „ein starkes, imposantes Bild. Was ihm fehlt, sind die versöhnlichen Zwischentöne“ . Auf diese Art sieht er den Menschen zunächst nicht als gesellschaftliches Wesen, denn um sich selbst zu erhalten hat der einzelne uneingeschränk- te Rechte. So kommt es zum Krieg aller gegen alle, denn jeder Mensch ist für den anderen in die- sem „Naturzustand“ (den es allerdings so wohl nie gegeben hat) zumindest ein potentieller Feind, dem mit Gewalt begegnet werden muss. Das Motiv der Selbsterhaltung führt hier zu seinem Gegen- teil, der stets präsenten Furcht, denn jeder Mensch ist gleichzeitig Jäger und Gejagter. Nur um die- sen Zustand zu verhindern und aus dem Teufelskreis auszubrechen, schafft Hobbes den Staat, der auf einem Vertrag aller Menschen beruht und stattet ihn mit einer großen Macht aus.
4. Der „Leviathan“ heute - Begriffsinterpretation von Klaus von Beyme Schon sehr schnell nach der Veröffentlichung seines Hauptwerkes „Leviathan“ wurde Thomas Hobbes in der öffentlichen Mei- nung zu dem Theoretiker der absoluten Monarchie und der Vater des Atheismus in England. Auch in den nächsten zwei Jahrhunderten hielt sich diese Position standhaft. Doch trotz der öffentlichen Brandmarkung scheinen die Theorien von Hobbes so fundamental zu sein, dass sie bis heute hin überlebt haben und nach wie vor noch gebraucht werden. Nur so ist es zu erklären, dass Klaus von Beyme dem zweiten Kapitel seines Buches „Die politische Klasse im Parteienstaat“ die Überschrift „Der neue Leviathan: Der Parteienstaat“ gibt. In diesem Teil der Arbeit soll es nun nicht darum gehen, den Inhalt dieses Kapitels oder gar des ganzen Buches wiederzugeben, vielmehr soll ver- deutlicht werden, wie das von Hobbes geprägte Wort „Leviathan“ heute von einem bekannten Poli- tikwissenschaftler verstanden und verwendet wird, um im nächsten Teil nachzuprüfen, ob diese Verwendung des Begriffs tatsächlich auf die Inhalte des „Leviathan“ zurückzuführen sind. Den Titel dieses Kapitels führt von Beyme leider nicht in seinem Buch weiter aus, die These, der heutige Parteienstaat gleiche dem Leviathan wird nicht weiter ausgeführt oder begründet. So kommt das Wort „Leviathan“ auch tatsächlich nur ein Mal (nämlich im Titel) im ganzen Buch vor. Daher be- schränke ich mich hier damit, die Grundaussagen über den Parteienstaat zu beschreiben, um so ei- nige Charakteristika über den gleichgestellten Leviathan herauszustellen. In erster Linie beschränkt sich von Beyme darauf, die große Machtfülle der Parteien in ihrer Gesamtheit in allen entscheiden- den Bereichen der Gesellschaft zu kritisieren. Eine politische Klasse besteht für ihn außerhalb staat- licher Institutionen nicht mehr, sie ist „ein Kartell der Parteieliten; sie tritt hauptsächlich durch den Ausbau des Parteienstaates auf“ . Staat und Gesellschaft werden durch die Parteien „kolonialisiert“, nicht mehr die direkte Beziehung zwischen Wähler und Abgeordnetem als Teil direkter Demokratie steht im Zentrum des politischen Prozesses, vielmehr hat sich mittlerweile eine Dreiecksbeziehung zwischen Wähler, Abgeordnetem und der Parteien entwickelt, was Gerhard Leibholz eine „rationa- lisierte Erscheinungsform der direkten Demokratie im modernen Flächenstaat“ nannte. Einzelne seien hier praktisch ohne Möglichkeiten der aktiven Einflussnahme im politischen Prozess. Die Entwicklung der Aufgaben der Parteien in der Gesellschaft lässt sich auch anhand deren Stellung in den verschiedenen Gesetzen feststellen. Hatten sie in der Weimarer Verfassung noch eine eher un- tergeordnete Stellung inne, wird im Grundgesetz bereits festgelegt, dass Parteien an der Willensbil- dung mitwirken (§ 21 GG). Im Parteiengesetz wird dann schon von der „Bildung des politischen Willens auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens“ (§ 1.2) gesprochen. Mit der hier beschriebenen zugenommenen Machtfülle der Parteien kam es auch zu Änderungen innerhalb der Parteien. Ging es zunächst noch um die Transmission des Parteiwillens auf öffentliche Institutionen, wurde diese innere Geschlossenheit einer Partei als „Gemeinschaft verschworener Kämpfer“ mehr und mehr aufgelöst. Mit der Entideologisierung ging auch eine verringerte Identifikation sowohl zwischen Parteimitglied und Partei als auch zwischen Wähler und Partei einher. Von Beyme meint bereits eine „Tendenz zur Überforderung der Parteien durch Ausweitung der Funktionen, die eine Partei ausübt“ zu erkennen. Diese Überforderung und die Abgehobenheit des Parteienstaates von den Wählern und den Parteimitgliedern sind die Hauptkritikpunkte von Beymes. Es bleibt also zu überprüfen, ob der von Hobbes entworfene „Leviathan“ auch in dieser Weise zu kritisieren ist. Durchdringt er auch alle Bereiche der Gesellschaft ? Ist er mit dieser Aufgabe überfordert ? Hat der Einzelne keine Möglichkeiten der Einflussnahme mehr ?
5. Eigene Stellungnahme zu ausgewählten Passagen des „Leviathan“ und Überprüfung von von Beymes Sichtweise Will man sich mit Hobbes Ansichten zu Staat und Gesellschaft auseinanderset- zen und ihn angreifen, so muss man seine Theorien als Ganzes betrachten, denn eben wie Mathema- tiker baut sich sein Theoriegebäude Ebene für Ebene auf, und es macht wenig Sinn, eine spezielle Passage herauszugreifen und gesondert zu betrachten. Es ist also unbedingt erforderlich, die Entste- hung des Staates zu analysieren, wenn man an der Struktur des Staates interessiert ist. Um den Na- turzustand „Krieg aller gegen alle“ zu überwinden muss eine künstliche Instanz als übergeordnete Gewalt geschaffen werden, obwohl dieses an sich gegen die Natur des Menschen in Bezug auf seine Freiheitsliebe und seinen Machttrieb steht. Diese oberste von allen anerkannte Instanz ist dazu da, die Menschen in Zucht zu halten und ihre Handlungen auf das Gemeinwohl hinlenkt. Die eigenen Rechte und die eigene Macht wird also auf einen Einzelnen oder eine Versammlung übertragen, unter der einzigen Bedingung, dass dieses auf alle Mitglieder der Gemeinschaft zutrifft. So wird der Wille aller auf den Souverän (der wie gesagt eine Person oder eine Versammlung sein kann) verei- nigt. Dieser Schritt, die freiwillige Selbstaufgabe der eigenen Person zur Sicherung des Lebens, ist zweifellos radikal. Die Frage ist, ob diese einmalige und nicht ohne weiteres revidierbare Übertra- gung der eigenen zuvor uneingeschränkten Rechte ausreicht, um den Souverän mit nahezu unbe- grenzten legalen Machtmitteln auszustatten, zumal man selbst ja in einer Abstimmung gar nicht für eben diesen Souverän gestimmt haben muss. Die Macht des Herrschers nach dem Vertragsschluss ist auf den ersten Blick jedenfalls absolut und stets rechtens, denn jede Tat des Souveräns ist durch den Vertrag stellvertretend für die Tat jedes Einzelnen und eine Person kann nicht sich selbst ankla- gen. Die unwiderrufliche Aussage ist, dass ein jeder, der den Willen bekundet hat, aus dem Natur- zustand auszutreten uns einen gemeinsamen Souverän zu wählen, fortan für alle Taten des neuen Herrschers mitverantwortlich ist. Eine Alternative zu diesem Freibrief besteht in Hobbes Theorie nicht. Um die Stabilität des Staates zu erhalten, hat der Herrscher nicht nur das Instrument der Ge- walt zur Unterdrückung der inner- und außerstaatlichen Gegner, er ist auch dazu bemächtigt, die Meinungen der Untertanen zu seinen Gunsten zu lenken, also direkt in die Bildung und Wissen- schaft einzugreifen. Die Grundaussage dieses 17. Kapitels ist also die Unteilbarkeit der Macht des Souveräns. Ganz explizit gibt Hobbes auch den Grund hierfür an: „Und wenn nicht in England die Meinung um sich gegriffen hätte, dass die oberste Gewalt geteilt werden müsse zwischen dem Kö- nig und dem Ober- und Unterhaus, so hätte es keine Spaltung des Volkes gegeben und folglich auch keinen Bürgerkrieg“ (S.144). Interessant ist aber, dass Hobbes seine Staatsform nicht als ideal dar- stellt wie es andere Theoretiker und Philosophen getan haben, er sagt nur, dass jede Willkür des Herrschers besser als der Naturzustand ist („Selbst die größte Not eines Volkes - in welchem Staat es auch sei - ist nicht zu vergleichen mit dem qualvollen und schmerzensreichen Dornenweg eines Bürgerkrieges oder mit dem unsicheren Zustand der Herrenlosigkeit“ (S.145)). Außerdem ist die Machtfülle des Herrschers bei genauerem Hinsehen zwar sehr groß aber eben nicht absolut. Zu- nächst sind alle Verträge nichtig, „die nicht des Menschen Leben sichern“ (S.170). Ein jeder hat also das Recht auf Widerstand, wenn sein eigenes Leben angegriffen ist, selbst wenn er legal zum Tode verurteilt worden ist. Eine jede Gehorsamsverweigerung ist also rechtens, solange sie sich nicht gegen das Ziel der Staatsgründung richtet. In diesem Zusammenhang geht Hobbes auf eine entscheidende Frage ein: Ist es rechtens, dass sich mehrere zusammenschließen, um sich gemein- sam gegen die Gewalt des Staates zu schützen ? Er beantwortet dieses positiv, solange ihr Leben n Gefahr ist, wird ihnen verziehen, so müssen sie ihren Widerstand logischerweise aufgeben. Hier liegt meiner Meinung nach eine Möglichkeit zu einem kollektiven Widerstand gegen den Herrscher, wenn der es nicht schafft, für Frieden und Lebenssicherung zu sorgen. Von daher ist Hobbes Aus- sage, der Herrscher selbst habe in dem Vertrag keine Pflichten zwar theoretisch richtig, trotzdem ist die Möglichkeit für die Untertanen gegeben, gemeinsam Druck auf den Souverän auszuüben, wenn dieser seine Aufgabe nicht erfüllt. Auch ist es möglich, gegen den Herrscher gerichtlich vorzuge- hen, wenn dieser sich in einem bestimmten Punkt nicht auf die Unterwerfung der Untertanen beruft sondern auf ein Gesetz. In diesem Fall kann der Untertan den Streitfall vor Gericht tragen, das dann auf der Grundlage dieses Gesetzes entscheidet. Beruft sich der Herrscher allerdings auf seine souve- räne Gewalt, ist dieser Schritt vor das Gericht nicht möglich. Nichtig wird der gesamte Vertrag au- ßerdem, wenn der Herrscher nicht mehr die Macht hat, seine Untertanen zu beschützen. „Das natür- liche Recht der Menschen, sich selbst zu verteidigen, wenn niemand anderes sie zu verteidigen vermag, kann durch keinen Vertrag aufgehoben werden. [...] Das Ziel allen Gehorsams ist der Schutz“ (S.173). Das Grundproblem bei jeder Form des Widerstandes, die auf der Gefahr für das eigenen Lebens beruht ist aber die Gegenüberstellung von Recht gegen Recht. Obwohl der Untertan Widerstand leisten kann, ohne den Vertrag zu verletzen, wenn er beispielsweise zum Tode verurteilt worden ist, ist eben dieses Urteil des Herrschers selbst dann rechtens, wenn der sich der Untertan nicht schuldig gemacht hat. Jegliche Kontrollinstanz für den Herrscher fehlt - absichtlich, denn eine solche wäre für Hobbes eine dem Souverän übergeordnete Instanz und somit zumindest eine Tei- lung der obersten Gewalt, genau das also, was er um jeden Preis verhindern möchte.
Stellt man nun die Frage, ob die sehr eindimensionale Verwendung des Wortes „Leviathan“ bei Klaus von Beyme dem Werk von Hobbes gerecht wird, muss man diese wahrscheinlich verneinen. Denn hier wird nicht in erster Linie die Struktur eines Staates beschrieben oder entworfen, dessen Führung nahezu unbegrenzte Macht über die Untertanen hat, vielmehr geht es Hobbes darum, überhaupt eine gesellschaftliches Überleben durch die Überwindung des Krieges möglich zu machen. Daher ist die Übertragung des gesamten Staatsmusters auf ein bereits bestehendes, friedliches System meiner Meinung nach kaum zulässig.
6. Resumée Das Problem bei den meisten aktuellen Auseinandersetzungen mit Hobbes ist der Ver- such, dessen Theorie auf eine heutige Gesellschaft zu übertragen. Für einen in einer Demokratie lebenden Menschen ist der Gedanke an einen Herrscher mit ungehemmter Machtfülle natürlich nicht geheuer. Trotzdem ist schon dieser Ansatz von Anfang an falsch, denn Hobbes geht eben von einer nicht existierenden Gesellschaft aus, dem Krieg aller gegen alle. Diesen Zustand gilt es zu überwinden, koste es praktisch, was es wolle. Der Frieden an sich ist für ihn in diesem Zustand ein höheres Gut als unsere Vorstellungen von Moral in Bezug auf die Machthabenden. Zudem sichert er sich sehr wohl gegen Herrscher ab, die offensichtlich ihre Macht missbrauchen, denn er schreibt „Denn wenn eine Regierung so schlecht ist, , dass man sich nicht scheut, die Waffen zu erheben, um eine Meinung zu verteidigen oder zu oktroyieren, dann befindet man sich noch immer im Zu- stand des Krieges“ (S.142). Die sehr wohl Theorie- immanenten Auswege aus dem Herrschaftsver- hältnis bei Nicht- Erfüllung der Aufgaben durch den Souverän in Bezug auf innere Friedensschaf- fung und Lebenssicherung, nehmen einem Großteil der Kritik an Hobbes den Wind aus den Segeln. Wenn man das Menschenbild von Hobbes als gegeben voraussetzt, ist eine fundierte Kritik an der darauf aufbauenden Theorie meiner Meinung nach sehr schwierig. Allerdings teile ich sein doch sehr negatives Menschenbilds nicht, denn wenn man sich beispielsweise Sigmund Freud ins Ge- dächtnis ruft, so ist der gesamte Über- Ich Teil jedes Menschen nicht nbegriffen. Zudem denke ich, dass das Motto „Was du nicht willst, das man dir tue, das füg´ auch keinem anderen zu“ in jedem Menschen als denkendem Wesen, das sehr wohl nur in der Gemeinschaft mit anderen überleben kann oder sich zumindest nur so die Vorherrschaft gegenüber den Tieren sichern konnte, fest ver- ankert ist.
Für Hobbes war sein „Leviathan“ „in gewissem Sinne Antwort auf eine konkrete Situation“ , dem Bürgerkrieg in England. Sein Werk ist also nicht nur als theoretisches System zu verstehen, sondern muss sich auch an der Wirkungsgeschichte in der Realität messen lassen. Doch gerade in England blieb diese Wirkung gering, angeführt von John Locke und James Harrington wurde starke Kritik geübt, dafür ist die politische Entwicklung der Staaten auf dem Kontinent ohne die Theorien von Hobbes, (dem ebenfalls oft zu einseitig interpretierten) Machiavelli und Bodin nur schwer nachzu- vollziehen. Zudem ist seine Theorie zumindest teilweise wohl doch auch in die heutige „zivilisierte“ Zeit zumindest in den Grundfesten übertragbar. In einem Land, das sich im Bürgerkrieg befindet oder gerade einen beendet hat, gilt es auch die umstrittensten Teile zunächst und die Herrschaft ei- ner allgemein anerkannten Organisation zu stellen, dessen Macht sich dann alle Konfliktpartner zu beugen haben.
Denkt man über das gesamte Theoriemodell von Hobbes nach, so muss man zu dem Entschluss kommen, dass auch ein Staat unter der Herrschaft des Leviathan mit all seinen negativen Aus- wuchsmöglichkeiten wohl für den Einzelnen besser ist als der von Hobbes am Anfang des Buches geschilderte Naturzustand des Krieges jeder gegen jeden - mehr wollte Thomas in seinem Werk gar nicht erreichen.
Literaturliste
Hobbes, Thomas Leviathan Leck / Schleswig 1965
Hobbes, Thomas Vom Menschen, vom Bürger Hamburg 1959
Leibholz, Gerhard Volk und Partei im neuen deutschen Verfassungsrecht Karlsruhe 1967
Maier, Hans Thomas Hobbes in: Klassiker des politischen Denkens I München 1968
Häufig gestellte Fragen zu Thomas Hobbes' "Leviathan"
Was ist das Hauptziel der Arbeit über Thomas Hobbes' "Leviathan"?
Das Ziel der Arbeit ist die Hinterfragung der These, dass Thomas Hobbes in erster Linie ein entschiedener Vertreter einer absoluten (monarchischen) Regierungsform war.
Welche historischen Ereignisse beeinflussten Hobbes' Werk "Leviathan"?
Der englische Bürgerkrieg und die politischen Umwälzungen seiner Zeit, insbesondere die Herrschaft der Stuarts und Oliver Cromwells, sowie die Erfolge der Mathematik, deren Methode er auf den sozialen und politischen Bereich übertragen wollte, beeinflussten Hobbes' Werk.
Wie beschreibt Hobbes das Menschenbild im "Leviathan"?
Hobbes reduziert den Menschen auf seinen Grundantrieb, die Furcht oder den Willen zur Selbsterhaltung. Im Naturzustand herrscht ein "Krieg aller gegen alle", in dem jeder Mensch für den anderen ein potentieller Feind ist.
Wie interpretiert Klaus von Beyme den Begriff "Leviathan" in seinem Buch "Die politische Klasse im Parteienstaat"?
Von Beyme verwendet den Begriff "Leviathan" im Zusammenhang mit dem Parteienstaat, um die große Machtfülle der Parteien in ihrer Gesamtheit und deren Einfluss in allen entscheidenden Bereichen der Gesellschaft zu kritisieren. Er sieht die Parteien als ein Kartell der Parteieliten, das Staat und Gesellschaft "kolonialisiert".
Was sind die Hauptkritikpunkte von von Beyme am Parteienstaat?
Von Beyme kritisiert die Überforderung der Parteien durch Ausweitung ihrer Funktionen und die Abgehobenheit des Parteienstaates von den Wählern und Parteimitgliedern. Er sieht eine Tendenz zur Überforderung der Parteien und eine verringerte Identifikation zwischen Parteimitgliedern und Partei sowie zwischen Wählern und Partei.
Welche Rechte haben die Untertanen im Staat des "Leviathan" laut Hobbes?
Trotz der scheinbar absoluten Macht des Herrschers haben die Untertanen das Recht auf Widerstand, wenn ihr eigenes Leben bedroht ist. Alle Verträge sind nichtig, "die nicht des Menschen Leben sichern". Auch ist es möglich, gerichtlich gegen den Herrscher vorzugehen, wenn dieser sich in einem bestimmten Punkt nicht auf die Unterwerfung der Untertanen beruft, sondern auf ein Gesetz.
Ist die Verwendung des Begriffs "Leviathan" durch Klaus von Beyme gerechtfertigt?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die sehr eindimensionale Verwendung des Wortes "Leviathan" bei Klaus von Beyme dem Werk von Hobbes nicht vollständig gerecht wird, da Hobbes' Hauptziel darin besteht, das gesellschaftliche Überleben durch die Überwindung des Krieges zu ermöglichen.
Was ist das Resümee der Arbeit in Bezug auf Hobbes' "Leviathan"?
Hobbes' Theorie ist als Antwort auf eine konkrete Situation, den Bürgerkrieg in England, zu verstehen. Seine Theorie zielt darauf ab, den Naturzustand des "Krieges jeder gegen jeden" zu überwinden, und der Frieden an sich ist für ihn in diesem Zustand ein höheres Gut als unsere Vorstellungen von Moral in Bezug auf die Machthabenden.
Welche Schlussfolgerung wird in Bezug auf die Übertragbarkeit von Hobbes' Theorie auf die heutige Zeit gezogen?
Hobbes' Theorie ist zumindest teilweise wohl doch auch in die heutige "zivilisierte" Zeit zumindest in den Grundfesten übertragbar. In einem Land, das sich im Bürgerkrieg befindet oder gerade einen beendet hat, gilt es auch die umstrittensten Teile zunächst und die Herrschaft einer allgemein anerkannten Organisation zu stellen, dessen Macht sich dann alle Konfliktpartner zu beugen haben.
- Quote paper
- Martin Hierl (Author), 2001, Leviathan - Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99011