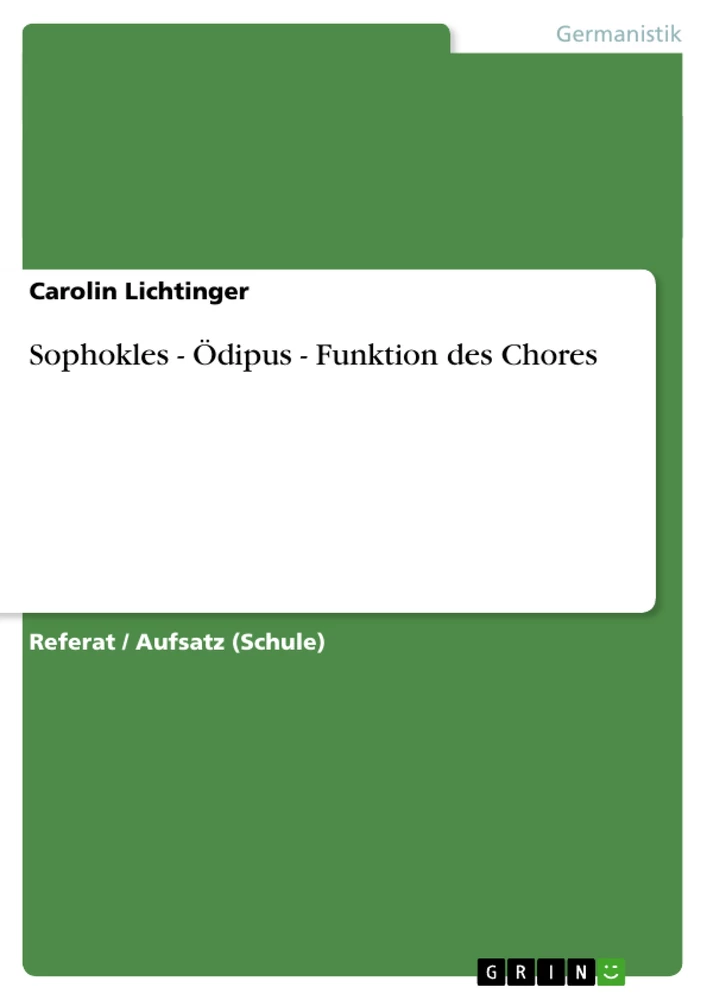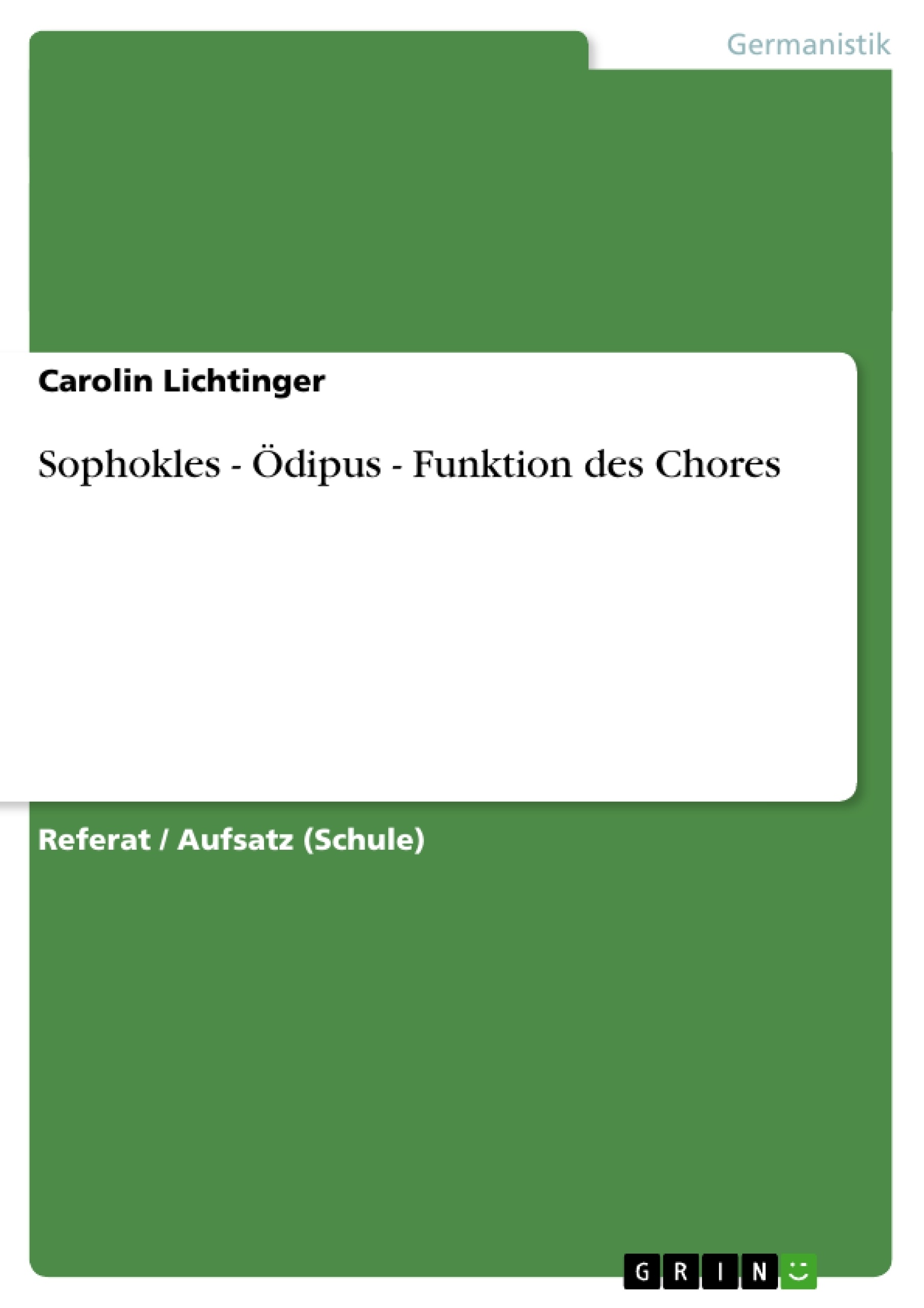Was bedeutet es, wenn das Schicksal unaufhaltsam zuschlägt und selbst der tugendhafteste Mensch zum Spielball der Götter wird? Sophokles' zeitlose Tragödie "König Ödipus" enthüllt in einer neuen Analyse die zentrale Rolle des Chores als Vermittler zwischen Bühne und Publikum. Diese Untersuchung beleuchtet, wie der Chor nicht nur die Handlung vorantreibt und kommentiert, sondern auch die tiefsten menschlichen Ängste, Hoffnungen und Zweifel verkörpert. Erleben Sie, wie die Standlieder den Fortgang der Geschichte strukturieren, Spannung erzeugen und die Zuschauer in einen Strudel von Emotionen ziehen. Von der düsteren Prophezeiung des Parodos bis zum verzweifelten Klagen des Kommos spiegelt der Chor die innere Zerrissenheit der Bewohner von Theben wider und konfrontiert uns mit der Frage nach freiem Willen versus göttlicher Vorbestimmung. Entdecken Sie, wie die Anbetung der Götter – Phoibos, Zeus, Moira – die Handlungsabschnitte verbindet und gleichzeitig die Ohnmacht des Einzelnen angesichts des Schicksals betont. Der Chor fungiert als Spiegel der menschlichen Seele, indem er zwischen Ehrfurcht und Ablehnung, Hoffnung und Verzweiflung schwankt. Seine Interaktionen mit Ödipus und anderen Charakteren verstärken die Tragik und lassen das Publikum die Ereignisse hautnah miterleben. Durch die Identifikation mit dem Chor werden wir Zeugen des unaufhaltsamen Unheils, das über Ödipus hereinbricht, und spüren die befreiende Katharsis, die Aristoteles als Ziel des Dramas beschreibt. Diese Analyse enthüllt, wie Sophokles den Chor einsetzt, um die Zuschauer emotional zu packen, sie mit existenziellen Fragen zu konfrontieren und sie letztendlich mit einem tiefen Verständnis der menschlichen Grunderfahrung zurückzulassen. Tauchen Sie ein in die Welt des antiken Dramas und erleben Sie die zeitlose Kraft des Chores in "König Ödipus". Diese neue Perspektive wird Ihr Verständnis für klassische Literatur und die menschliche Natur nachhaltig prägen. Erforschen Sie die Wechselwirkung von Chor, Schicksal und menschlicher Tragödie in diesem Meisterwerk der Weltliteratur. Die detaillierte Untersuchung der Rolle des Chores eröffnet neue Interpretationsansätze und lässt die Tragödie in einem neuen Licht erscheinen.
Untersuchung der Funktion des Chores
Das weltbekannte Stück ,,König Ödipus" von Sophokles ist ein Musterbeispiel für das antike Drama, auf das sich selbst solch große Autoren wie Aristoteles im Lauf der Geschichte immer wieder berufen. Im Folgenden soll nun im Besonderen die Rolle des Chores im Stück näher untersucht werden.
Zunächst einmal hat dieser für den Aufbau der Handlung eine wichtige Bedeutung. Hinsichtlich des Handlungverlaufs kennzeichnen sich die Standlieder des Chores dadurch, dass sie die einzelnen Epeisodien, die ja die eigentlichen Handlungsträger bilden, voneinander abtrennen, so dass das Geschehen in eine Art Rahmen eingebettet wird. Nach Abschluss eines Epeisodion folgt also jeweils der meist kurze Einsatz des Chores, der auf diese Weise den Fortgang der Handlung für eine Weile unterbricht und so dem Zuschauer eine Art ,,Verschnaufpause" bietet, welche jener zur Reflexion des bereits Geschehenen nutzen kann. Dabei fasst der Chor die Vorgänge im Stück zusammen, wie etwa das Rätselraten um den wahren Mörder des Laios im 1. Stasimon ( Z. 463 ff ) oder die Frage nach der wahren Herkunft des Ödipus im 3. Stasimon ( Z. 1098 ff ), schürt allerdings zugleich die weitere Entwicklung, indem er der Handlung sozusagen von außen Dynamik verleiht. Dies zeigt sich unter anderem an unheilvollen Vorahnungen ( z. B. 1. Kommos ) oder auch am mehrfachen Flehen um das Heil der Götter ( z. B. Parodos, Z. 158 ff ).
Jene Götteranbetung zieht sich als Teil der menschlichen Grunderfahrung wie ein roter Faden durch das Stück, da sie immer wieder vom Chor aufgegriffen wird, und schafft so inhaltliche Geschlossenheit. Sei es nun die Schicksalsgöttin Moira ( 2. Stasimon, Z. 863 ff ), der Gott Phoibos (u. a. Parodos, Z. 163 ) oder der Göttervater Zeus selbst ( u. a. 4. Stasimon, Z. 1198 ff ), das Flehen um Schutz und Beistand angesichts des drohenden Unheils sowohl der Stadt als auch Ödipus' selbst, angesichts der göttlichen Gegenwelt, verbindet sämtliche Handlungsabschnitte miteinander. Darüber hinaus erfolgt eine enge inhaltliche wie auch formale Verknüpfung natürlich durch den ständigen Bezug der Standlieder zum jeweils vorhergehenden Epeisodion, das ja vom Chor - wie bereits beim Verlauf erwähnt - zusammengefasst und kommentiert wird. Daher zeigt sich trotz der klaren Aufspaltung des Ablaufs in Handlungsstrang und Standlied große Geschlossenheit.
Diese Tatsache ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung für die Spannungsführung und Dynamik des Stückes, die beständig ansteigt und die der Chor in großem Maße mitträgt. Indem er nämlich als Schauspieler agiert, welcher kein Mehrwissen besitzt, sondern die schicksalsuntergebenen, leidenden, sich vielleicht irrenden Bewohner der Stadt sowie die ebenfalls unwissenden Zuschauer repräsentiert, stellt er sich mit eben jenen auf eine Ebene und ermöglicht es ihnen, sich mit ihm zu identifizieren. Dadurch wird das Publikum völlig mitgerissen, denn es erkennt sich einerseits selbst in eben jenen Leuten wieder und verliert sich so etwa in den dringlich angeflehten, göttlichen Gegenwelten zwischen Gut und Böse ( Parodos ), in der Suche nach dem Mörder ( 1. Stasimon ) oder im schließlich unaufhaltsamen Unheil ( 4. Stasimon ). So wird also mithilfe des Chores große, sich steigernde Spannung erzeugt.
Weiterhin liefert der Chor einen Beitrag für die Konfrontation des Zuschauers mit der im Stück vermittelten menschlichen Grunderfahrung, welche entscheidend vom göttlichen Schicksal geprägt ist. So wird im Handlungsverlauf immer mehr der Glaube deutlich, dass der Mensch seinem gottgewollten Schicksal nicht entkommen kann, so sehr er es auch zu versuchen vermag. Es ist eher ganz im Gegenteil so, dass er sich um so mehr in die übermächtige Vorhersehung verstrickt, je mehr er ihr auszuweichen versucht, so dass der ahnungs- und schuldlose Mensch schließlich zum Spielball der Götter wird, welche sein Leben bestimmen.
Das Gefühl, dass es im Zusammenhang mit den Göttern um Großes gehen wird, vermittelt der Chor dem Zuschauer bereits bei seinem ersten Auftreten im Parodos: Indem er aus einer dunklen Unheilsahnung heraus zunächst die dem Menschen wohlgewogene Götterwelt anruft ( Z. 149 ff ), der notleidenden Stadt und ihrem Herrscher beizustehen, versetzt er den Betrachter in eine Sphäre gehobener Gefühle und Religiosität und stellt die wichtige, ja übermächtige Rolle der Verhältnisse dar, die im Bereich des Heiligen liegen. Dabei ist das Verhalten des Menschen von ,,Angst" ( Z. 153), ,,Ehrfurcht" ( Z. 155 ) und ,,Hoffnung" ( Z. 158 ) geprägt, was tiefstes Empfinden ausdrücken soll. Auf der anderen Seite wird aber am Ende eine böse, göttliche Gegenwelt aufgebaut ( Z. 190 ff ), wodurch der Mensch bereits in dieses schicksalhafte Zusammenspiel eingebettet wird. Dabei betont der Chor auch immer wieder die schlimme Lage, in der sich die Stadt befindet, und verstärkt somit die innere Spannung des Zuschauers sowie sein Mitgefühl gegenüber den notleidenden Untertanen. Schließlich wird jener durch die Nennung des Stadt- und Jubelgottes Bakchos ( Z. 211 ff ) auch auf den lustvollen Aspekt des Miterlebens hingewiesen, so dass ihm mithilfe der Götter sämtliche Daseinserfahrungen nähergebracht werden.
Im 1. Standlied rätselt der Chor daraufhin, wer denn nun der wahre Mörder des Laios sei ( Z. 463 ff ), nachdem ja Ödipus selbst vom Seher Theiresias als eben solcher angesehen worden ist, und führt noch einmal die für ihn angedrohte Strafe der Verbannung auf. Diesen Vorwurf des Sehers lehnt der Chor jedoch weitgehend ab, wobei er allerdings seine Unwissenheit hinsichtlich des Geschehens betont und sich auf sachliche Gerechtigkeit beruft ( Z. 483 ff ): Der König sei unschuldig, so lange nicht ein Beweis eines frevelhaften Tuns erbracht sei. Als eine Art Begründung hierfür rekapituliert er die große Heldentat des damals jungen Ödipus, die Stadt durch das Lösen eines Rätsels von der grausamen Sphinx befreit zu haben, und sieht ihn aus seiner Erfahrung heraus als erhabenen, völlig schuldlosen Herrscher an ( Z. 504 ff ). Dabei zeigt sich der Chor innerlich stark aufgewühlt hinsichtlich des dramatischen Stroms der Ereignisse und erkennt unter tiefster Betroffenheit ( Z. 483 ff ) erneut den schicksalhaften Einfluss der Göttlichkeit, in diesem Fall Zeus' und Apollons, die im Gegensatz zu ihm selbst die Wahrheit kennen. Damit wird dem Zuschauer wieder die göttliche Allmächtigkeit verdeutlicht, die im krassen Kontrast zur Rolle des Chores stehen: Es wird nun unfehlbar klar, dass er selbst kein Mehrwissen besitzt und stattdessen die Bewohner der Stadt verkörpert, deren Not und Zweifel vorträgt, welche wiederum hinsichtlich der fortschreitenden Enthüllung der Zusammenhänge nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Er tappt also genauso wie das Publikum im dunkeln über den tatsächlichen Hergang der Ereignisse, was jenem die Identifikation erst möglich macht. Darüber hinaus drängt sich durch die Aufgewühltheit, die der Chor vermittelt, die Ahnung auf, dass die Wahrheit, die die übermächtige Göttlichkeit verheißt, unheilvoll ist.
Die bereits erwähnte Schauspielerfunktion des Chores wird besonders bei seinem nächsten Auftreten deutlich, da er beim Wechselgesang, dem 1. Kommos, im direkten Dialog zum Herrscherpaar sowie Kreon steht. Hierbei fleht der Chor Ödipus an, er solle sich doch besinnen und durch die unbewiesene Anklage seines Schwagers Kreon sein eigenes Leid sowie das der Stadt nicht noch weiter vertiefen ( Z. 649 ff ). Auch Iokaste bittet er, das Schlimmste zu verhindern ( Z. 678 f ). Er strebt also Harmonie zwischen den beiden an, da er ahnt, welch unheilvolle Folgen der vielleicht unberechtigte Bruch für den weiteren Verlauf der Ereignisse haben könnte. Am Ende betont der Chor die erhabene Stellung des Retters Ödipus, dankt ihm noch einmal für seine damalige Hilfe und fleht ihn an, vernünftig und weitblickend zu sein, um auch weiterhin recht zu herrschen ( Z. 689 ff ). An dieser Stelle wird also das herannahende Unheil durch den Chor plötzlich greifbar gemacht, der Zuschauer erfasst durch dessen unablässiges Bitten und Flehen endgültig den Ernst der Lage und beginnt an diesem Wendepunkt des Geschehens langsam, Ödipus, welcher sich aus seiner Ahnungslosigkeit heraus durch diese Anklage Kreons zum ersten Mal handelnd in sein Verderben verstrickt, als einen bemitleidenswerten Spielball des Schicksals, das heißt der Götter, anzusehen. Angesichts dieses düsteren Vorgefühls durchlebt das Publikum einen bewegenden Zustand von Angst, aber auch mitleidsvoller Ohnmacht, nicht eingreifen zu können.
Im darauffolgenden 2. Standlied hofft der Chor zunächst auf die Wohlgesonnenheit der Schicksalsgöttin Moira und verweist in diesem Zusammenhang auf seine treue ,,Lauterkeit" ( Z. 864 ff ), die die Voraussetzung für ihren schützenden Beistand gegenüber Stadt und Herrscher bilden soll. Das Erwähnen der ,,sterblichen Natur von Menschen", von den Göttern ,,gezeugt" ( Z. 869 ff ), stellt zwar noch einmal deren Unterlegenheit gegenüber schicksalhafter Göttlichkeit dar, doch versucht der Chor diese Unterlegenheit zu relativieren, da er ja das Verhalten des Menschen als Voraussetzung für die Gewährung bzw. auch die Ablehnung des göttlichen Beistands darstellt. Die Leidenschaft seiner Worte gipfelt schließlich in einer Art Drohung, sich vom Heiligen abzukehren, wenn sich nicht alles zum Guten wenden würde ( Z. 898 ff ), und einem sofortigen Umschwung, der sich dennoch anschließenden direkten Anbetung des Göttervaters Zeus. Jedoch erkennt er am Ende, dass auch die treueste Selbstaufopferung vergebens scheint und ,,das Göttliche schwindet" ( Z. 910 ), ein Zeichen für das unaufhaltsame Unheil. Dieses wechselhafte Verhalten drückt die starke emotionale Belastung des Chores in dieser Situation aus, die sich natürlich auch auf das sich wiedererkennende Publikum überträgt. Die bisher vorherrschende Ahnung, die leise Angst schlägt in in leidenschaftlichen Schrecken und Verzweiflung gegenüber dem Schicksal dieser schuldlosen Menschen um und erweckt zugleich sowohl Respekt als auch Ablehnung gegenüber den lebensbestimmenden Gottheiten, was eine wichtige Voraussetzung für das Miterleben der fortschreitenden Handlung darstellt.
Verschiedene Möglichkeiten die Abstammung Ödipus' betreffend werden weiterhin im 3. Standlied durchgespielt, wobei der Chor verschiedene Gottheiten ( u. a. auch Bakchos ) in Erwägung zieht ( Z. 1098 ff ). Durch dieses Rätselraten wird im Zuschauer nach der sich der Gewissheit nähernden Botenszene in gewisser Hinsicht ein letzter Funken Hoffnung geweckt, dass sich das Schicksal trotzallem vielleicht doch noch zum Guten wenden könne. Es wird also hierbei ein letzter Zweifel an der vermittelten, menschlichen Grunderfahrung der unabwendbaren Schicksalhaftigkeit ermöglicht. Zugleich ruft der Chor zum letzten Mal eine Gottheit um Beistand an ( Phoibos, Z. 1086 ff ), was dem Gefühl der Hoffnung einen gewissen dramatischen Aspekt hinzufügt, die dem Zuschauer höchste Spannung liefert. Sowohl im 4. Standlied als auch schließlich im Dialog zwischen Chor und Ödipus im Kommos ist die unheilvolle Ahnung längst zur Gewissheit geworden und dem Chor bleibt nurmehr verzweifeltes Klagen, um seinen Gefühlen Luft zu machen. So fasst er zunächst das sozusagen zweischneidige Leben Ödipus' in kurzen Worten zusammen, ohne die Gelegenheit zu verpassen, erneut auf dessen große Leistung und Rettungstat für sein Volk hinzuweisen ( Z. 1197 ff) und somit das Mitgefühl des Zuschauers für diesen armen, vom Schicksal grundlos gebeutelten Mann zu erwecken ( u. a. Z. 1297 ff ). Zugleich betrauert der Chor die gesamte Menschheit, die dieser grausamen Vorhersehung ja ebenfalls gleichsam ausgesetzt ist und sich nicht dagegen wehren kann ( Z. 1186 ff). Sein grenzenloses, mitleidvolles Jammern steigert sich immer weiter, so dass er sich aus lauter Leid trotz der hochgepriesenen Retterrolle seines Herrschers schließlich sogar wünscht, diesen nie gesehen und sein grausames Los so nicht miterlebt zu haben ( u. a. Z. 1216 ff ). Obwohl er Ödipus klagend nicht mehr ansieht, stellt er zum Beispiel auch dessen grausame Selbstverurteilung zur Blindheit mitfühlend in Frage ( Z. 1326 ff ), erkennt jedoch dann dessen Beweggründe an, wobei er allerdings bezweifelt, ob ihm der Tod nicht noch einen größeren Dienst erweisen würde ( Z. 1387 ff ). Dem im höchsten Maße mitleidenden Zuschauer wird dadurch also nun doch ganz klar vor Augen geführt, dass das gottgewollte Schicksal nun einmal unausweichlich ist und sich der ahnungs- und schuldlose Mensch im Gegenteil immer weiter darin verstrickt, je mehr er dem auszuweichen versucht. Somit wird die bisher nur erahnte menschliche Grunderfahrung, die das Stück vermitteln soll, absolut bestätigt.
Dies geschieht allerdings nicht durch den Versuch, den Beobachter moralisch zu belehren, sondern eben darin, ihn in einer Form der Aufgipfelung von Lebenskräften ,,durch die Elementareffekte hindurchzujagen" ( Zitat Schadewaldt ). Das bedeutet, dass er völlig mitgerissen werden und im Laufe des Stücks sämtliche tiefe Emotionen empfinden soll, um das Theater am Ende mit einem Wohlgefühl befreiender Erleichterung zu verlassen. Das entspricht ja auch der Vorstellung Aristoteles' von einem guten Drama, hierbei allerdings unter dem Aspekt der Reinigung des Zuschauers.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Chor in Sophokles' "König Ödipus"?
Der Chor spielt in "König Ödipus" eine vielfältige Rolle. Er strukturiert die Handlung, indem seine Standlieder die Epeisodien voneinander trennen und den Zuschauern Reflexionspausen bieten. Er fasst die Handlung zusammen, kommentiert sie und treibt sie durch Vorahnungen und Gebete an. Der Chor schafft inhaltliche Geschlossenheit durch die ständige Anbetung der Götter und die Bezugnahme auf vorhergehende Epeisodien.
Wie trägt der Chor zur Spannungsführung und Dynamik des Stücks bei?
Der Chor repräsentiert die unwissenden Bewohner der Stadt und ermöglicht dem Publikum, sich mit ihm zu identifizieren. Dadurch wird die Spannung gesteigert, da die Zuschauer die Ereignisse aus der Perspektive derer erleben, die ebenfalls im Dunkeln tappen. Die Aufgewühltheit des Chores und seine unheilvollen Vorahnungen tragen maßgeblich zur Dynamik des Stücks bei.
Wie vermittelt der Chor die menschliche Grunderfahrung des Stücks?
Der Chor vermittelt die Überzeugung, dass der Mensch seinem Schicksal nicht entkommen kann, sondern sich umso mehr darin verstrickt, je mehr er ihm auszuweichen versucht. Durch seine Darstellung von Angst, Ehrfurcht und Hoffnung angesichts der göttlichen Macht verdeutlicht der Chor die Ohnmacht des Menschen gegenüber dem Schicksal.
Welche Rolle spielen die Götter in der Darstellung des Chores?
Die Götter werden vom Chor als übermächtige Kräfte dargestellt, die das Schicksal der Menschen bestimmen. Der Chor fleht sie um Schutz und Beistand an, betont aber auch die Möglichkeit, sich vom Heiligen abzuwenden, wenn sich das Schicksal nicht zum Guten wendet. Dieses wechselhafte Verhalten drückt die emotionale Belastung des Chores und des Publikums aus.
Wie beeinflusst der Chor die emotionale Reaktion des Zuschauers?
Der Chor ruft beim Zuschauer eine Vielzahl von Emotionen hervor, darunter Angst, Ehrfurcht, Hoffnung, Verzweiflung, Mitleid und Schrecken. Durch die Identifikation mit dem Chor erlebt der Zuschauer die Grunderfahrung der Schicksalhaftigkeit in höchstem Maße mit. Dies führt zu einer kathartischen Wirkung, bei der der Zuschauer am Ende des Stücks eine befreiende Erleichterung empfindet.
Wie unterstützt der Chor die Katharsis des Zuschauers nach Aristoteles?
Der Chor dient dazu, beim Publikum intensive Emotionen wie Angst, Mitleid und Schrecken hervorzurufen. Indem er die schicksalhaften Ereignisse und die Verzweiflung der Charaktere widerspiegelt, hilft der Chor den Zuschauern, ihre eigenen Emotionen zu verarbeiten und eine Art Reinigung (Katharsis) zu erfahren. Dieser Prozess führt zu einer befreienden Wirkung, die den Zuschauer emotional erneuert zurücklässt.
- Quote paper
- Carolin Lichtinger (Author), 2000, Sophokles - Ödipus - Funktion des Chores, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98974