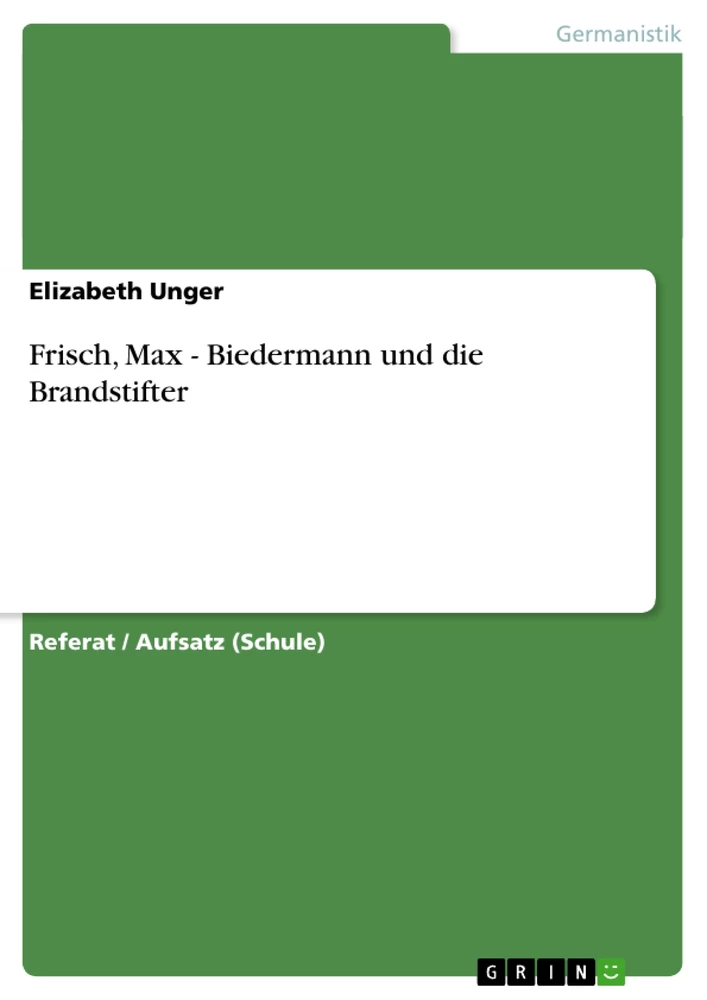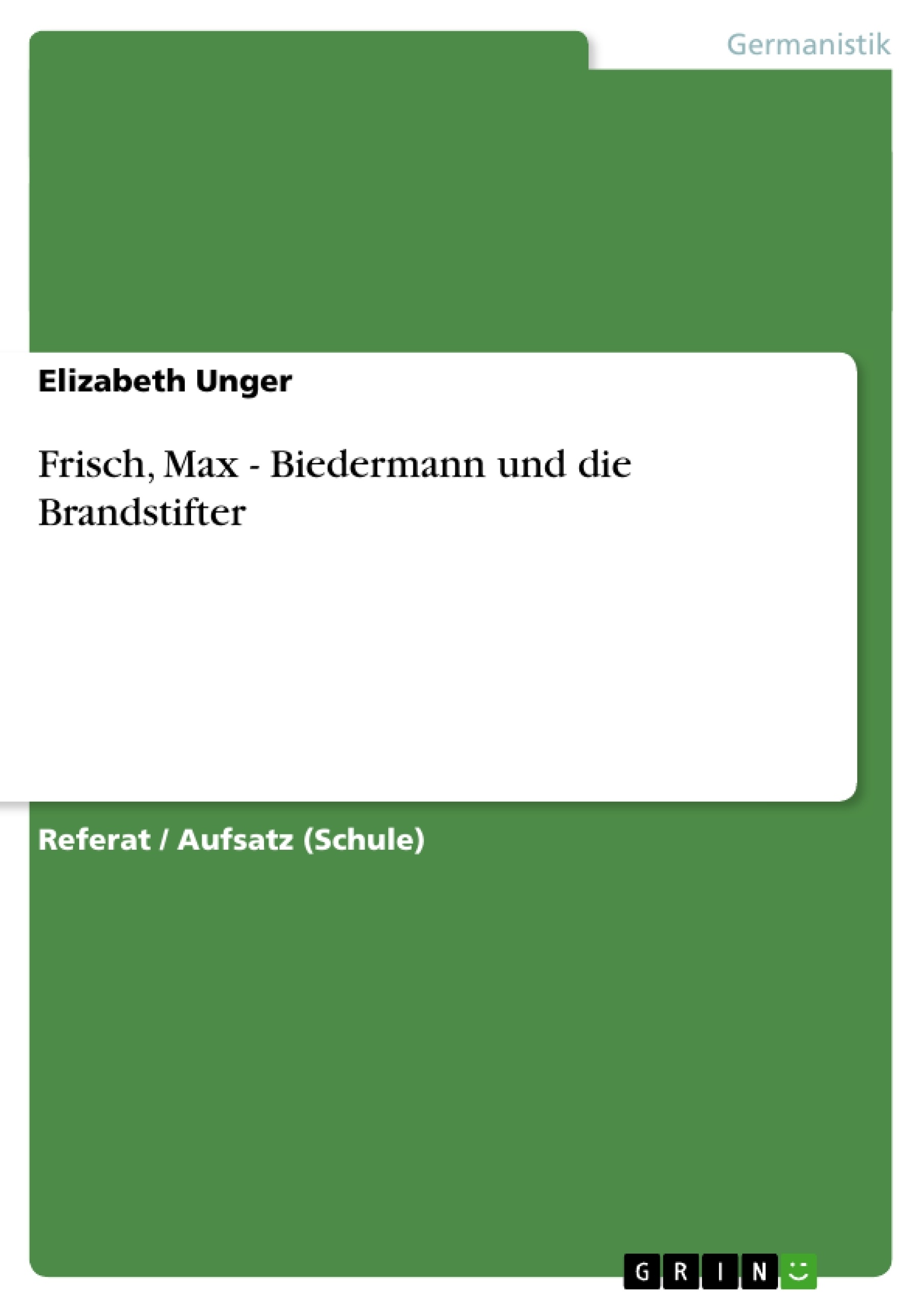Eine gespenstische Ruhe senkt sich über die Stadt, während die Angst vor Brandstiftung um sich greift. Inmitten dieser beunruhigenden Atmosphäre versucht Gottlieb Biedermann, ein wohlhabender Fabrikant, krampfhaft, die Fassade des Gutmenschen aufrechtzuerhalten. Doch als zwei dubiose Gestalten, der ehemalige Ringer Schmitz und sein undurchsichtiger Kompagnon Eisenring, an seine Tür klopfen und um Obdach bitten, gerät Biedermann in einen Strudel aus Selbsttäuschung und Feigheit. Getrieben von der panischen Angst, selbst zum Opfer zu werden, gewährt er den Fremden widerwillig Einlass in sein Haus und somit in sein Leben. Was als vermeintliche Geste der Nächstenliebe beginnt, entwickelt sich zu einem grotesken Spiel, in dem Biedermann die offensichtlichen Warnzeichen ignoriert und sich in ein Netz aus Lügen und Beschwichtigungen verstrickt. Max Frischs bitterböse Parabel "Biedermann und die Brandstifter" entlarvt auf meisterhafte Weise die Mechanismen der Verdrängung, die Gefahren blinden Vertrauens und die erschreckende Bereitschaft des Bürgertums, vor der Realität des Bösen die Augen zu verschließen. Das Theaterstück, eine erschreckend zeitlose Analyse menschlicher Schwächen und gesellschaftlicher Verblendung, konfrontiert den Leser mit unbequemen Fragen nach Verantwortung, Zivilcourage und der Fragilität der eigenen moralischen Grundfesten. Eine satirische Komödie, die tief unter die Haut geht und lange nach dem Zuklappen des Buches zum Nachdenken anregt, insbesondere über die Anfänge von Unheil und die verhängnisvollen Folgen von Wegsehen. Ein Muss für alle, die sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Natur und den Abgründen der Gesellschaft auseinandersetzen wollen. Frischs Werk ist ein Spiegel, der uns unerbittlich unsere eigenen Schwächen vor Augen führt, eine Mahnung zur Wachsamkeit und ein Aufruf zum Handeln in einer Welt, die von Unsicherheit und Bedrohung geprägt ist. "Biedermann und die Brandstifter" ist mehr als nur ein Theaterstück; es ist ein erschütterndes Lehrstück über die menschliche Natur und die Verantwortung jedes Einzelnen in einer Gesellschaft, die sich allzu oft in Bequemlichkeit und Ignoranz einigelt.
MAX FRISCH
Autorin: Elizabeth Unger
Max Frisch wurde am 15. 5. 1911 als Sohn eines Architekten in Zürich geboren. Ursprünglich studierte er Germanistik, wurde aber dann Architekt. Nach einer Studienreise nach Amerika und Mexiko 1951/52 wandelte er sich zum freien Schriftsteller. Er unternahm auch viele andere Reisen, auch in die ehemaligen östlichen Diktaturländer.
Thornton Wilder und Bert Brecht waren seine offenbaren Vorbilder, wobei die bedeutendste Lebensbegegnung das Zusammentreffen mit dem Letzteren in Zürich war. In Anerkennung der literarischen Leistung und seines Strebens nach einer menschenwürdigen Welt wurde Frisch 1976 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.
Frisch setzte sich mit humanen und sozialen Problemen der Gesellschaft auseinander. Er war ein kritisch beobachtender und teilnehmender Autor. Er lebte bis 1991 in seiner Vaterstadt Zürich.
Seine Werke:
Der literarische Durchbruch gelang Max Frisch 1945 mit dem Erzählband „Bin oder die Reise nach Peking" und dem Hör- und Schauspiel „Nun singen sie wieder" (1946), das die Schrecken des Krieges oratoriumshaft gestaltet. Aus der Fülle seiner Werke, die häufig um die Frage der Identität und der Schuld des Menschen kreisen, die private Existenz des einzelnen betont und gleichzeitig die Scheinhaftigkeit der bürgerlichen Umwelt durchleuchten, erlangten einige große Beachtung. Etwa die Romane „Stiller" (1954), „Homo faber" (1957) und „Mein Name sei Gantenbein" (1964), in denen Ablehnung und Annahme des eigenen ICH Zentralthemen sind. Ferner die Dramen „Biedermann und die Brandstifter" (1958), „Biographie" (1967) und „Andorra" (1961), in welchen er das Thema des Vorurteils exemplifiziert. In den letzten Jahren veröffentlichte Frisch zahlreiche autobiographische Arbeiten, oft in Form von Tagebüchern. Diesen Charakter haben auch die Erzählungen „Montauk" (1975),
„Der Mensch arbeitet im Holozän" (1979) und „Blaubart" (1982).
Seine Werke liegen in zahlreichen Ausgaben vor, die auch weniger bekannten Texte enthalten, z. B.:
„Die Chinesische Mauer" (1947),
„Graf Öderland" (1951),
„Don Juan oder die Liebe zur Geometrie" (1953), etc. 1978 erschienen
„Drei szenische Bilder".
BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER
Zeit und Ort:
Das Stück spielt hauptsächlich in Biedermanns Haus, aber auch auf der Straße und in der „Hölle". „Biedermann und die Brandstifter" spielt wahrscheinlich um 1958 (das ist das Jahr, indem das Buch geschrieben wurde).
Wichtige Personen:
Herr Biedermann: Er bezeichnet sich selbst als sehr gutherzigen Menschen, aber ob das wirklich der Fall ist, ist zu bezweifeln. Er versucht sich stets zu rechtfertigen, z. B. nach Knechtlings Selbstmord. Biedermann wird zum Opfer dem beiden Brandstifter. Obwohl er die Katastrophe kommen sieht, hofft er auf ein gutes Ende.
Babette: Sie ist Biedermanns Frau. Sie hält viel auf ihren Mann und meint ebenfalls, dass er ein anständiger guter Bürger sei. Ihr fehlt Durchsetzungskraft.
Anna: Sie ist das Dienstmädchen.
Schmitz: Er gibt an ein Ringer gewesen zu sein. Er bittet Biedermann um Obdach und erhält dieses sogar, obwohl Biedermann sehr misstrauisch ist, weil Brandstifter die umliegenden Dörfer heimsuchen. Doch Schmitz ist clever und gerissen.
Eisenring: Er ist der Kollege von Schmitz. Genau wie dieser ist er sehr selbstsicher und hinterhältig.
Ein Dr. phil.: Auch ist ein Brandstifter, obwohl er keine Freude daran findet. Allerdings bleibt er immer im Dachboden versteckt, während die anderen zwei auch öfters hinuntergehen und mit den Biedermanns plaudern.
Knechtling: Er ist ein ehemaliger Angestellter von Biedermann, der sich nach seiner Entlassung aus Verzweiflung selbst umbringt.
Witwe Knechtling: Sie ist seine hinterbliebene Frau.
Inhalt:
1.Szene:
In der Stadt, in der Gottlieb Biedermann mit seiner Frau Babette und dem Dienstmädchen Anna lebt, werden seit einiger Zeit Brandstiftungen verübt. Sie laufen alle, wie Biedermann aus den Zeitungen weiß, nach dem gleichen Schema ab. Ein scheinbar harmloser Hausierer nistet sich, zuvor auf den Dachböden ein, dessen Häuser den Flammen zum Opfer fallen. Der Fabrikant Biedermann hat selbst panische Angst davor, ein Opfer der Brandstifter zu werden. ER vertritt daher einen sehr harte Position gegenüber den Brandstiftern und verweigert allen Fremden den Zutritt zu seinem Haus. Als Biedermann jedoch versucht den Ringer Josef Schmitz abzuwimmeln, schafft es dieser auf äußerst geschickte Art und Wiese von Biedermann eine Mahlzeit und Obdach zu erbitten. Als plötzlich Biedermanns Frau Babette nach Hause kommt versteckt er Schmitz auf dem Dachboden und bittet ihn sich für die Nacht ruhig zu verhalten, da seine Frau einen leichten Schlaf und aufgrund der Brandstiftungen große Angst vor Fremden habe. Außerdem hätte sie Probleme mit dem Herzen.
2. Szene:
Am nächsten Morgen verlässt Biedermann schon früh das Haus, weil er geschäftliches mit Herrn Knechtling zu erledigen hat. Knechtling ist ein entlassener Angestellt von Biedermann und fordert eine Gewinnbeteiligung an dem Haarwasser, seiner eigenen Erfindung. Babette soll Schmitz hinauswerfen, allerdings schafft auch sie es nicht, weil er sie an ihre Sentimentalität erinnert und ihm wird der Dachboden als Asyl gewährt. Am selben Tag noch kommt ein Freund von Schmitz, der ehemalige Kellner Willi Eisenring, der ebenfalls in den Dachboden zieht.
3. Szene:
Herr Biedermann bemerkt, wie beide Benzinfässer auf dem Estrich stapeln. Er tobt zunächst deswegen auch, lässt sich jedoch durch die rückhaltlose Offenheit der beiden überrumpeln. Er redet sich selbst wider ein besseres Wissen ein, niemand würde eine derartige Wahrheit wirklich aussprechen. Ein Polizist kommt hinzu und meldet den Selbstmord Knechtlings. Biedermann bekommt ein schlechtes Gewissen und äußert deswegen seine Vermutungen über Schmitz und Eisenring nicht. Er erzählt dem Polizisten, dass die Benzinfässer voller Haarwasser seien. Biedermann wird auf der Straße vom Chor, der die Feuerwehr sein soll, gewarnt, doch Biedermann ist stur und geht einfach weiter.
4. Szene:
Während Schmitz und Willi auf dem Boden weiter ihre Vorbereitungen zum Brandstiften treffen, überdeckt Biedermann seine blanke, aber durchaus gerechtfertigte Angst mit wortreicher Zuversicht und den Sprüchen von Ruhe und Frieden sowie vom Vertrauen in die Menschheit. Als letztes Hilfsmittel fällt ihm nur noch ein, den Verbrechern seine Freundschaft anzubieten und lädt sie zum Abendessen ein. Er will sich mit ihnen duzen.
5. Szene:
Die Vorbereitungen für das Abendessen werden getroffen. Biedermann hat panische Angst irgend etwas falsch zu machen. Der kleinste Fehler kann ihm sein Haus kosten. Zur selben Zeit bemerken die zwei Brandstifter, dass sie keine Streichhölzer besitzen. Sie wollen Biedermann um welche bitten.
6. Szene:
Beim Abendessen wird viel Wein getrunken und viel gelacht. Schmitz und Eisenring berichten vom Brandstiften und Biedermann lacht herzlich darüber. „Echte Brandstifter" würden ja nie darüber reden. Kurz bevor die zwei Gauner sich für die Nacht verabschieden, bitten sie Biedermann um die Streichhölzer, als ein Zeichen seines Vertrauens. Biedermann gibt ihnen wirklich welche, weil er glaubt, wenn sie Brandstifter wären, hätten sie sie selbst. Er kommt gemeinsam mit seiner Frau in den Flammen des Feuers um, das Schmitz und Willi noch in derselben Nacht legen. Zuvor tritt noch ein Intellektueller als dritter Verbündete auf, der feststellt, dass die zwei das Brandstiften aus purer Lust machen.
Nachspiel >zu Biedermann und die Brandstifter<
Babette ,Biedermann und Anna finden sich in der Hölle wieder. Sie fühlen sich ungerecht behandelt und haben nichts dazugelernt. Sie wollen zurück auf die Erde. Sie müssen auf den Teufel warten, der gerade bei einer Besprechung im Himmel ist. Der Teufel erscheint und es stellt sich heraus, dass er Willi ist. Schmitz ist Beelzebub mit Pferdefuß, Bocksschwanz und Hörnern. Willi lässt die Feuerwehr rufen und befiehlt ihnen die Hölle zu löschen. Die Verhandlungen im Himmel haben nämlich ergeben, dass keiner mehr in die Hölle kommen soll, sondern nur mehr in den Himmel. Die Feuerwehr bzw. der Chor beginnt zu löschen. In der Zwischenzeit kehren Willi und Schmitz auf die Erde zurück, um wieder an die Arbeit zu gehen. Biedermann und seine Frau sind gerettet.
Fabel:
Das Stück erzählt die Geschichte eines ganz normalen Bürgers, der sich aus Angst Brandstiftern ausliefert, die es darauf anlegen, seine Welt zu zerstören.
Form und Sprache:
Die satirische Komödie ist hauptsächlich in Prosa verfasst. Am Ende jeder Szene tritt der Chor der Feuerwehrmänner tragikomisch auf, um das Geschehen zu kommentieren. Bereits zu Beginn des Stückes wird dem Publikum bzw. dem Leser vom Chor erklärt, dass es nicht Biedermanns Schicksal ist, sondern sinnloser und gefährlicher Blödsinn ist, was Biedermann zu erleiden hat. Die Texte des Chors wurde in Versen verfasst, allerdings gibt es keinen Reim.
Deutung:
Häufig gestellte Fragen zu MAX FRISCH: Biedermann und die Brandstifter
Wer ist Max Frisch?
Max Frisch war ein Schweizer Architekt und Schriftsteller, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich. Er setzte sich in seinen Werken mit humanen und sozialen Problemen der Gesellschaft auseinander.
Welche bedeutenden Werke hat Max Frisch geschrieben?
Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane "Stiller", "Homo faber" und "Mein Name sei Gantenbein", sowie die Dramen "Biedermann und die Brandstifter", "Andorra" und "Biographie".
Worum geht es in "Biedermann und die Brandstifter"?
"Biedermann und die Brandstifter" ist eine Parabel, die das allmähliche Eindringen der Anarchie in das Bürgertum thematisiert. Es geht um das Versagen von feigem und um Anpassung bemühtem Denken gegenüber der Realität des Bösen. Gottlieb Biedermann liefert sich aus Angst Brandstiftern aus, die es darauf anlegen, seine Welt zu zerstören.
Wo und wann spielt "Biedermann und die Brandstifter"?
Das Stück spielt hauptsächlich in Biedermanns Haus, aber auch auf der Straße und in der "Hölle". Die Handlung spielt wahrscheinlich um 1958, dem Jahr, in dem das Buch geschrieben wurde.
Wer sind die Hauptfiguren in "Biedermann und die Brandstifter"?
Die Hauptfiguren sind Herr Biedermann, Babette (seine Frau), Schmitz (ein Ringer und Brandstifter), Eisenring (Schmitz' Kollege und Brandstifter), ein Dr. phil. (ebenfalls ein Brandstifter), Knechtling (ein ehemaliger Angestellter Biedermanns) und Anna (das Dienstmädchen).
Was ist die Fabel des Stücks?
Die Fabel des Stücks ist die Geschichte eines normalen Bürgers, der sich aus Angst Brandstiftern ausliefert, die seine Welt zerstören wollen.
Welche Form und Sprache verwendet Max Frisch in "Biedermann und die Brandstifter"?
Die satirische Komödie ist hauptsächlich in Prosa verfasst. Der Chor der Feuerwehrmänner kommentiert am Ende jeder Szene das Geschehen tragikomisch in Versen.
Was ist die Deutung von "Biedermann und die Brandstifter"?
Max Frisch zeigt das Versagen des Bürgertums gegenüber der Anarchie und dem Bösen. Die Geschichte kann als Analogie zu Hitlers Aufstieg interpretiert werden, wobei die Brandstifter für Hitler und das Deutsche Volk stehen.
Was geschieht im Nachspiel von "Biedermann und die Brandstifter"?
Im Nachspiel finden sich Biedermann, Babette und Anna in der Hölle wieder. Der Teufel stellt sich als Willi Eisenring heraus, und Schmitz ist Beelzebub. Die Feuerwehr wird gerufen, um die Hölle zu löschen, da niemand mehr in die Hölle kommen soll, sondern nur noch in den Himmel. Biedermann und seine Frau werden gerettet.
- Quote paper
- Elizabeth Unger (Author), 2000, Frisch, Max - Biedermann und die Brandstifter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98973