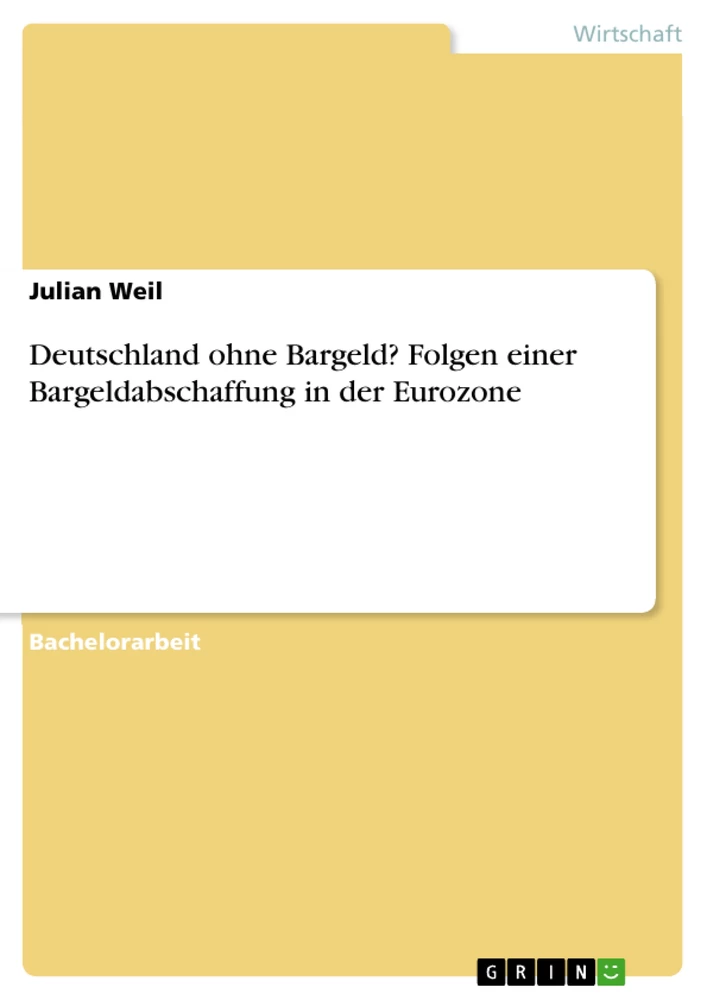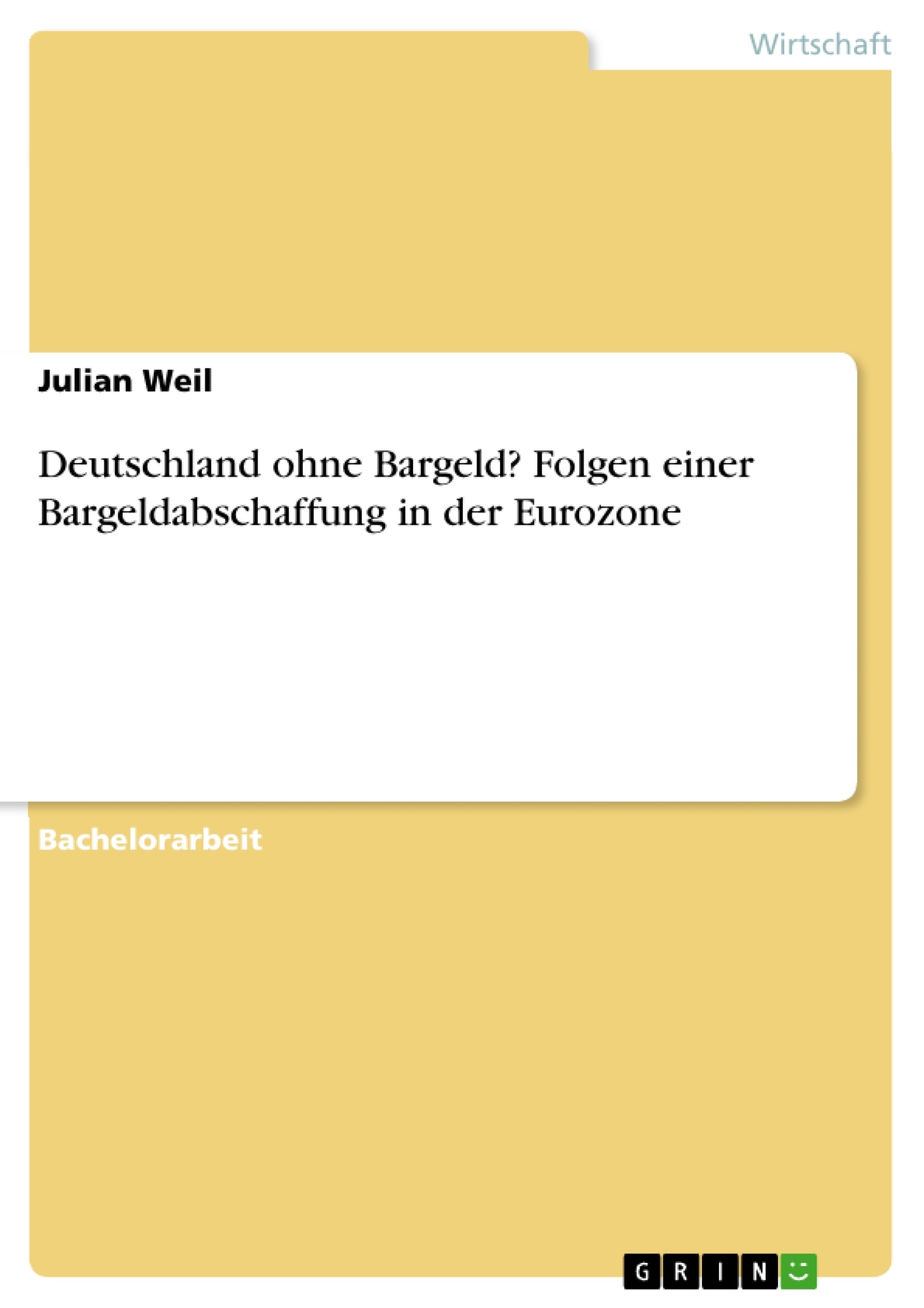Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird für Deutschland und die Eurozone die Implementierung eines bargeldlosen Bezahlungssystems untersucht. Es findet eine Analyse der Folgen statt, wenn in der Eurozone als offizielles Zahlungsmittel eine Digitalwährung, beispielsweise einen „E-Euro“, simultan zur vollständigen Bargeldabschaffung eingeführt würde. Hierbei werden auf Basis geldtheoretischer Grundlagen potentielle Chancen und Risiken verglichen.
"Bargeld ist geprägte Freiheit", hat der ehemalige Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Otmar Issing (2014), in Anlehnung an Fjodor Dostojewski (1862) formuliert. Aktuell wachsen jedoch länderübergreifend bargeldkritische Stimmen. Zahlreiche renommierte Ökonomen fordern unter anderem, die Bargeldnutzung durch Obergrenzen einzuschränken, Noten mit hoher Denomination dem Zahlungsverkehr zu entziehen oder das Bargeld sogar vollständig abzuschaffen. Zwar versicherte Finanzminister Wolfgang Schäuble noch 2016 bezüglich einer möglichen Bargeldabschaffung: "In Kontinentaleuropa kenne ich niemanden, der die Absicht hat, Bargeld abzuschaffen."
Doch nicht zuletzt durch den Beschluss der EZB vom 04.05.2016 die Produktion und Ausgabe des 500 Euro Scheins bis Ende 2018 einzustellen, hat sich die Brisanz und Aktualität des Themas im Euroraum widergespiegelt. Spätestens durch ein Interview Peter Bofingers mit dem Spiegel, unter dem Titel "Bargeld ist ein Anachronismus", in welchem er argumentiert, Bargeld sei ein zu teures Zahlungsmittel, welches das Aufkommen schattenwirtschaftlicher Aktivitäten begünstige, ist die Diskussion auch in Deutschland angekommen. 12 europäische Staaten, darunter Frankreich, Italien und Spanien, haben bereits eine Obergrenze für Barzahlungen eingeführt. Auch wenn es in Deutschland bisher keine Bargeldobergrenze gibt, steht diese zur Debatte. Befürworter des Bargeldes sehen dies als erste Schritte in Richtung einer vollständigen Abschaffung. Kritiker des Bargelds argumentieren weiterhin, dass dieses durch seine Existenz Zentralbanken eine Geldpolitik unterhalb der Nullzinsgrenze größtenteils verhindere und eine Abschaffung somit die geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten ausweiten würde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Geldtheorie
- 2.1 Geldfunktionen
- 2.2 Geldvarianten
- 2.3 Umsetzungsmodell: Schweden
- 3. Chancen einer Bargeldabschaffung
- 3.1 Bekämpfung der Schattenwirtschaft
- 3.2 Effizienz der Geldpolitik
- 3.2.1 Schwundgeld
- 3.2.2 Flexibler Wechselkurs zwischen Bargeld und Buchgeld
- 3.2.3 Vergleich der Instrumente
- 3.3 Stabilität des Finanz- und Bankensektors
- 4. Risiken einer Bargeldabschaffung
- 4.1 Effizienz des Bargeldes
- 4.2 Anonymität des Bargeldes
- 4.3 Verletzung der Konsumentensouveränität
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Folgen einer möglichen Bargeldabschaffung in der Eurozone. Ziel ist es, die Chancen und Risiken einer solchen Maßnahme umfassend zu beleuchten und die aktuelle Debatte in Deutschland und Europa zu kontextualisieren.
- Chancen der Bargeldabschaffung für die Bekämpfung der Schattenwirtschaft und die Effizienz der Geldpolitik
- Risiken der Bargeldabschaffung im Hinblick auf die Effizienz des Bargeldes selbst, die Anonymität und die Konsumentensouveränität
- Analyse der verschiedenen Geldfunktionen und -varianten
- Vergleichende Betrachtung des schwedischen Umsetzungsmodells
- Bewertung der aktuellen Diskussion um Bargeld in Deutschland und Europa
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die aktuelle Debatte um die Bargeldabschaffung ein und stellt die kontroversen Positionen von Befürwortern und Gegnern dar. Sie verweist auf prominente Stimmen, wie Otmar Issing und Peter Bofinger, und beleuchtet die wachsende Kritik an Bargeld sowie die unterschiedlichen Ansätze zur Einschränkung oder Abschaffung von Bargeld in europäischen Ländern. Die Einleitung hebt die Bedeutung des Themas hervor und stellt die Relevanz der Arbeit im Kontext der aktuellen geldpolitischen Herausforderungen dar. Der wachsende Anteil an Buchgeld im Vergleich zum Bargeldumlauf wird ebenfalls erwähnt, um den Kontext der Diskussion zu verdeutlichen.
2. Grundlagen der Geldtheorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Bargeldabschaffung. Es beschreibt die verschiedenen Geldfunktionen (Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Rechenmittel), unterscheidet zwischen verschiedenen Geldvarianten und analysiert das schwedische Modell als Beispiel für eine weitgehende Bargeldlosigkeit. Diese Grundlagen dienen als Basis für die spätere Bewertung der Chancen und Risiken einer Bargeldabschaffung in der Eurozone. Die Kapitel unterstreichen die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer fundierten theoretischen Basis für die folgende Analyse.
3. Chancen einer Bargeldabschaffung: Dieses Kapitel untersucht die potenziellen Vorteile einer Bargeldabschaffung. Es konzentriert sich auf drei Hauptaspekte: die Bekämpfung der Schattenwirtschaft, die Erhöhung der Effizienz der Geldpolitik (einschließlich der Diskussion um Schwundgeld, flexible Wechselkurse und den Vergleich verschiedener geldpolitischer Instrumente) und die Stärkung der Stabilität des Finanz- und Bankensektors. Die Kapitel analysieren, wie eine Bargeldabschaffung die Möglichkeiten zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten verbessern und die geldpolitische Steuerung effektiver gestalten könnte. Es werden dazu verschiedene ökonomische Mechanismen und Beispiele angeführt, um die dargelegten Argumente zu untermauern.
4. Risiken einer Bargeldabschaffung: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel werden hier die potenziellen Nachteile einer Bargeldabschaffung ausführlich diskutiert. Die Kapitel fokussiert sich auf die Effizienz des Bargeldes als Zahlungsmittel, die Wichtigkeit der Anonymität des Bargeldes und die mögliche Verletzung der Konsumentensouveränität durch eine vollständige Bargeldabschaffung. Es werden gewichtete Argumente und Beispiele geliefert, um die möglichen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Bevölkerung aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Bargeldabschaffung, Eurozone, Schattenwirtschaft, Geldpolitik, Geldfunktionen, Geldvarianten, Schwundgeld, Konsumentensouveränität, Anonymität, Risiken, Chancen, Schweden, Zentralbank, Nullzinsgrenze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Folgen einer möglichen Bargeldabschaffung in der Eurozone
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Folgen einer möglichen Bargeldabschaffung in der Eurozone. Sie beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Risiken einer solchen Maßnahme und kontextualisiert die aktuelle Debatte in Deutschland und Europa.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Chancen der Bargeldabschaffung zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft und Steigerung der Effizienz der Geldpolitik; Risiken der Bargeldabschaffung hinsichtlich Effizienz des Bargeldes, Anonymität und Konsumentensouveränität; Analyse verschiedener Geldfunktionen und -varianten; Vergleichendes Studium des schwedischen Umsetzungsmodells; Bewertung der aktuellen Diskussion um Bargeld in Deutschland und Europa.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Geldtheorie, Chancen einer Bargeldabschaffung, Risiken einer Bargeldabschaffung und Fazit/Ausblick. Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte vor und nennt prominente Meinungen. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 und 4 beleuchten die Chancen und Risiken im Detail. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die Chancen einer Bargeldabschaffung laut der Arbeit?
Die Arbeit sieht folgende Chancen: Bekämpfung der Schattenwirtschaft, effizientere Geldpolitik (durch Schwundgeld, flexible Wechselkurse etc.), und eine stabilere Finanz- und Bankenlandschaft.
Welche Risiken werden im Zusammenhang mit einer Bargeldabschaffung genannt?
Die Arbeit identifiziert folgende Risiken: Verlust der Effizienz von Bargeld als Zahlungsmittel, Einschränkung der Anonymität und mögliche Verletzung der Konsumentensouveränität.
Welche Rolle spielt das schwedische Modell in der Arbeit?
Das schwedische Modell dient als Beispiel für ein Land mit weitgehender Bargeldlosigkeit. Es wird analysiert, um die potenziellen Auswirkungen einer Bargeldabschaffung besser einschätzen zu können.
Wer wird in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit erwähnt prominente Ökonomen wie Otmar Issing und Peter Bofinger, die unterschiedliche Positionen in der Debatte um die Bargeldabschaffung vertreten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Bargeldabschaffung, Eurozone, Schattenwirtschaft, Geldpolitik, Geldfunktionen, Geldvarianten, Schwundgeld, Konsumentensouveränität, Anonymität, Risiken, Chancen, Schweden, Zentralbank, Nullzinsgrenze.
Wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema?
(Hier könnte man Links zu relevanten Webseiten, Studien oder Artikeln einfügen)
- Quote paper
- Julian Weil (Author), 2019, Deutschland ohne Bargeld? Folgen einer Bargeldabschaffung in der Eurozone, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/989438