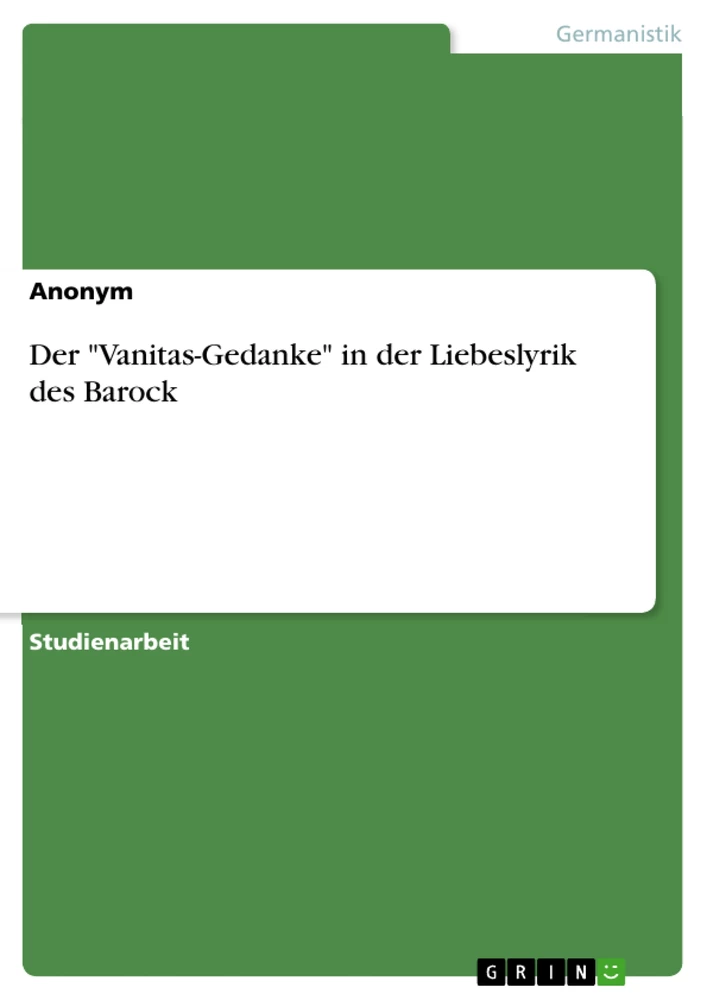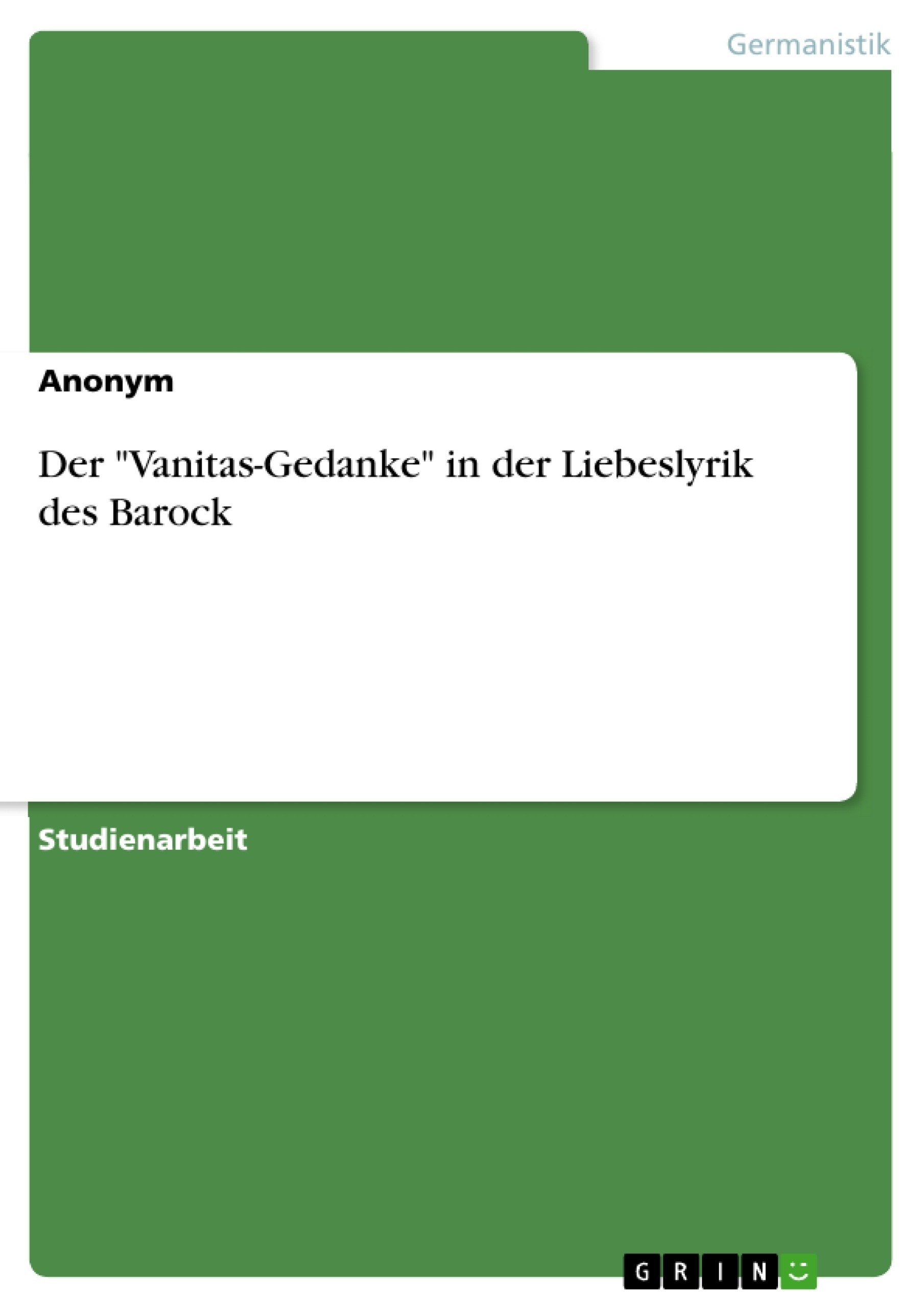Die folgende Hausarbeit gilt der Untersuchung des „Vanitas“ und des „Memento mori“ in der Liebeslyrik des Barockzeitalters. Dies soll Aufschluss geben, welche bedeutende Rolle beide Begriffe in der Epoche von 1600 bis 1720 gespielt haben. Meine Analyse soll die Zerrissenheit der Menschen und deren pessimistische Grundeinstellung aufzeigen, welche in der Liebeslyrik des Barock erkennbar ist.
Ich habe mich speziell für die Untersuchung der Liebeslyrik entschieden, da das Motiv des „Vanitas“ und die Liebeslyrik meiner Meinung nach einen großen Kontrast darstellen, und ich es sehr interessant finde, wie diese in der Barockzeit zusammengeführt wurden. Die zwei ausgewählten Gedichte „Ach „Liebste / las vns eilen“ von Martin Opitz, sowie das Gedicht „Sonnet. Vergänglichkeit der Schönheit.“ von Christian Hofmann von Hofmannswaldau, lassen sich auf Grund ihrer für den Barock typischen Merkmale als eindeutig dieser Zeit angehörig identifizieren. Gedichte aus der Zeit des Barock verdeutlichen den engen Zusammenhang von Leben und Tod, der Tod wird allem Lebendigen angehaftet. Auch Liebe und Schönheit sind ihm unterworfen und damit vergänglich. Dies wird in den beiden ausgewählten Gedichten sehr deutlich thematisiert, weswegen ich sie gewählt habe. Beide Autoren waren essentielle Dichter dieser Epoche und haben die Lyrik des Barock stark geprägt. Dennoch weisen beiden Autoren auch viele Unterschiede auf, beispielsweise in Stil und Form.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Merkmale des Barock
- Allgemeines
- Themen und Intentionen
- Liebeslyrik im Barock
- Interpretation der Gedichte
- „Ach Liebste, laß uns eilen“ (Martin Opitz)
- „Sonnet. Vergänglichkeit der Schönheit“ (Christian Hofmann von Hofmannswaldau)
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede & Vergleich im Hinblick auf die Fragestellung
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den „Vanitas“- und „Memento mori“-Gedanke in der Liebeslyrik des Barock (1600-1720) und beleuchtet deren Bedeutung in dieser Epoche. Die Analyse zielt darauf ab, die Zerrissenheit und die pessimistische Grundhaltung der Menschen aufzuzeigen, die sich in der Liebeslyrik widerspiegeln. Der Kontrast zwischen dem „Vanitas“-Motiv und der Liebeslyrik bildet einen zentralen Fokus.
- Der „Vanitas“-Gedanke in der Barocklyrik
- Die Rolle des „Memento mori“-Motivs
- Die Darstellung von Liebe und Vergänglichkeit in der Barockdichtung
- Stilistische Mittel und ihre Funktion in der Barocklyrik
- Vergleichende Analyse ausgewählter Gedichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Untersuchung des „Vanitas“- und „Memento mori“-Motivs in der Liebeslyrik des Barock. Sie begründet die Wahl der Liebeslyrik als Untersuchungsgegenstand aufgrund des interessanten Kontrasts zum „Vanitas“-Motiv und nennt die zwei ausgewählten Gedichte von Martin Opitz und Christian Hofmann von Hofmannswaldau als analytische Grundlage. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung der historischen Kontextualisierung hervor.
Fragestellung: Dieses Kapitel formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Es untersucht die Bedeutung des „Vanitas“-Motivs im Barock, die historischen Hintergründe, die Auswirkungen auf die Menschen und die Nutzung der Erfahrung der Vergänglichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Prägung der Liebeslyrik durch den „Vanitas“-Gedanken und dessen Manifestation in den ausgewählten Gedichten.
Merkmale des Barock: Dieser Abschnitt beschreibt die Epoche des Barock (ca. 1600-1720), ihren Ursprung im italienischen Wort „barocco“, und deren stilistische Merkmale. Er hebt den Einfluss des Humanismus, religiöser Strömungen und des Dreißigjährigen Krieges hervor, der das Leben der Menschen durch Gewalt und Zerstörung prägte. Die Reaktion auf diesen zerstörerischen Alltag manifestierte sich in einem literarischen Drang nach Struktur und System, der sich in der Befolgung theoretischer Anweisungen und dem Nachahmen vorbildlicher Muster, wie im Petrarkismus, äußerte. Die Bedeutung von Martin Opitz und seinem „Buch von der Deutschen Poeterey“ (1624) als Richtlinien für die barocke Lyrik wird hervorgehoben. Die typischen stilistischen Mittel des Barock wie Antithesen, asyndetische Worthäufungen, Intensivierung, Pointierung, Gleichnisse und Wortspiele, sowie Dissonanzen und Widersprüche werden beschrieben. Der Abschnitt betont die Bedeutung der stilistischen Elemente im Kontext des jeweiligen Themas und die charakteristischen Spannungen zwischen Lebensgier und Todesbangen, sowie die Hinwendung zu Gott und das „Vanitas“-Motiv als Folge des Dreißigjährigen Krieges. Die zentralen Motive „Carpe diem“, „Memento mori“ und „Vanitas“ werden im Kontext ihrer Bedeutung und gegenseitigen Beziehungen erläutert.
Schlüsselwörter
Vanitas, Memento mori, Barocklyrik, Liebeslyrik, Martin Opitz, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Vergänglichkeit, Todesbewusstsein, Antithese, Stilmittel, Dreißigjähriger Krieg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Vanitas und Memento Mori in der Barocklyrik
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den „Vanitas“- und „Memento mori“-Gedanke in der Liebeslyrik des Barock (1600-1720) und beleuchtet deren Bedeutung in dieser Epoche. Der Fokus liegt auf der Zerrissenheit und der pessimistischen Grundhaltung der Menschen, die sich in der Liebeslyrik widerspiegeln, insbesondere im Kontrast zwischen dem „Vanitas“-Motiv und der Liebeslyrik.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Gedichte: „Ach Liebste, laß uns eilen“ von Martin Opitz und „Sonnet. Vergänglichkeit der Schönheit“ von Christian Hofmann von Hofmannswaldau. Diese Gedichte dienen als Grundlage für den Vergleich und die Analyse der zentralen Forschungsfragen.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des „Vanitas“-Motivs im Barock, die historischen Hintergründe, die Auswirkungen auf die Menschen und die Nutzung der Erfahrung der Vergänglichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Prägung der Liebeslyrik durch den „Vanitas“-Gedanken und dessen Manifestation in den ausgewählten Gedichten. Die zentralen Fragen drehen sich um die Darstellung von Liebe und Vergänglichkeit im Kontext des „Vanitas“- und „Memento mori“-Gedankens.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Fragestellung und den Aufbau erläutert, gefolgt von einem Kapitel zu den Merkmalen des Barock, einer detaillierten Interpretation der ausgewählten Gedichte und einer abschließenden Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis fasst die einzelnen Kapitel zusammen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den „Vanitas“-Gedanke in der Barocklyrik, die Rolle des „Memento mori“-Motivs, die Darstellung von Liebe und Vergänglichkeit in der Barockdichtung, stilistische Mittel und ihre Funktion in der Barocklyrik sowie eine vergleichende Analyse der ausgewählten Gedichte. Der historische Kontext, insbesondere der Einfluss des Dreißigjährigen Krieges, wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche stilistischen Mittel des Barock werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt typische stilistische Mittel des Barock wie Antithesen, asyndetische Worthäufungen, Intensivierung, Pointierung, Gleichnisse und Wortspiele, sowie Dissonanzen und Widersprüche. Die Bedeutung dieser stilistischen Elemente im Kontext des jeweiligen Themas und die charakteristischen Spannungen zwischen Lebensgier und Todesbangen werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Vanitas, Memento mori, Barocklyrik, Liebeslyrik, Martin Opitz, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Vergänglichkeit, Todesbewusstsein, Antithese, Stilmittel und Dreißigjähriger Krieg.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext?
Der historische Kontext, insbesondere der Dreißigjährige Krieg und seine Auswirkungen auf die Menschen, spielt eine wichtige Rolle. Die Reaktion auf den zerstörerischen Alltag manifestierte sich in einem literarischen Drang nach Struktur und System, der sich in der Befolgung theoretischer Anweisungen und dem Nachahmen vorbildlicher Muster äußerte. Die Bedeutung von Martin Opitz und seinem „Buch von der Deutschen Poeterey“ (1624) als Richtlinien für die barocke Lyrik wird hervorgehoben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Der "Vanitas-Gedanke" in der Liebeslyrik des Barock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988512