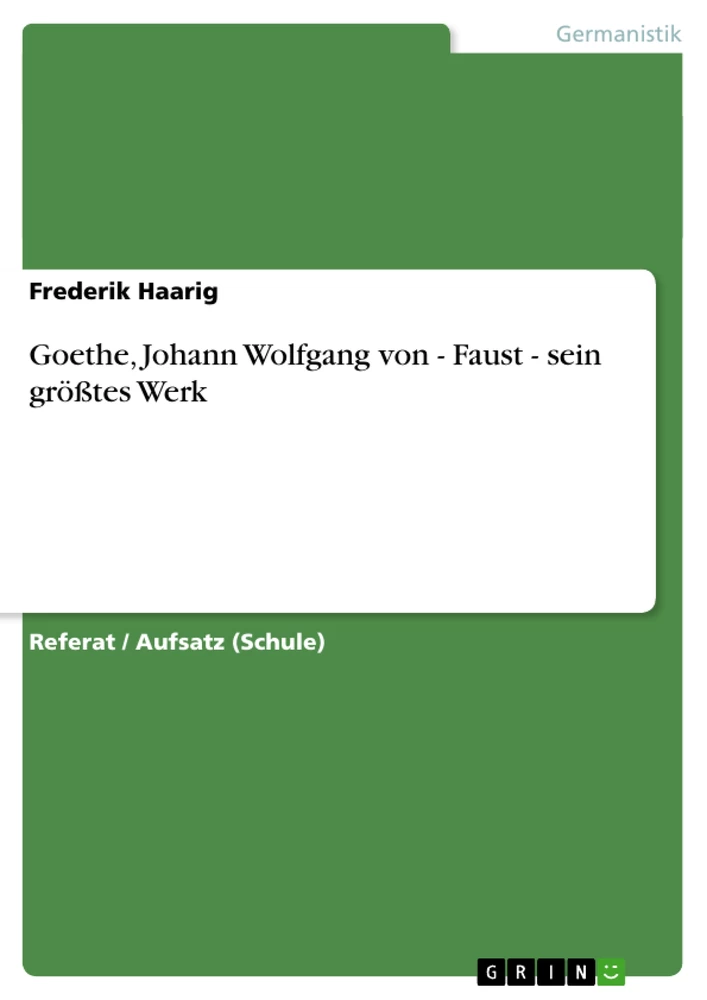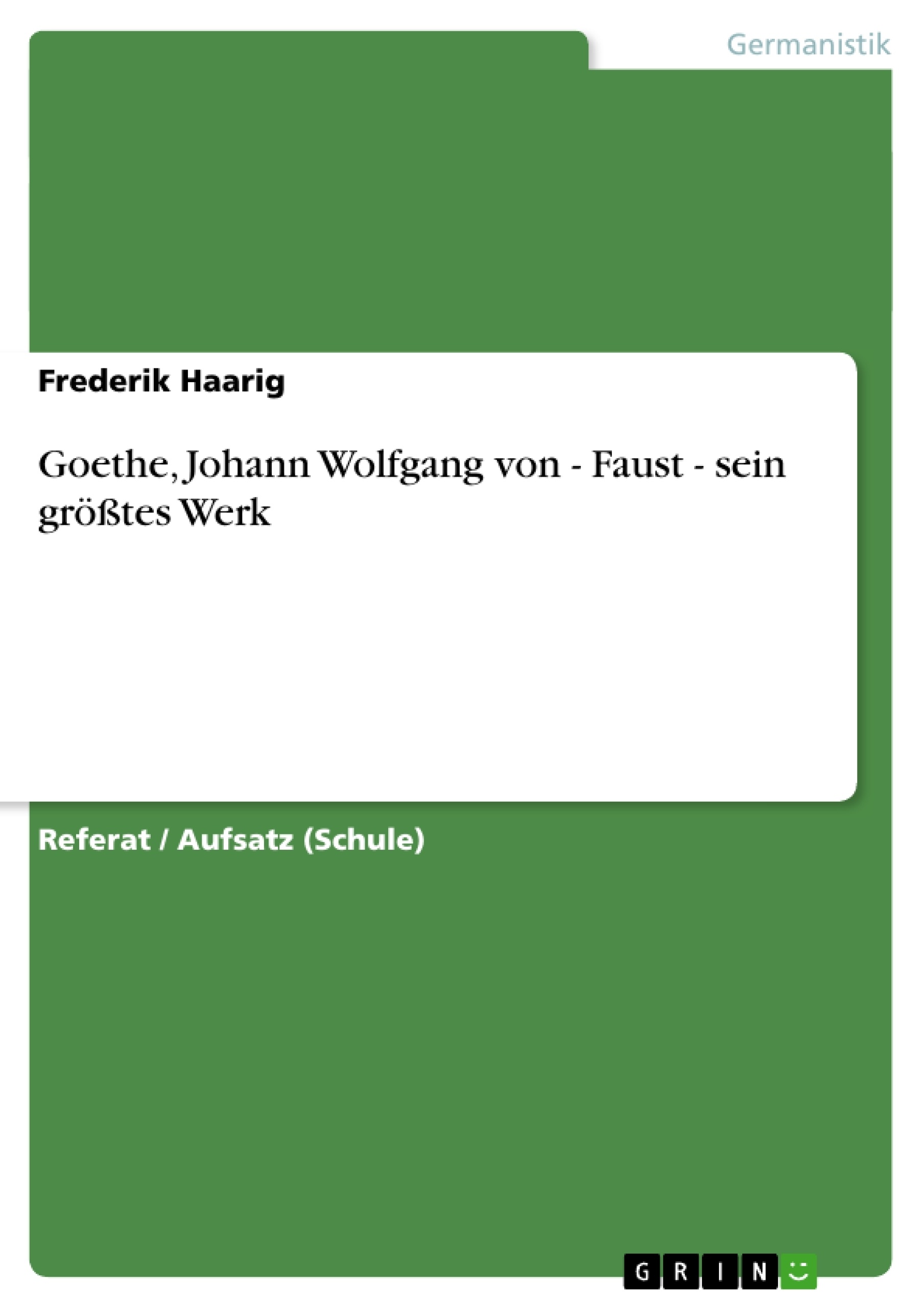Goethe - Faust - Sein größtes Werk
1. Einleitung
Themen dieser Ausarbeitung sind die verschiedenen Formen und Funktionen der Anonymität von Autorinnen des 18. und 19. Jahrhunderts sowie die Gründe für diese Anonymität. Ausge- hend von der Tatsache, daß in diesem Zeitraum viele Autorinnen aufgrund ihres Geschlechts anonym veröffentlichten, um sich nicht dem Vorwurf des Nichtweiblichen auszusetzen und um nicht ins gesellschaftliche Abseits zu geraden, beginne ich mit der Darstellung von verschiedenen Definitionen des Begriffes und schließe mit den Auswirkungen, die die Anonymität dieser Auto- rinnen des 18. und 19. Jahrhunderts auf das Schaffen nachfolgender Schriftstellerinnen hatte und hat.
2. Definitionen von Anonymität bzw. anonym
Anonym wird definiert als „ungenannt, ohne Angabe des Verfassers, der unbekannt ist oder nicht genannt werden möchte.“1 Dies ist zu finden „u.a. bei theologischen, politischen oder satirischen Schriften, Werken erotischen Inhalts, aber auch Frühwerken später berühmter Dichter.“2Es kann davon ausgegangen werden, daß auch Autorinnen diese Themen behandelt haben; ihre Anonymität ist aber auch und vor allem auf ihr Geschlecht begründet. Dieser Grund für die Wahl der Anonymität fehlt hier, ebenso wie im Brockhaus, wo anonym als „ohne Namen, dem Namen nach unbekannt“3definiert wird. „A. sind insbesondere solche Schriftstücke und liter. Erzeugnisse (Anonyma), die ohne Angabe des Verf. überliefert sind oder deren Verf. sich nicht nennen.“4Hier fehlt nicht nur die Begründung für weibliche Anonymität, sondern es wird gar kein Grund angegeben, warum sich ein Verfasser nicht zu seinem Werk bekennt. Ein anderes Lexikon wiederum nennt verschiedene Gründe für die Wahl der Anonymität.
Die Gründe für eine anonyme Veröffentlichung sind vielseitig. Es kann sich darin Einsicht in die mangelhafte ästhetische Qualität eines Textes, Bescheidenheit oder die Befolgung eines Verbots der Namensnennung ausdrücken. [...] Anonymität kann außerdem vor öffentlicher Brüskierung und Verfolgung schützen oder bei Veröffentlichungsverbot die Publikation eines Buches sichern.5
Auch hier wird der Anonymitätsgrund Geschlecht als solcher nicht genannt, es sei denn, man unterstellt den anonym veröffentlichenden Autorinnen eine generelle „Einsicht in die mangelhafte ästhetische Qualität“6ihrer Werke bzw. „Bescheidenheit“7, wovon wohl nicht auszugehen ist. Literatur von Frauen galt im 18. und 19. Jahrhundert als generell minderwertig und es gab nur wenige Genres, in denen Frauen überhaupt eine schriftstellerische Betätigung zugestanden wur- de. Ein Grund für die Anonymität liegt sicher im Bestreben, sich „[...] vor öffentlicher Brüskie- rung und Verfolgung [zu] schützen.“8Dies vor dem Hintergrund, daß im 18. und besonders im 19. Jahrhundert Autorinnen gesellschaftlich ausgeschlossen wurden.
3. Formen und Funktionen der Anonymität
Nachdem schreibende Frauen schon im Mittelalter eine Ausnahme waren und sich auf göttliche Eingebung berufen mußten, um ihr Schreiben zu rechtfertigten, wurden sie durch das im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte Frauenbild verstärkt in die Situation gebracht, sich für ihr Schreiben entschuldigen zu müssen, ihrem Wunsch zum Schreiben nicht nachgehen zu können oder aber sich in der Anonymität zu verstecken. Autorinnen sahen sich vor die Wahl gestellt, entweder eine gesellschaftlich anerkannte „Haus“-Frau und Mutter zu sein, die dem damaligen Bild der Frau entsprach, ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten dem Mann unterordnete und sich auf die Führung des Haushaltes und die Erziehung der Kinder konzentrierte oder aber ihren schriftstelle- rischen Interessen nachzugehen und sich dadurch dem Vorurteil auszusetzen, „[...] das Schrift- stellerinnen jegliches Talent abspricht und sie als sitzengelassene alte Jungfern abkanzelt. [...]“9
Autorinnen im 18. und 19. Jahrhundert veröffentlichten aus obigen Gründen selten unter eigenem Namen, sondern vielfach anonym oder unter Verwendung eines Pseudonyms, oft eines männli- chen (Pseudandronym). Im deutschen Sprachraum wurden von etwa 3.940 Autorinnen in die- sem Zeitraum 1.454 verschiedene Pseudonyme benutzt. Demnach hat ein Drittel bis die Hälfte unter Pseudonym veröffentlicht. Während Pseudonyme noch einer Autorin zugeordnet werden können, ist die Zahl derer, die anonym veröffentlichten, schwerer nachzuweisen, da es keinen Hinweis auf die Identität der Verfasserin/des Verfassers gibt außer der hohen Wahrscheinlich- keit, daß es eine Frau war, weil Anonymität zu einem sehr großen Teil von Frauen gewählt wur- de und nicht von Männern10. Diese veröffentlichten, wenn nicht unter eigenem Namen, eher un- ter einem Pseudonym als anonym.
Im 18. Jahrhundert verwendeten Autorinnen oft betont weibliche oder sich selbst herabsetzende Pseudonyme. Da die Pseudonyme oft schon die „Beschränktheit der eigenen schriftstellerischen Möglichkeiten“11herausstellten, etwa durch Verwendung von Diminutiven oder durch die Ver- wendung betont religiöser, gefühlsbetonter und privater Pseudonyme, wurde durch eben diese betont, daß die Autorin nicht erwartete, daß ihr Werk ernsthaft bewertet werden würde. Viel- mehr drückt sich in solchen Pseudonymen eine Beschränkung in die als typisch weiblich angese- hen Gebiete (Gefühl, Religion, Haus und Familie) aus. Durch die Botschaft, die diese Pseudo- nyme schon im Namen trugen, wurde das Werk von Schriftstellerinnen nicht ernst genommen. Dies schon deswegen nicht, weil sie sich oft in Genres bewegten, die ebenfalls als typisch weib- lich angesehen wurden.
Als weibliche Genres erscheinen [...] der Brief [...], der Briefroman [...], der Roman [...], pädagogisch ausgerichtete Literatur wie Kinderliteratur [...] und Mädchenliteratur [...], Übersetzungen und Lyrik [...], und generell marginale Formen wie ,Der Brief, das Tagebuch, das Gedicht, das Märchen und die Erzählung’.12
Diesen Gattungen ist gemein, daß sie sich hauptsächlich auf dem Gebiet des Privaten, des Inti- men und des Einfühlung Erfordernden bewegen, Gebieten also, die generell als weibliche galten.
Die Verwendung von vorwiegend weiblichen Pseudonymen änderte sich Anfang des 19. Jahr- hunderts, als Autorinnen vermehrt auf männliche Pseudonyme zurückgriffen. So stieg die Zahl der verwendeten Pseudandronyme nach 1820 von sieben im Zeitraum von 1700 bis 1820 auf 476 an, allerdings wurden auch 702 weibliche Pseudonyme gebraucht im Gegensatz zu 91 im Zeitraum von 1700 bis 1820.13Diese Pseudandronyme „errangen der Frau männlichen Autor- status und erfüllten damit vor allem die Funktion, sie von dem femininen Verhaltenskodex zu befreien.“14Autorinnen, die sich hinter einem männlichen Pseudonym verbargen, mußten nicht ständig sich und ihr Schreiben entschuldigen und rechtfertigen. „Während im 18. Jahrhundert das Pseudonym hauptsächlich dazu dient, die Identität zu verbergen, liegt im 19. die Betonung auf der Verhüllung des Geschlechts der Autorin.“15Sie hatten einen Namen, wenn auch einen fal- schen, unter dem ihr Werk, da es vermeintlich von einem Mann stammte, die Chance hatte, ernst genommen und tradiert zu werden, was bei Nennung der weiblichen Verfasserin schlicht unmöglich gewesen wäre.
Während unter Pseudonym oder anonym veröffentlichende Männer diese Form oft nur für ihr Erstlingswerk benutzten und sich später zu ihrem Werk bekannten, blieben Frauen auch bei spä- teren Schriften anonym bzw. behielten ihr Pseudonym, das oft einen männlichen Verfasser ima- ginierte, bei. Hierdurch wurde es erst möglich, daß das Werk ernst genommen und entspre- chend beachtet wurde, jedoch war auch dies selten, denn selbst männliche Pseudonyme ver- deckten nicht immer die weibliche Urheberschaft. Die Zahl derer, die ein Pseudandronym be- nutzten war wesentlich höher als die derjenigen, die ein Pseudogynym benutzten, was wiederum auf die gesellschaftlichen Beschränkungen von Autorinnen hinweist. Die vertretene Ansicht „Ein Frauenname [...] ist kein Autorname, kann keiner sein.“16zeigt dies deutlich.
Es gab einige wenige Ausnahmen, bei denen auch Autorinnen bekannt wurden. Es war allerdings weniger ihr Werk, das tradiert wurde, sondern vielmehr wurde die Figur der Autorin und das Außergewöhnliche ihrer Situation weiter vermittelt.
Informationen über sie sind minimal und häufig auf die Erwähnung ihres Namens beschränkt. In solchen Fällen ersetzt die Überlieferung des Namens die der Autorin: der Name [...] wird pro forma tradiert.17
Es galt also nicht das Geschriebene, sondern daß eine Frau fähig war, sich in der Männerdomäne Literatur zu behaupten und um den Preis, den sie dafür zahlte. Eine schreibende Frau stand vor der Wahl, sich entweder als Frau oder als Autorin zu definieren, denn Die Spaltung der Identität ‘Frau’ und ‘Autorin’ war bereits in der Aufklärung ein Thema. Auch dort galt die gelehrte Frau als Ausnahme, die keineswegs unbedingt zur Nachahmung empfohlen wurde.18
Beachtenswert ist hierbei, daß
Die kleine Schar der Autorinnen, die heute noch allgemein bekannt sind oder gar, wenn auch nur mit einer kleinen Werkauswahl, tradiert werden, [...] alle entweder zu- mindest einen Teil ihrer Werke unter ihrem eigenen Namen [veröffentlichten], oder das Werk [...] bald nach ihrem Tod unter ihrem Namen herausgegeben [wurde].19
Bei den Autorinnen Bettina von Arnim, Marie von Ebner-Eschenbach und Karoline Neuber gehörte der Name schon zu Lebzeiten zu ihrem Werk, während bei Luise Gottsched, Karoline von Günderrode und Annette von Droste-Hülshoff ihr Name erst nach ihrem Tode dem jeweili- gen Werk zugeordnet wurde, da diese ihre Werke entweder anonym, pseudonym oder gar nicht veröffentlichten.20
Wie oben schon dargelegt, gehört zur Aufnahme in den Kanon und zur Tradierung der eine Na- me, der mit dem Werk in Verbindung gebracht wird. Doch der Preis für die Aufnahme in den Kanon war vielfach eine schizophrene Situation, denn einerseits galt allgemein die Überzeugung, daß eine Frau kein Autor sein kann, andererseits wurde das Gegenteil täglich erlebt. Im 18. Jahrhundert war Der Gegensatz ,Frau’ und ,Autorin’ [...] eine Gratwanderung, [...] die mit viel Feinge- fühl bewältigt werden konnte; der Gegensatz ,Hausfrau’ und ,Autorin’ im 19. reprä- sentiert einen unüberbrückbaren Abgrund - zwei einander diametral entgegengesetzte Identitäten.21
Dieser Gegensatz wurde zunächst lediglich kommentiert, im 19. Jahrhundert reagierten Autorin- nen vermehrt mit der Übernahme der männlichen Rolle. So stieg die Zahl der männlichen Pseu- donyme stark an. Schriftstellerinnen identifizierten sich voll und ganz mit der Männerrolle, da sie - weil sie Literatur verfaßten - im gesellschaftlichen Empfinden keine Frauen waren. Durch diese Übernahme männlich definierter Eigenschaften wurde versucht, der Schizophrenie zweier Identitäten (Frau und Autorin) zu entgehen und statt dessen nur eine Identität zu leben. Dies war, da sich die Frauen für ihr Schriftstellertum entschieden, zwangsläufig eine männliche.
Die hier genannten Möglichkeiten der Verwendung verschiedener Arten von Pseudonymen ist zwar durch die Umstände bedingt, doch konnten Autorinnen letztendlich selbst entscheiden, ob sie - trotz aller Nachteile - unter eigenem Namen veröffentlichten oder nicht. Wenn sie unter eigenem Namen veröffentlichten, stellten sie dem Werk oft ein Vorwort voran, in dem sie eine Rechtfertigung für ihr Schreiben suchten. Auch verteidigten sich Autorinnen, daß Werk nicht aus eigenem Willen geschrieben zu haben, sondern nur eine Art ,göttliches Werkzeug’ gewesen zu sein. So z.B. Mechthild von Magdeburg, die schreibt: „Eia Herr, [...] Du hast mich verleitet, / Du selber hießest es mich schreiben!“22Eine andere Alternative bestand darin, sich von dem Werk distanzierten oder zu versuchen, das Werk als etwas hinzustellen, das nicht der Beachtung wert sei und quasi ,nebenbei’ und ,aus Versehen’ entstanden sei. Karoline von Günderrode antwortet in einem Brief an Clemens Brentano auf seine entsprechende Frage: „Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, meine Gedichte drucken zu lassen, wollen Sie wissen? Ich habe stets eine dunk- le Neigung dazu gehabt [...].“23
Von der von den Frauen selbst gewählten Anonymität unterscheidet sich die „effektive, die Abwesenheit der Autorinnen im tradierten Literaturkanon.“24Zu dieser effektiven Anonymität trägt z.B. „[...] die Verwendung des Geburtsnamen als Autorname, Namensänderung bei Ehe- schließung oder -scheidung [...]“25nicht unerheblich bei. Nicht nur die „indentierteAnonymi- tät“26, sondern auch der Umgang mit Autorinnen und ihrem Werk förderte die Auffassung, daß Frauen vor dem 20. Jahrhundert keine Literatur produziert hätten, denn gerade der Name eines Schriftstellers wird oft mit seinem Werk gleichgesetzt. „Ein Dichter identifiziert sich über den ‚Einen Namen‘ [...] eine Dichterin dagegen bleibt namenlos oder bezeichnet sich durch eine Vielzahl von Namen.“27bzw. sie wird, da ihr Schriftstellertum und ihre behandelten Themen nicht als wichtig erachtet werden, nicht tradiert. Die Abwesenheit von Autorinnen im Kanon der Literatur liegt also nicht daran, daß diese keine Literatur produziert hätten. Auch die anonyme Veröffentlichung bzw. die Verwendung von Pseudonymen und die damit verbundene Schwierig- keit der Zuordnung trug nur teilweise zur nur sporadischen Anwesenheit der Schriftstellerinnen bei.
Folgenreicher als die Anonymität der Autorinnen für ihre Rolle in der Literaturgeschichte erwies sich die [...] methodische, philosophische und ideologische Ausrichtung der Literaturkritik.28
Die Folgen dieser an Männern ausgerichteten Literaturkritik werden durch Zahlen belegt und verdeutlicht, wenn festgestellt wird, daß bei Durchsicht von 87 nicht-frauenzentrierten Literaturgeschichten, bibliographischen und kritischen Werken [...] 27 ganz ohne Frauen aus[kommen]; sechzehn weitere erwähnen eine ein- zige Frau [...], sechs zwei Frauen; 24 zwischen drei und zehn Schriftstellerinnen; 11 zwischen zehn und zwanzig, und nur drei über zwanzig. [...] in den 127 untersuchten li- teraturhistorischen Werken und Anthologien, veröffentlicht über einen Zeitraum von fast 150 Jahren, [...] nur 23 Autorinnen mehr als eine Seite zugestanden [wird].
4. Auswirkungen der Anonymität von Autorinnen auf die Literaturgeschichte
Sowohl durch die indentierte als auch durch die effektive Anonymität von Autorinnen sind sie in der Literaturgeschichte unterpräsentiert, so daß Schriftstellerinnen sich nicht oder nur schwer auf eine eigene Tradition beziehen können. Autorinnen [...] hatten keine Tradition hinter sich, oder eine so kurze und partielle, daß sie nur von geringer Hilfe war. Denn wir denken durch unsere Mütter zurück, wenn wir Frauen sind. Es ist zwecklos, auf die großen Männer als Hilfe zurückzugreifen, [...] Das Ge- wicht, die Gangart, die Schrittweise von eines Mannes Geist sind immer dem ihren un- gleich, um irgend etwas wirklich Wesentliches mit Gewinn zu stehlen. Der Apfel liegt zu weit vom Stamm.29
Anders ausgedrückt kann man sagen,
[...] unser literarisches Wissen besteht größtenteils darin, die Formen und Inhalte männlicher Literatur zu erkennen, anzuerkennen, zu analysieren, zu kritisieren, zu reflektieren, Bezüge zur männlichen Literaturgeschichte herzustellen usw. [...] Wir messen [...] Literatur an männlichen Formen und Inhalten.30
Durch das Bemühen um eine gleichberechtigte Tradierung der Werke von Autorinnen und ihre Eingliederung in den Kanon der Literaturgeschichte wird es heutigen und künftigen Schriftstellerinnen - hoffentlich - erleichtert, sich auf eine eigene literarische Tradition zu beziehen.
Literaturverzeichnis:
Arnold/Detering: Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 1996.
Brockhaus Lexikon. Wiesbaden 1986 [Band 1].
Kemp, Friedhelm (Hrsg.): Karoline von Günderrode. Trost in der Dichtung. Stuttgart 1947.
Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. Anonymität und weibliche Autorschaft. Stuttgart 1996.
Meyers Handbuch über die Literatur. Mannheim 1964.
Schmidt, Margot: Mechthild von Magdeburg - Das fließende Licht der Gottheit. Stuttgart 1995.
Woolf, Virginia: Ein Zimmer für sich allein. Frankfurt/Main 1995.
1Meyers Handbuch über die Literatur. Mannheim 1964. S. 15.
2ebd.
3dtv-Brockhaus Lexikon. Wiesbaden 1986 [Band 1]. S. 206.
4 ebd.
5 Arnold/Detering: Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 1996. S. 349.
6 ebd.
7 ebd.
8 ebd.
9 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. Anonymität und weibliche Autorschaft. Stuttgart 1996. S. 179.
10vgl. Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 13.
11Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 14.
12 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 62.
13vgl. Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 53.
14Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 15.
15Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 55.
16 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 18.
17Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 135.
18 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 93.
19 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 17.
20 vgl. Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 17.
21 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 94.
22 Schmidt: Margot: Mechthild von Magdeburg - Das fließende Licht der Gottheit. Stuttgart 1995.
23Kemp, Friedhelm (Hrsg.): Karoline von Günderrode. Trost in der Dichtung. Stuttgart 1947.
24 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 12 f.
25Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 13.
26Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 12.
27Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 18.
28 Kord, Susanne: Sich einen Namen machen. S. 135.
29Woolf, Virginia: Ein Zimmer für sich allein. Frankfurt/Main 1995. S. 85.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieser Ausarbeitung über die Anonymität von Autorinnen im 18. und 19. Jahrhundert?
Die Ausarbeitung thematisiert die verschiedenen Formen und Funktionen der Anonymität von Autorinnen im 18. und 19. Jahrhundert, sowie die Gründe für diese Anonymität. Ein zentraler Aspekt ist die gesellschaftliche Situation von Frauen in dieser Zeit, die oft anonym veröffentlichten, um sich nicht dem Vorwurf des "Nichtweiblichen" auszusetzen und gesellschaftliche Ausgrenzung zu vermeiden. Untersucht werden auch die Auswirkungen dieser Anonymität auf das Schaffen nachfolgender Schriftstellerinnen.
Wie wird Anonymität in der Ausarbeitung definiert?
Anonymität wird definiert als "ungenannt, ohne Angabe des Verfassers, der unbekannt ist oder nicht genannt werden möchte." Es wird darauf hingewiesen, dass Anonymität oft in theologischen, politischen, satirischen oder erotischen Schriften vorkommt. Die Ausarbeitung betont, dass bei Autorinnen des 18. und 19. Jahrhunderts das Geschlecht oft ein wesentlicher Grund für die Anonymität war.
Welche Gründe werden für die Anonymität von Autorinnen genannt?
Mehrere Gründe werden genannt, darunter die Vermeidung öffentlicher Brüskierung und Verfolgung aufgrund des Geschlechts der Autorin. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Gesellschaft oft ablehnend gegenüber schreibenden Frauen. Anonymität schützte Autorinnen vor sozialer Ausgrenzung, da Literatur von Frauen generell als minderwertig galt.
Welche Formen der Anonymität werden unterschieden?
Die Ausarbeitung unterscheidet zwischen Anonymität, der Verwendung von betont weiblichen oder selbstherabsetzenden Pseudonymen und der Verwendung von männlichen Pseudonymen (Pseudandronymen). Pseudandronyme ermöglichten es Autorinnen, sich dem "femininen Verhaltenskodex" zu entziehen und ihren Werken mehr Anerkennung zu verschaffen.
Welche Rolle spielten männliche Pseudonyme (Pseudandronyme)?
Männliche Pseudonyme dienten dazu, das Geschlecht der Autorin zu verschleiern und so die Chancen auf eine ernsthafte Rezeption des Werkes zu erhöhen. Im 19. Jahrhundert lag der Fokus weniger auf der Verbergung der Identität als vielmehr auf der Verhüllung des Geschlechts. Autorinnen, die sich hinter einem männlichen Pseudonym verbargen, mussten sich weniger für ihr Schreiben rechtfertigen.
Was sind "weibliche Genres" und wie beeinflussten sie die Wahrnehmung von Autorinnen?
Bestimmte literarische Formen wie Briefe, Briefromane, Kinderliteratur, Mädchenliteratur, Lyrik und Übersetzungen wurden als "weibliche Genres" betrachtet. Diese Genres wurden oft dem Bereich des Privaten und Intimen zugeordnet und trugen dazu bei, dass Autorinnen und ihre Werke weniger ernst genommen wurden.
Was bedeutet "effektive Anonymität" im Gegensatz zur "intendierten Anonymität"?
Die "intendierte Anonymität" bezieht sich auf die bewusste Entscheidung einer Autorin, anonym oder unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Die "effektive Anonymität" hingegen beschreibt die Abwesenheit von Autorinnen im tradierten Literaturkanon, auch wenn sie nicht immer anonym veröffentlicht haben. Faktoren wie die Verwendung des Geburtsnamens, Namensänderungen bei Heirat oder Scheidung und die Ausrichtung der Literaturkritik trugen zur effektiven Anonymität bei.
Welche Auswirkungen hatte die Anonymität von Autorinnen auf die Literaturgeschichte?
Die Anonymität von Autorinnen führte zu ihrer Unterrepräsentanz in der Literaturgeschichte. Schriftstellerinnen hatten oft keine Tradition, auf die sie sich beziehen konnten, und ihre Werke wurden seltener tradiert. Die an Männern ausgerichtete Literaturkritik verstärkte diesen Effekt.
Wie beeinflusst das Fehlen einer weiblichen literarischen Tradition heutige Autorinnen?
Das Fehlen einer umfassenden weiblichen literarischen Tradition erschwert es heutigen Autorinnen, sich auf eine eigene Tradition zu beziehen. Literarisches Wissen und die Bewertung von Literatur orientieren sich oft an männlichen Formen und Inhalten.
- Quote paper
- Frederik Haarig (Author), 2000, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust - sein größtes Werk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98828