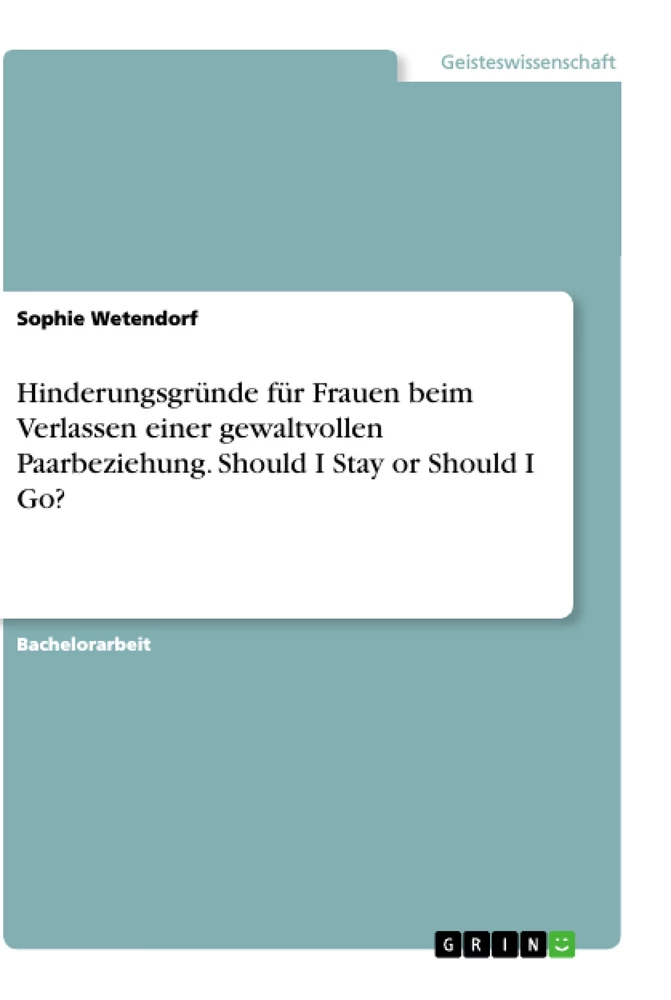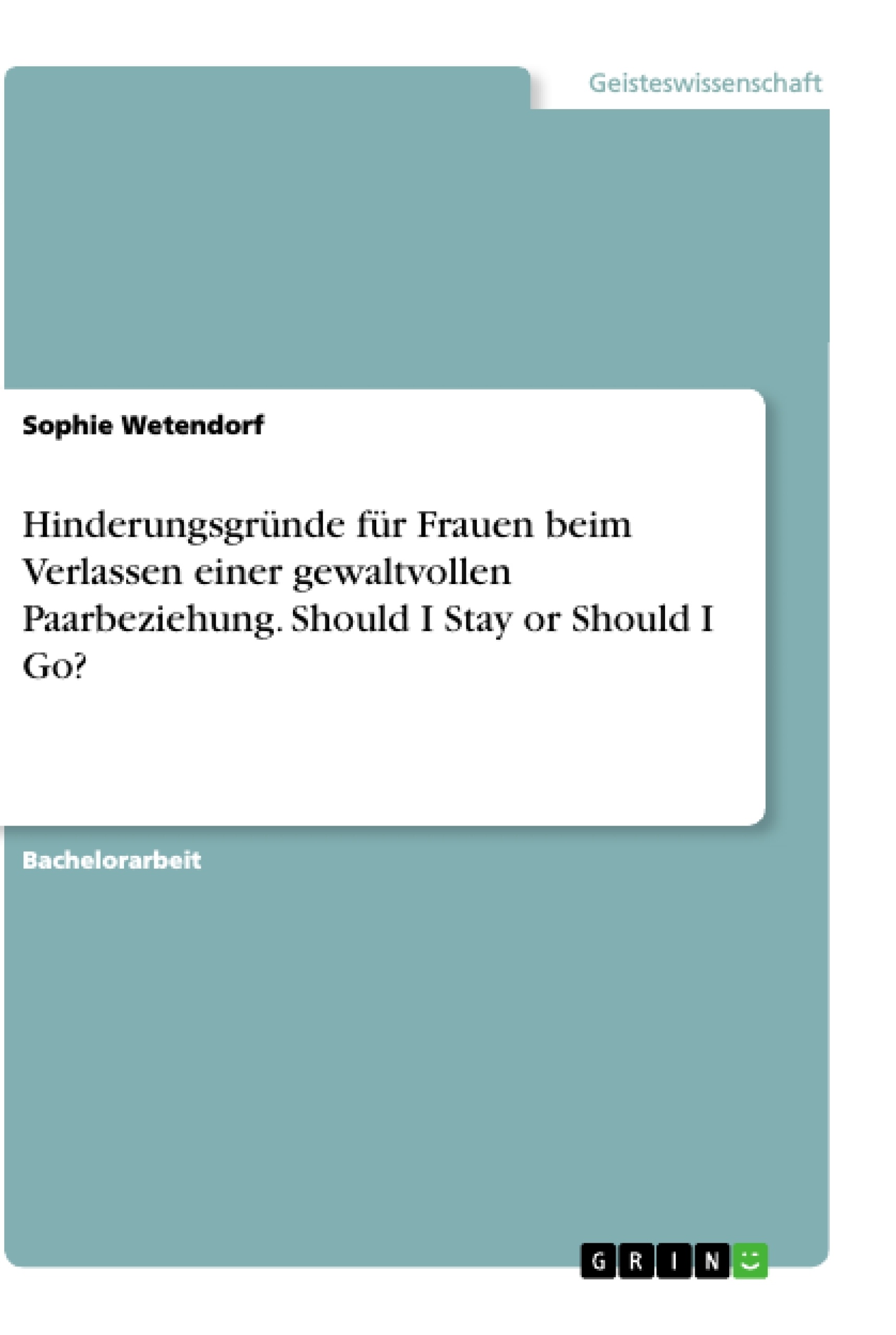Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, Hindernisse zu analysieren, die Frauen eine Trennung von einem gewalttätigen Partner in der heterosexuellen Paarbeziehung erschweren. Der Fokus liegt zudem auf Möglichkeiten und Hürden in der sozialarbeiterischen Beratung mit Frauen, die sich vor weiterer Gewalt durch den Partner schützen wollen. Zunächst wird der aktuelle Forschungsstand zu Formen, Dynamiken und psychologischen Aspekten bei Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft dargestellt und rechtliche Schutzmöglichkeiten in Deutschland erörtert. Im empirischen Teil wird zuerst das Forschungsvorgehen detailliert beschrieben, um dem Gütekriterium qualitativer Sozialforschung, der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, zu genügen. Darauffolgend wird die angewandte Methode, die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, beschrieben und in der konkreten Anwendung dargestellt. Und anschließend werden die Ergebnisse unter thematischen Gesichtspunkten zusammengefasst präsentiert. Zuletzt werden Limitationen, Fazit und Ausblick diskutiert.
Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft ist eine Menschenrechtsverletzung (Art. 3 Istanbul-Konvention). Diese Feststellung ist bemerkenswert, da Menschenrechte üblicherweise als Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat definiert sind. Gewalt in sozialen Beziehungen war demnach juristisch lange Zeit Privatsache. Bei der Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien wurde international die Abkehr von diesem Menschenrechtsverständnis besiegelt und Gewalt gegen Frauen grundsätzlich als Menschenrechtsproblematik anerkannt. Damit gehen weitreichende Schutz- und Gewährleistungspflichten des Staates einher. So müssen staatliche Behörden effektive Maßnahmen treffen, um Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft zu verhindern und zu verfolgen. Doch die aktuellste kriminalstatistische Auswertung des BKA zu Partnerschaftsgewalt über das Berichtsjahr 2018 zeigt, dass die Vorfälle kontinuierlich steigen und für Frauen weiterhin das eigene zu Hause der gefährlichste Ort ist. Insofern ist es menschenrechtlich, politisch und damit auch aus sozialarbeiterischer Perspektive geboten die Hürden zu kennen, die den Schutz vor Gewalt durch den Partner erschweren.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Aufbau der Arbeit
- 1.2. Begriffsbestimmungen
- 2. Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft: Theoretische Grundlagen und Forschungsstand
- 2.1. Formen und Risikofaktoren
- 2.2. Dynamiken
- 2.3. Identifikation mit dem Aggressor – Das Stockholm-Syndrom
- 2.4. Viktimisierung und Weiblichkeit
- 2.5. Rechtliche Möglichkeiten des Gewaltschutzes
- 2.6. Die Handlungsmacht der Frau – vier Muster
- 3. Empirischer Teil I – Forschungsdesign
- 3.1. Datenerhebung
- 3.1.1. Feldzugang
- 3.1.2. Stichprobe
- 3.1.3. Erhebungsinstrument
- 3.1.4. Erhebungssituation
- 3.1.5. Transkription
- 3.1.6. Forschungsethik
- 3.2. Datenauswertung mit qualitativer Inhaltsanalyse
- 3.2.1. Anwendung deduktiver Kategorien
- 3.2.2. Bildung induktiver Kategorien
- 3.2.3. Intracoderreliabilität
- 4. Empirischer Teil II – Forschungsergebnisse
- 4.1. Finanzen und Organisation
- 4.2. Emotionale Bindung
- 4.3. Anhaltende Bedrohung und Effektivität des Rechtsschutzes
- 4.4. Die Rolle der Kinder
- 4.4.1. Kinder als wahrgenommener Hinderungsgrund
- 4.4.2. Die Sicht der Kinder als Ressource im Beratungsprozess
- 4.5. Täterstrategien
- 4.5.1. Schuldverschiebung
- 4.5.2. Soziale Isolation
- 4.5.3. Sorgerechtsstreit
- 4.6. Stigmatisierung
- 4.7. Mangelnde Ressourcen in den Beratungsstellen
- 5. Diskussion der Ergebnisse
- 5.1. Limitationen
- 5.2. Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Hindernisse, die Frauen eine Trennung von einem gewalttätigen Partner in einer heterosexuellen Paarbeziehung erschweren. Sie fokussiert außerdem auf Möglichkeiten und Hürden in der sozialarbeiterischen Beratung von Frauen, die Schutz vor weiterer Gewalt suchen.
- Individuelle, paar- und gesellschaftliche Faktoren, die eine Trennung erschweren
- Erfahrungen und Perspektiven von Beraterinnen in der Praxis
- Trennungshindernisse auf den Ebenen: finanziell-organisatorisch, emotional, anhaltende Bedrohung
- Einfluss von Täterstrategien, gesellschaftlicher Stigmatisierung und der Sicht der Kinder
- Spezifische Beratungsinhalte und Rahmenbedingungen für eine qualitative Begleitung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau und die Begriffsbestimmungen der Arbeit erläutert. Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen und den aktuellen Forschungsstand zur Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft dar, einschließlich Formen, Risikofaktoren, Dynamiken, dem Stockholm-Syndrom, Viktimisierung und Weiblichkeit, rechtlichen Möglichkeiten und Handlungsmacht der Frau. Das Kapitel 3 widmet sich dem Forschungsdesign, einschließlich der Datenerhebungsmethode (qualitative Leitfadeninterviews), der Stichprobenauswahl, der Erhebungsinstrumente und der Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse.
Kapitel 4 präsentiert die Forschungsergebnisse, die in drei Hauptkategorien unterteilt sind: finanzielle und organisatorische Hindernisse, emotionale Bindung und anhaltende Bedrohung durch den Partner. Es werden auch die Perspektiven der Kinder, Täterstrategien, gesellschaftliche Stigmatisierung und Ressourcen in den Beratungsstellen beleuchtet.
Die Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 betrachtet Limitationen der Arbeit und zieht ein Fazit mit einem Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Gewalt gegen Frauen, Partnerschaftsgewalt, Trennungshindernisse, Frauenberatung, Soziale Arbeit, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Täterstrategien, Stigmatisierung, Ressourcen, Schutz vor Gewalt, Rechtsschutz, Kinderperspektive.
- Quote paper
- Sophie Wetendorf (Author), 2020, Hinderungsgründe für Frauen beim Verlassen einer gewaltvollen Paarbeziehung. Should I Stay or Should I Go?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988213