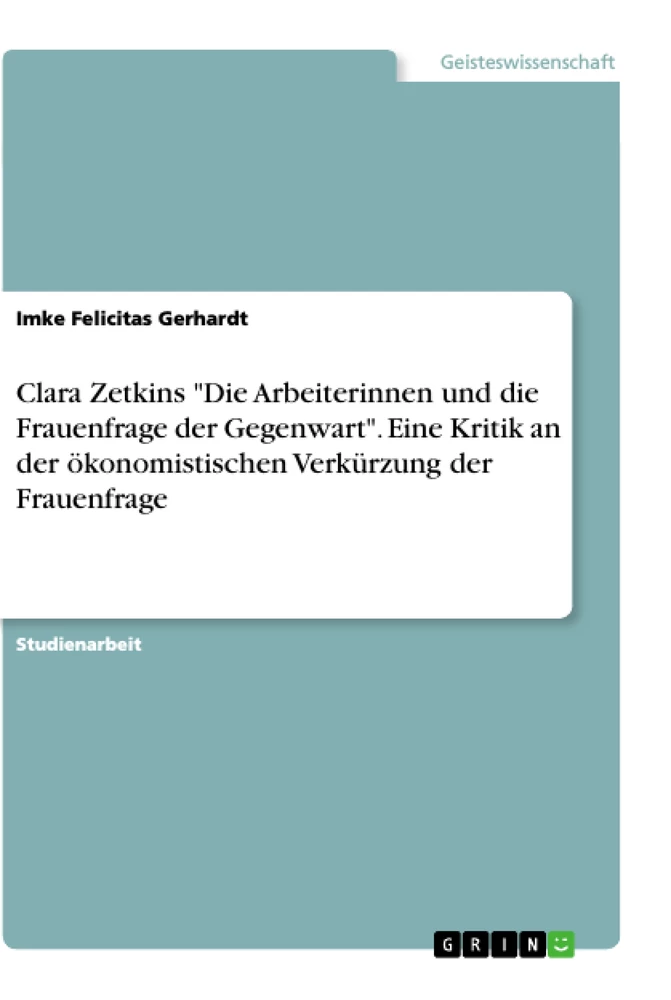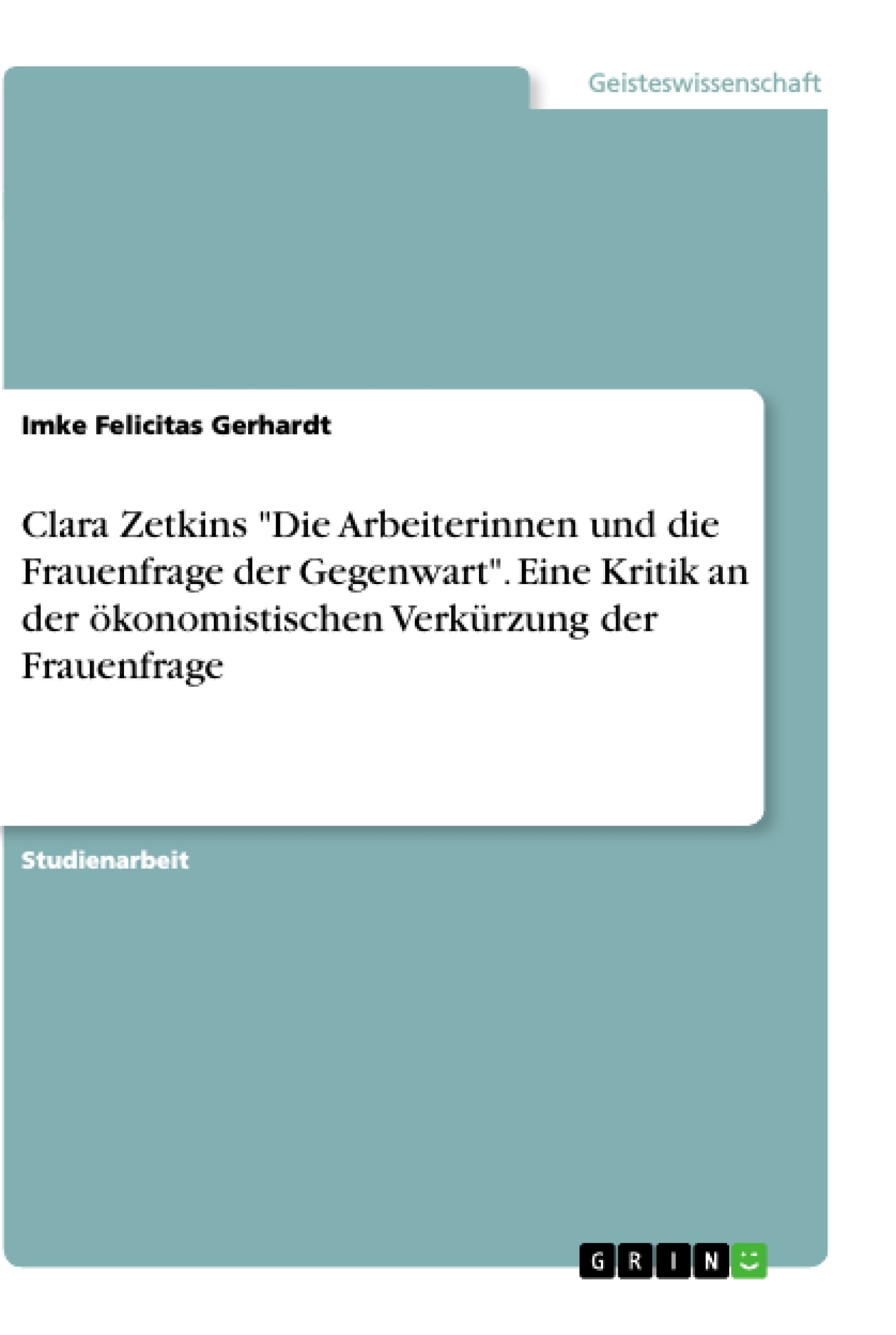War Clara Zetkins Analyse der Frauenfrage wirklich so umfassend, wie sie schien? Diese tiefgründige Untersuchung dekonstruiert Zetkins einflussreiche Schrift "Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart" aus dem Jahr 1892 und enthüllt eine überraschende ökonomistische Verkürzung, die die Komplexität der Geschlechterverhältnisse verfehlte. Tauchen Sie ein in das Deutschland des 19. Jahrhunderts, einer Zeit des industriellen Aufbruchs und des wachsenden Klassenkampfes, in der die Frauenbewegung in bürgerliche und proletarische Lager gespalten war. Entdecken Sie die feinen Unterschiede in ihren Zielen, von der Forderung nach politischer Teilhabe durch das Wahlrecht bis hin zum Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft. Verfolgen Sie die Entwicklung der männlichen Hegemonie und die Konstruktion von Geschlecht, wie sie durch die Aufklärung und die sich wandelnden Produktionsverhältnisse geformt wurde. Erfahren Sie, wie ein bürgerliches Ideal von Weiblichkeit geschaffen wurde, das Frauen aus dem öffentlichen Leben verbannte und ihre vermeintliche Unterlegenheit biologisch rechtfertigte. Die Analyse beleuchtet die Rolle von Schlüsselfiguren wie August Bebel und untersucht die Spannungen innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung, etwa zwischen Minna Cauer und Helene Lange. Kritisch hinterfragt wird die Verflechtung von Struktur und Superstruktur im Kapitalismus und die damit einhergehende "Abspaltung des Weiblichen". Diese Arbeit ist mehr als eine historische Aufarbeitung; sie ist eine feministische Erweiterung des Marxismus, die die anhaltende Relevanz der Frauenfrage für die heutige Gesellschaft unterstreicht. Schlüsselwörter: Frauenfrage, Clara Zetkin, SPD, Arbeiterinnenbewegung, Frauenbewegung, bürgerliche Frauenbewegung, proletarische Frauenbewegung, männliche Hegemonie, Geschlechterverhältnisse, Ökonomismus, Kapitalismus, Wahlrecht, Gleichheit – ein Muss für alle, die sich für Geschlechterforschung, Ideologiekritik und die Geschichte der sozialen Bewegungen interessieren. Lassen Sie sich fesseln von einer Analyse, die den vermeintlich unerschütterlichen Grundfesten der sozialistischen Theorie widerspricht und neue Perspektiven auf die Emanzipation der Frau eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und historischer Kontext
- 2. Arbeit, Geschlecht, Identität
- 3. Männliche Hegemonie und die Konstruktion von Geschlecht
- 4. Die Verwobenheit von Struktur und Superstruktur und die Männlichkeit des Kapitalismus
- 5. Die Spaltung von Privatheit und Öffentlichkeit im soziokulturellen Kontext
- 6. Wert-Abspaltung oder die Abspaltung des Weiblichen
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Clara Zetkins Schrift "Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart" von 1892 und hinterfragt deren ökonomistische Verkürzung der Frauenfrage. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Frauenfrage im 19. Jahrhundert, die divergierenden Ansätze der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung und die Rolle von Zetkin innerhalb der sozialdemokratischen Frauenbewegung.
- Die ökonomistische Interpretation der Frauenfrage
- Der Vergleich der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung
- Die Rolle von Clara Zetkin und August Bebel
- Männliche Hegemonie und die Konstruktion von Geschlecht
- Die Spaltung von Privatheit und Öffentlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und historischer Kontext: Die Einleitung zitiert Clara Zetkin, um die zentrale These der Arbeit einzuführen: die ökonomistische Verkürzung der Frauenfrage. Sie verortet die Frauenfrage im Kontext der Industrialisierung und des aufkommenden Klassenkampfes des 19. Jahrhunderts, betont den stets existierenden weiblichen Widerstand und die Heterogenität der Frauenbewegung mit ihren divergierenden Zielen und Forderungen. Die Arbeit kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit Zetkins Schrift an, die den marxistischen Ansatz feministisch erweitert.
2. Arbeit, Geschlecht, Identität: (Kapitel fehlt im Auszug, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden)
3. Männliche Hegemonie und die Konstruktion von Geschlecht: Dieses Kapitel analysiert die Konstruktion von Geschlecht im Kontext der Aufklärung und der sich verändernden Produktionsverhältnisse. Es beschreibt, wie ein bürgerliches Bild von Weiblichkeit geschaffen wurde, das Frauen von der Öffentlichkeit ausschloss und ihre Inferiorität biologistisch legitimierte. Die androzentrische Definition des Staatsbürgerschaftsbegriffs, propagiert von Intellektuellen wie Heinrich von Treitschke, wird als Hindernis für einen geschlossenen Kampf der bürgerlichen Frauenbewegung um das Wahlrecht dargestellt. Die unterschiedlichen Positionen innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung (Minna Cauer vs. Helene Lange) werden beleuchtet.
4. Die Verwobenheit von Struktur und Superstruktur und die Männlichkeit des Kapitalismus: (Kapitel fehlt im Auszug, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden)
5. Die Spaltung von Privatheit und Öffentlichkeit im soziokulturellen Kontext: (Kapitel fehlt im Auszug, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden)
6. Wert-Abspaltung oder die Abspaltung des Weiblichen: (Kapitel fehlt im Auszug, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden)
Schlüsselwörter
Frauenfrage, Clara Zetkin, Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Arbeiterinnenbewegung, Frauenbewegung, bürgerliche Frauenbewegung, proletarische Frauenbewegung, Männliche Hegemonie, Geschlechterverhältnisse, Ökonomismus, Kapitalismus, Wahlrecht, Gleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Clara Zetkins "Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart"?
Die Arbeit analysiert Clara Zetkins Schrift "Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart" von 1892 und hinterfragt die ökonomistische Verkürzung der Frauenfrage. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Frauenfrage im 19. Jahrhundert, die divergierenden Ansätze der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung und die Rolle von Zetkin innerhalb der sozialdemokratischen Frauenbewegung.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die ökonomistische Interpretation der Frauenfrage, den Vergleich der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung, die Rolle von Clara Zetkin und August Bebel, männliche Hegemonie und die Konstruktion von Geschlecht sowie die Spaltung von Privatheit und Öffentlichkeit.
Was wird in der Einleitung und dem historischen Kontext erläutert?
Die Einleitung führt die These der ökonomistischen Verkürzung der Frauenfrage ein. Sie verortet die Frauenfrage im Kontext der Industrialisierung und des Klassenkampfes des 19. Jahrhunderts, betont den weiblichen Widerstand und die Heterogenität der Frauenbewegung mit ihren unterschiedlichen Zielen.
Was wird im Kapitel über männliche Hegemonie und die Konstruktion von Geschlecht analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Konstruktion von Geschlecht im Kontext der Aufklärung und der sich verändernden Produktionsverhältnisse. Es beschreibt die Entstehung eines bürgerlichen Bildes von Weiblichkeit, das Frauen von der Öffentlichkeit ausschloss und ihre Inferiorität biologistisch legitimierte. Die androzentrische Definition des Staatsbürgerschaftsbegriffs wird als Hindernis für einen geschlossenen Kampf der bürgerlichen Frauenbewegung um das Wahlrecht dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Frauenfrage, Clara Zetkin, Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Arbeiterinnenbewegung, Frauenbewegung, bürgerliche Frauenbewegung, proletarische Frauenbewegung, Männliche Hegemonie, Geschlechterverhältnisse, Ökonomismus, Kapitalismus, Wahlrecht, Gleichheit.
- Arbeit zitieren
- Imke Felicitas Gerhardt (Autor:in), 2017, Clara Zetkins "Die Arbeiterinnen und die Frauenfrage der Gegenwart". Eine Kritik an der ökonomistischen Verkürzung der Frauenfrage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988174