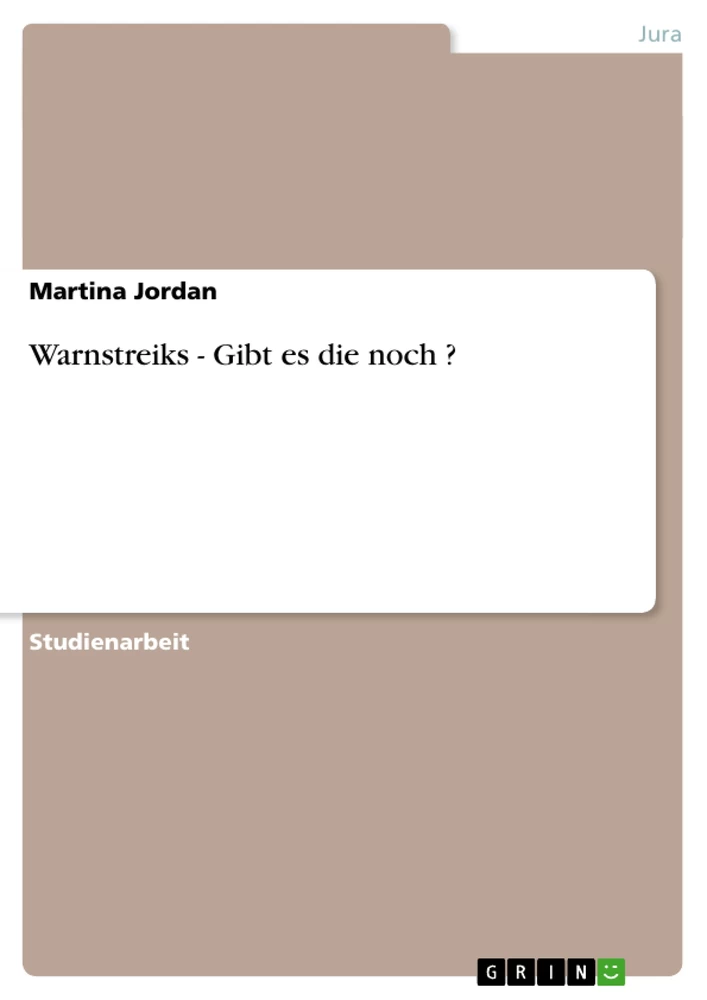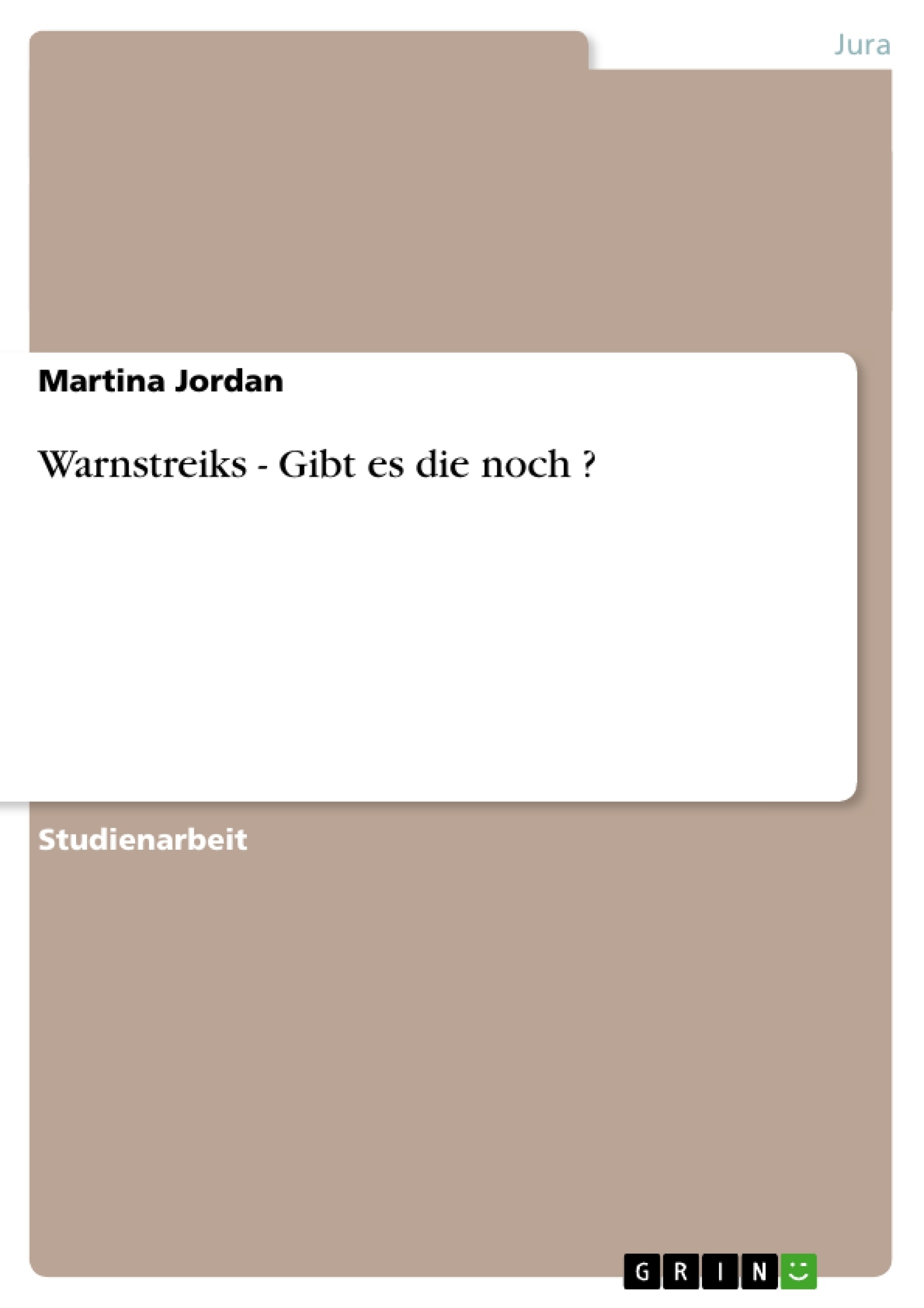Warnstreiks: Gibt es die noch ?
I. Einleitung
Der Warnstreik ist das meistdiskutierte arbeitskamfprecht- liche Thema der letzten Jahre1.
Die einschlägigen Urteile des BAG zum Warnstreik wurden heftig umstritten, so daß nachdem auf den Begriff des Ar- beitskampfes und auf die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen von Arbeitskämpfen eingegangen wurde, diese näher betrach- tet werden müssen. Erst dann kann auf die Fragen, ob der Warnstreik sich vom Erzwingungsstreik abgrenzt und ob es ihn noch gibt, eingegangen werden.
II. Begriff und Arten des Arbeitskampfes
1. BegriffdesArbeitskampfes
Das Recht des Arbeitskampfes ist gesetzlich nicht gere- gelt. Es entsteht durch Richterrecht, so daß es für den Begriff des Arbeitskampfes an einer gesetzlichen Definiti- on fehlt2. Nach übereinstimmender Auffassung spricht man von einem Arbeitskampf, wenn von der Arbeitgeber- oder Ar- beitnehmerseite kollektive Maßnahmen zur Störung der Ar- beitsbeziehungen ergriffen werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen3.
a) Kampfparteien
Bei den Parteien im Arbeitskampf handelt es sich um Ar- beitgeber und Arbeitnehmer, die sich in Form eines Kollek- tivs gegenüberstehen müssen. Dieses Kollektiv muß bewußt und gemeinsam handeln.
Legen mehrere Arbeitnehmer unabhängig voneinander die Ar- beit nieder, so fehlt es an der solidarischen Gemeinsam- keit des Handelns, die erst den Arbeitskampf ausmacht4.
Beim Arbeitgeber ist es ausreichend, daß er lediglich ei- nem Kollektiv von Arbeitnehmern gegenübersteht5.
Darüber hinaus müssen die Koalitionen mächtig genug sein, um wirksam Druck und Gegendruck auf den tariflichen Gegen- spieler ausüben zu können6.
b)Kampfmittel
Um wirksamen Druck ausüben zu können, erhält jede Seite verschiedene Kampfmittel7, wodurch ihnen die notwendige Kampffähigkeit verliehen wird8.
Kampfmittel sind sämtliche Maßnahmen, die an Stelle freien Verhandelns den Zwang zum Nachgeben setzen, und zwar aus Furcht vor den Nachteilen oder den Verlusten, die diese Maßnahme zur Folge haben9.
2.ArtendesArbeitskampfes
Um ihren Forderungen Nachdruck verleihen zu können, stehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verschieden Arten des Ar- beitskampfes zur Verfügung, wobei diese Ausarbeitung sich auf die wichtigsten beschränkt.
a)AufArbeitnehmerseite
Der Streik ist das wichtigste Arbeiskampfmittel der Ar- beitnehmerseite.
Streik ist die von einer Mehrzahl von Arbeitnehmern plan- mäßig und gemeinsam durchgeführte Arbeitseinstellung zur Erreichung eines Zieles; die Arbeitseinstellung erfolgt ohne Einverständnis des Arbeitgebers und ohne vorherige Kündigung10. Es gibt hier verschiedene Arten des Streiks:
z.B. Demonstrationsstreik, wilde Streiks, Erzwingungs- streik; Sympathiestreiks, Warnstreik etc..
b)AufArbeitgeberseite
Aus kampfparitätischen Gründen sollen die Arbeitgeber über eine adäquate Abwehrwaffe gegenüber dem Streik verfügen, um zu verhindern, daß dieser die Wirkung eines einseitigen Diktats erlangt11.
Die Arbeitgeberseite kann auf die unterschiedlichsten Streikformen mit Aussperrung reagieren.
Aussperrung ist die von einem oder mehreren Arbeitgebern planmäßig erfolgte Arbeitsausschließung zur Erreichung ei- nes Zieles; die Arbeitsausschließung erfolgt ohne Einver- ständnis und ohne vorherige Kündigung12.
Es gibt auch hier verschiedene Erscheinungsformen der Aus- sperrung; z.B. Angriffs- und Abwehraussperrung, Verbandsaussperrung ; Teilaussperrung etc..
III. Rechtsgrundlagen des Arbeitskampfes
1. InternationaleVereinbarungen:
Die wichtigste arbeitskampfrechtliche Regelung auf der E- bene des Völkerrechts enthält Teil II Art. 6 Nr. 4 der Eu- ropäischen Sozialcharta. Danach ist das Recht der Arbeit- nehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen ein- schließlich des Streiks im Falle von Interessenkonflikten anerkannt. Die innerstaatliche Verbindlichkeit der ESC ist allerdings umstritten.
Nach der einen Auffassung ist die ESC unmittelbar gelten- des Bundesrecht13; nach anderer Auffassung bindet sie le- diglich den Gesetzgeber und die Gerichte14.
Diese Streitigkeit muß hier allerdings nicht entschieden werden.
2.Grundgesetz
Der Arbeitskampf ist im GG nur in Art. 9 III 3 erwähnt. Aus Art. 9 III 1 GG läßt sich lediglich eine instrumentel- le verfassungsrechtliche Garantie des Arbeitskampfes herleiten15. Wesentliches Element dieser Garantie ist die Gewährleistung der Tarifautonomie, die nur funktionieren kann, wenn wirkungsvolle, aber auch tragbare Arbeitskampf- formen, zur Verfügung gestellt werden. Diesem Zweck dienen Streik und Aussperrung.
3.Landesverfassungen
In einigen Landesverfassungen werden der Streik und die Aussperrung als Arbeitskampfmittel erwähnt, wie z.B. Art. 66 von Rheinland-Pfalz; in Art. 29 der hessischen Landes- verfassung, die ausdrücklich die Aussperrung für rechts- widrig erklärt.
4.Gesetze
In mehreren Bundesgesetzen wird in allgemeiner Form auf den Arbeitskampf hingewiesen zB. in § 2 I Nr. 2 ArbGG; § 74 II BetrVG etc. Ansonsten existieren keine gesetzlichen Vorschriften.
IV. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für den des Arbeitskampfes
Da es an gesetzlichen Vorschriften weitgehend fehlt, war es vor allem Aufgabe der Rechtsprechung, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsrechtswissenschaft rechtsfortbildend (sog. gesetzesvertretendes Richterrecht) entsprechende Normen für die Entscheidung der Frage zu entwickeln, welche An- forderungen an die Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfes zu stellen sind16.
1. TarifrechtlicheGrenzen
a)TariffähigePartei
Der Arbeitskampf muß von einer tariffähigen Partei getra- gen werden.
Tariffähig sind Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber und Arbeitgebervereinigungen sowie Spitzenorganisationen17.
Diese Privilegierung gewerkschaftlicher Streiks ergibt sich aus der Funktion des Arbeitskampfes zur Sicherung der Tarifautonomie und der Koalitionsfreiheit18. Nur im Rahmen der Koalitionsfreiheit sind Arbeitskämpfe verfassungs- rechtlich geschützt.
b)Tariflich regelbaresZiel
Mit dem Arbeitskampf muß ein tariflich regelbares Ziel verfolgt werden19, d.h. um Ziele, die zulässiger, rechtmä- ßiger Inhalt eines Tarifvertrages sein können20. Aus dieser Zulässigkeitsvoraussetzung ergibt sich, daß politische Streiks rechtswidrig sind, weil das Ziel nur durch staat- lichen Hoheitsakt verwirklicht werden kann21. Für den De- monstrationstreik gilt das ebenfalls, da lediglich eine bestimmte Ansicht geäußert wird und das Ziel nichts mit dem regelbaren Ziel eines Tarifvertrages zu tun hat22.
c)Friedenspflicht
Als weitere Rechtmäßigkeitsvoraussetzung ist die Einhal- tung der Friedenspflicht für Tarifvertragsparteien von Be- deutung.
Unter Friedenspflicht versteht man die Pflicht der Tarifvertragsparteien, während der Laufzeit des Tarifvertrages von Kampfmaßnahmen keinen Gebrauch zu machen23.
2. Allgemeine Grundsätzerechtmäßiger Kampfführung
Der Große Senat des BAG entwickelte 197124 die allgemeinen
Grundsätze rechtmäßiger Kampfführung. Hierzu zählen das Gebot der Kampfparität und das Gebot der Verhältnismäßig- keit.
a)GebotderKampfparität
Das Arbeitskampfrecht steht unter dem Gebot der Kampfpari- tät, um ein hinreichendes Verhandlungs- und Kampfgleichge- wicht zwischen den Tarifparteien zu gewährleisten25. Dieses Gebot wird als Gebot für die staatlichen Organe, die Kampfmittel der Sozialpartner gleichmäßig zu behandeln, verstanden26, da es dem Staat wegen der durch Art. 9 III GG gewährleisteten Tarifautonomie untersagt ist, eine Kampf- partei zu begünstigen27. Die Waffengleichheit wird durch Verteilung von Kampfmitteln erreicht.
Welches Kampfmittel eingesetzt wird, entscheidet das Kol- lektiv selbst. Die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeitsvoraus- setzungen der verschiedenen Kampfmittel müssen allerdings berücksichtigt werden, da diese dem Gebot der Verhältnis- mäßigkeit unterliegen.
b)GebotderVerhältnismäßigkeit
Der Arbeitskampf greift nicht nur in die Rechte der unmit- telbar Betroffenen ein, sondern unter Umständen in die Rechte Dritter und die Allgemeinheit. Zu lösen ist dieser Konflikt im Wege praktischer Konkordanz nach dem verfas- sungsrechtlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit: Arbeits- kampfmaßnahmen müssen, gemessen an ihrer Funktion, wirt- schaftlichen Druck zur Lösung eines Tarifkonfliktes auszu- üben, geeignet und erforderlich sein; die durch sie ausge- lösten Beeinträchtigungen jener Rechtspositionen dürfen nicht außer Verhältnis zu dieser Funktion stehen28.
aa) Geeignet
Eine Maßnahme ist nur geeignet, wenn sie den erstrebten Erfolg überhaupt zu erreichen vermag, d.h. es dürfen keine Mittel eingesetzt werden, die von vornherein ihrer Art nach den gewünschten Erfolg nicht herbeiführen können29.
Ist das Kampfziel auf dem Rechtsweg zu erreichen, hat der Gerichtsschutz Vorrang vor der Selbsthilfe30.
bb)Erforderlichkeit, Ultima- ratio-Prinzip
Der Grundsatz der Erforderlichkeit bedeutet, daß der Ar- beitskampf nur eingesetzt werden darf, wenn schonendere Mittel nicht zum Ziel führen31.
Es müssen daher zunächst Verhandlungsmöglichkeiten und ta- rifvertraglich vorgesehene Schlichtungseinrichtungen aus- genützt werden , und es darf erst bei deren Versagen der Arbeitskampf begonnen werden32. Dies wird vom Großen Senat in seinem Urteil von 197133 auch als ultima-ratio- Prinzip bezeichnet.
cc)VerhältnismäßigkeitimengerenSinne
Der Grundsatz der Proportionalität als Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne betrifft das Ver- hältnis der eingesetzten Kampfmittel zum Kampfziel und da- mit die Art der Durchführung des Arbeitskampfes34.
Danach ist die Durchführung von Kämpfen verboten, wenn der aus ihnen resultierende Schaden in krassem Mißverhältnis zu dem zu erzielenden Nutzen steht, wie insbesondere bei ruinösen Arbeitskämpfen35. Dies schließt das Gebot fairer Kampfführung ein36, wonach z.B die Arbeitnehmerseite ver- pflichtet ist, Notstands- und Erhaltungsarbeiten durchzu- führen und der Arbeitgeber keine unverhältnismäßige Aus- sperrung vornehmen darf37
V. Kampfverbote
Der Einsatz der Kampfmittel und die Art der Kampfführung dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Zu nennen wären: das Streikverbot für Beamte; Kampfhandlun- gen, die gegen das Strafrecht verstoßen ( Nötigung Körper- verletzungen; Arbeitskampfmaßnahmen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber( § 74 II 1 BetrVG)etc..
VI. Sonderform des Arbeitskampfes Der Warnstreik
1.DieEntwicklungderRechtsprechungzum Warnstreik
Warnstreiks waren in den sechziger Jahren zu regelmäßigen Begleiterscheinungen von Tarifverhandlungen geworden. Die rechtliche Zulässigkeit derartiger Aktionen war lange Zeit fraglich, da sie typischerweise zu einem Zeitpunkt statt- finden, in dem die Verhandlungen noch nicht gescheitert sind. Diese unklare Rechtslage führte dazu, daß die Ge- werkschaften selten als Organisatoren in Erscheinung tra- ten, da sie Schadensersatzpflichten riskiert hätten. Die Folge war, daß Warnstreiks als wilde Streiks stattfanden, so daß sich erst recht Bedenken gegen ihre Zulässigkeit ergaben38.
Der rechtliche Wendepunkt und eigentliche Durchbruch für den Warnstreik war das Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 17.12.197639.
a)Warnstreikentscheidungdes BAGvom 17.12.1976
Im Dezember 1976 fällte das BAG das immer wieder als Schlüsselurteil angesehene Urteil zum Warnstreik, in dem eine Arbeitsniederlegung von zwei bis drei Stunden Dauer auch während laufender Tarifverhandlungen als rechtmäßig anerkannt wurde, sofern die Friedenspflicht abgelaufen war40 und dieser von einer Gewerkschaft getragen wurde41. Dem Ausgangspunkt diesen Urteiles galt eine Kündigungs- schutzklage.
Dem klagenden Arbeitnehmer war fristlos und vorsorglich fristgemäß gekündigt worden, weil er sich ohne Erlaubnis und gegen ein ausdrückliches Verbot des Arbeitgebers für zwei bis drei Stunden von seinem Arbeitsplatz entfernt hatte, um an einer von der IG- Metall veranstalteten De- monstration teilzunehmen. Diese Demonstration, die anläß- lich der Feier zur Eröffnung der Diamant- und Edelstein- börse Idar- Oberstein stattfand, sollte die IG- Metall bei Tarifverhandlungen mit dem Industrieverband Schmuck - und Metallwaren Idar- Oberstein e.V. für den Bereich des Krei- ses Birkenfeld unterstützen. Der klagende Arbeitnehmer hatte trotz ausdrücklichem Verbot des Arbeitgebers an die- ser Demonstration teilgenommen, worauf ihm der Arbeitgeber kündigte42.
Das BAG begründete sein Urteil wie folgt:.„ Hier handelt es sich um einen Unterfall der üblichen Arbeitsniederle- gung von Arbeitnehmern in Form eines Streiks, nämlich um eine kurze Arbeitsniederlegung in einem Betrieb in sachli- chen und zeitlichem Zusammenhang mit laufenden Tarifver- handlungen, auch als Warnstreik bezeichnet. Für derartige Warnstreiks gilt nicht uneingeschränkt der vom Großen Se- nat aufgestellte Grundsatz, daß Arbeitskampfmaßnahmen nur nach Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten er- griffen werden dürfen. Handelt es sich dagegen nach Ablauf der tariflichen Friedenspflicht und während des Laufs von Tarifverhandlungen nur darum, den Abschluß dieser Verhand- lungen dadurch zu beschleunigen, daß dem Tarifpartner die Bereitschaft, hier der Arbeitnehmerschaft, gegebenenfalls auch der nichtorganisierten Arbeitnehmer, zu einem inten- siveren Arbeitskampf vor Augen geführt werden soll, so kann der „ milde“ Druck in Form eines kurzen Warnstreiks auch vor Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten ausgeübt werden.“
Unbeschadet der bis heute ungelösten Schwierigkeit, den Begriff des „ kurzen Warnstreiks“ mit lediglich „ mildem Druck“ auf den Tarifgegner verläßlich zu definieren, mußte sich der 1. Senat mit dem „ ultima ratio“-Grundsatz ausei- nandersetzen.
In der Urteilsbegründung heißt es weiter: „ Der Grundsatz sei vom Großen Senat seinerzeit nur für den Regelfall län- gerfristig oder unbegrenzter Arbeitskampfmaßnahmen aufge- stellt worden.“ Für Warnstreiks gelte dieser Grundsatz „ nicht uneingeschränkt“. Damit schlägt das BAG den Weg der teleologischen Restriktion ein43.
Nur aufgrund dieser Logik konnte der 1. Senat die an sich formale Sperre der Regel durchbrechen44, indem er argumen- tierte: „ ein Warnstreik vor Ausschöpfung aller Verständi- gungsmöglichkeiten...entspricht geradezu dem allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Sinne der Wahl eines milden Mittels...45“
In rechtlich eindeutiger Weise setzt damit der erkennende Senat die qualitative Unterschiedlichkeit des „ Warn- streiks“ und des Arbeitskampfes nach dem Scheitern der Ta- rifvertragsverhandlungen voraus, eben weil ersterer sich rechtlich in der Funktion der Warnung vor dem eigentlichen Arbeitskampf erschöpft46.
Diese Privilegierung des Warnstreiks durch die Einschrän- kung des ultima ratio- Prinzips führte somit zu einer un- terschiedlichen rechtlichen Behandlung von Warn- und Er- zwingungsstreik.
Das Warnstreikurteil von 1976 regte die Experten einer kampferprobten Gewerkschaft erwartungsgemäß dazu an, aus dieser interessanten , neu geschenkten Einzelwaffe ein neues arbeitskampfstrategisches, flächenwirksames Kampf- konzept zu entwickeln47.
Sie erstellten für nachfolgende Tarifrunden jeweils einen von der Streikführung des Tarifgebietes organisierten Ge- samtplan rollierender Warnstreiks für die Dauer der Ver- handlungsrunde im Sinne einer großangelegten, hochwirksa- men konzentrierten Aktion. Der Einsatz dieser Kampfwaffe“ neue Beweglichkeit“48 hat seine Besonderheit darin, daß, ähnlich wie mit der „ Minimax“- Strategie bei den Schwer- punktkampfstreiks, jeweils besonders neuralgische Punkte im Produktionsbereich des Tarifgegeners ausgesucht wer- den49. Mit den kurzen befristeten Streiks, die dem produktionstechnischem Ablauf folgen, werden lawinenartige Stör- wirkungen ausgelöst.
1981 klagten mehrere Arbeitgeberverbände bei dem für das jeweilige Tarifgebiet zuständige Arbeitsgericht, da das gesamte Bundesgebiet von diesen Streikaktionen betroffen war. Sie wollten zum einen die Feststellung der Unzuläs- sigkeit der gewerkschaftlichen Streiks von 1981, und zum anderen wollten sie ferner das gerichtliche Verbot künfti- ger Arbeitskampfmaßnahmen dieser Art. Damit wollten die Arbeitgeber erreichen, daß gewerkschaftliche Kampfmaßnah- men auch in Form der „ Neuen Beweglichkeit“ nur als wirk- lich letztes Mittel, nämlich nach Scheitern der Tarifver- handlungen und Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, eingesetzt werden50.
Die Durchführung von Warnstreiks der IG Metall in Form der
„ Neuen Beweglichkeit“ von 1981 warf somit die Frage auf, ob es rechtlich einen Unterschied macht, wenn die verhand- lungsbegleitenden Warnstreiks einerseits sporadisch durch- geführt werden, wie es dem Warnstreiktyp des Urteils von 1976 entsprach, oder wenn die verhandlungsbegleitenden Warnstreiks andererseits gezielt und zentral geführt von der Gewerkschaftsspitze eingesetzt werden, um einen Tari- fabschluß zu erreichen51. Vom äußeren Erscheinungsbild sind beide Arten „Warnstreik“ nicht zu unterscheiden, es stellt sich die Frage nach den Grenzen der Wiederholungsmöglich- keiten und der Intensität des Einsatzes dieses Kampfin- struments und damit der Höhe des eintretenden Schadens52.
b)BAG,Urteilvom12.9.198453
Das BAG stellte 1984 auf das äußere Erscheinungsbild ab, so daß es auf die Entscheidung von 1976 zurückgreifen konnte, da es keinen wesentlichen Unterschied zwischen diesen Streiks sah.
Das BAG begründete sein Urteil wie folgt: „Das ultima- ratio- Prinzip verbiete nicht kurze und zeitlich befriste- te Streiks während laufender Tarifverhandlungen. Die Durchführung von Warnstreiks „nach Plan und Konzept“ ände- re an deren Zulässigkeit ebenso wenig wie deren Wiederho- lung54. Die Zulassung kurzer befristeter Warnstreiks ge- fährde nicht die Verhandlungsparität zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, da die hierbei verursachten Schäden in der Regel geringer ausfielen als bei zeitlich unbegrenzten Streiks55. Im übrigen seien Warnstreiks „ oft das einzige Druckmittel, das Bewegung in den Verhandlungsablauf brin- gen könne56.
Unerheblich für die Abgrenzung ist der Umstand, daß die verhandlungsbegleitenden Streiks der „ Neuen Beweglich- keit“ auf einem zuvor ausgearbeiteten Plan der Gewerk- schaft beruhen. Denn, so das Gericht, „ das Ausmaß der im jeweiligen Unternehmen durch die kurzfristige Arbeitsnie- derlegung verursachten Schäden hänge nicht davon ab, ob nach Plan, ob gleichzeitig oder zeitlich versetzt in ande- ren Unternehmen gestreikt werde57.“
aa) Meinungsstand
Diese Entscheidung ist in der Literatur nicht nur auf un- geteilte Zustimmung gestoßen. Die Kritik an dieser Ent- scheidung des BAG ist vielfältig und auffällig sind vor allem die teilweise scharfen Differenzen der Kritiker un- tereinander.
Es wurde um Friedenspflichten, Wiederholbarkeit, Urabstim- mung und gewerkschaftliche Trägerschaft gestritten, besonders aber um den gezielten und geplanten Einsatz im Rahmen der „ Neuen Beweglichkeit“.
Während die Mindermeinung meist unter Berufung auf den Grundsatz der freien Wahl der Kampfmittel Warnstreiks und
„ Neue Beweglichkeit“ zuläßt58, sind nach anderer Auffas- sung Warnstreiks während laufender Tarifverhandlungen we- gen Verstoßes gegen das ultima-ratio-Prinzips unzulässig59. Die Überwiegende Meinung hält Warnstreiks in Form der „ Neuen Beweglichkeit“ ebenfalls für unzulässig, wobei ein echter Warnstreik unter bestimmten Voraussetzungen teil- weise als zulässig angesehen wird60.
Als Voraussetzungen werden erstens die Dauer des Warn- streiks genannt, wobei die Höchstdauer 15 bis 30 Minuten nicht überschreiten darf61 und zweitens sollen Wiederholun- gen ausgeschlossen sein62.
Desweitern wurdem dem Senat vorgeworfen, er habe die Funk- tion und Bedeutung sowie die tatsächlichen Auswirkungen von Warnstreiks in der Form der neuen Beweglichkeit ver- kannt und diese zu Unrecht dem Warnstreik von 1976 gleich- gesetzt63.
Bezüglich der verursachten Schäden wurde in der Literatur nachgewiesen, daß gerade wegen des gezielten Einsatzes und des anderen Ziels - der herkömmliche Warnstreik soll le- diglich die Kampfbereitschaft demonstrieren und vor dem eigentlichen Arbeitskampf warnen64, die Neue Beweglichkeit soll gezielt auf die Produktion einwirken65- die Neue Be- weglichkeit nicht im Maßstab sonstiger Warnstreiks gemes- sen werden darf66.
Die Bezeichnung der „ Neuen Beweglichkeit“ als Warnstreik ist eine > falsa demonstratio >...67
bb) Eigene Stellungnahme
Wie das Urteil zeigt, macht es für das BAG keinen rechtli- chen Unterschied, wenn verhandlungsbegleitende Warnstreiks sporadisch durchgeführt werden, oder wenn sie gezielt und geplant eingesetzt werden. Über die zulässige Höchstdauer von Warnstreiks hat das BAG sich nicht geäußert.
Ob Warnstreiks in Form der „ Neuen Beweglichkeit“ einen nur „milden Druck“ ausüben und nur zu geringen Schäden führen, ist fraglich geworden. Bei sich wiederholenden Warnstreiks in ein und demselben Betrieb, oder ein ge- schickt eingesetzter Warnstreik, der dem produktionstech- nischem Ablauf folgt, können erhebliche Schäden hervorge- rufen werden, so daß der Druck ein nicht nur „ milder Druck“ darstellt. Gerade das Hervorrufen von erheblichen Schäden und dem damit verbundenen Druckanstieg liegt der gewerkschaftlichen Planung der Abfolge von Warnstreiks zu Grunde, daß bei der Arbeit mit hochsensiblen Maschinen o- der bei der Fertigung terminabhängiger Ware, man denke nur an das Zeitungswesen, auch kurze Ausstände zu einem erheb- lichen Produktionsausfall führen können68.
Desweiteren wird mit diesem Urteil der Grundsatz der Kampfparität in Frage gestellt.
Gerade die Priviligierung des Warnstreiks auch in Form der neuen Beweglichkeit läßt die Frage hinsichtlich eines möglichen Abwehrmittels, der Warnaussperrung offen. Für die Aussperrung gilt nach wie vor, daß sie als wirklich letztes Mittel eingesetzt werden darf, so daß bei der Verteilung der Kampfmittel ein Ungleichgewicht herrscht.
Wenn die eine Seite den Warnstreik als verhandlungsbegleitendes Kampfmittel zugesprochen bekommt, müßte also aus paritätischen Gründen der anderen Seite die schen Gründen der anderen Seite die Warnausperrung als Ab- wehrmittel zur Verfügung stehen.
Das Ungleichgewicht bei Verteilung der Kampfmittel, die fehlende Grenzziehung von Warn- und Erzwingungsstreiks und die Fehleinschätzung des BAG bezüglich der eintretenden Schäden, läßt dieses Urteil, bei einem gesunden Rechtsemp- finden, nur auf Ablehnung stoßen.
c)BAG-Urteilvom29.1.198569
In einer erneuten Beurteilung hielt das BAG an seiner Ent- scheidung von 198470 fest, wonach kurze befristete Warn- streiks in der Form der neuen Beweglichkeit während noch laufender Tarifverhandlungen zulässig waren.
d)BAG-Urteilvom21.6.1988
Im Zuge des Arbeitskampfes um die Einführung der 35 Std. Woche 1985 hatte die Gewerkschaft HBV einen ca. fünf- stündigen Warnstreik durchgeführt. Der Warnstreik war da- mit zeitlich befristet und fand nach Ablauf der tarifli- chen Friedenspflicht statt. Das bestreikte Unternehmen hielt diesen Warnstreik für unzulässig, da er mehr als 30- Minuten dauerte. Zugleich forderte es Schadensersatz.
Fraglich war aber, ob dieser Warnstreik noch als kurz zu bezeichnen war, da das Warnstreikurteil von 1976 eine Zeitspanne von 2-3 Stunden als Richtwert ansah71.
Das BAG hatte nun hierüber zu entscheiden.
aa)Abgrenzung Warn-undErzwingungsstreik
Das Urteil von Juni 1988 lehnt eine Unterscheidung zwi- schen Warn- und Erzwingungsstreiks und damit auch eine Privilegierung des Warnstreiks auch in Form der „ Neuen Beweglichkeit“ ab.
Eine solche Unterscheidung sei angesichts der Warnstreikpraxis in den letzten Jahren nicht mehr mDöigelifcrhüh72e.re Unterscheidung, wonach Warnstreiks „ kurze und zeitlich befristete“ Streiks seien, wurde schon 1982 verworfen. Dort wurde als entscheidenes Merkmal auf die Führung eines Warnstreiks vor Scheitern der Tarifverhandlungen abgestellt73.
Weiter heißt es:“ Diese Praxis nämlich habe gezeigt, daß weder die durch den Streik verursachten Schäden noch der dadurch ausgeübte Druck bei Warnstreiks in Form der „ Neu- en Beweglichkeit notwendigerweise geringer seien als im Fall längerfristiger Streiks. Die Dauer einer Arbeits- kampfmaßnahme, die Häufigkeit der Durchführung von Warn- streiks in einem einzelnen Betrieb und die Höhe des verur- sachten Schadens seien deshalb keine brauchbaren Abgren- zungsmerkmale74.
Insoweit gibt der Senat seine gegenteilige Meinung zu den vorherigen Warnstreikurteilen auf.
„Zur Unterscheidung von Warn- und Erzwingungsstreik wären die Kriterien die Kürze, den milden Druck und den geringen Schaden dann brauchbar, wenn sie näher definiert würden.
Eine solche Unterscheidung müßte allgemein oder jeweils für bestimmte Branchen zeitliche Obergrenzen festlegen und bestimmen, wie oft Warnstreiks gegen den gleichen Betrieb oder im Kampfgebiet wiederholt werden dürfen und wie hoch höchstens der Schaden sein dürfte. Eine solche Definition wäre willkürlich, sie fände in der Rechtsordnung keine Grundlage75
Was 1984 als praktikabel und zu sachgerechten Ergebnissen führte, ist nunmehr willkürlich76. Maßgebend ist für das BAG nunmehr, daß der Warnstreik weder von seinem äußeren Erscheinungsbild her noch bezüglich des von ihm ausgehenden Drucks vom Erzwingungsstreik unterschieden deshalb in der rechtlichen Unterscheidung auch nicht differenziert werden könne, damit aber auch den gleichen Rechtmäßig- keitsvoraussetzungen unterstellt werden kann77.
bb)Warnstreikundultima-ratio
Das BAG ordnet das ultima-ratio-Prinzip als Teilaspekt dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 78, und zwar speziell dem Grundsatz der Erforderlichkeit; zugleich will es für den Warnstreik- jedenfalls in der Form der „ Neuen Beweglichkeit“ - keine Ausnahme von dem Ultima-ratio - Prinzip mehr zulassen79.
Diesem Satz wäre vorbehaltlos zuzustimmen, wenn das BAG nicht gleichzeitig den ultima- ratio- Grundsatz seiner- seits in nunmehr veränderter Form definierte und damit für das gesamte Arbeitskampfrecht ein neues Verständnis der Erforderlichkeit des Arbeitskampfes vorgegeben hätte80.
Das BAG führt zum ultima- ratio- Prinzip nun aus, „daß Ar- beitskampfmaßnahmen nicht erst dann zulässig sind, wenn das Scheitern der Tarifvertragsverhandlungen <offi- ziell>erklärt oder festgestellt worden ist. Zur Bestimmung dieses Zeitpunkts komme es nicht auf eine materielle Be- trachtungsweise mit der Fragestellung an, ob tatsächlich alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind oder noch eine Verständigung besteht, da dies zu einer Tarifzensur führe. Vielmehr sei der Zeitpunkt des Ausschöpfens aller Verständigungsmöglichkeiten gegeben, wenn nach eigener, inhaltlich nicht nachprüfbarer Entscheidung einer der Ta- rifvertragsparteien die Verhandlungen als gescheitert an- sieht. Es bedarf keiner offiziellen, förmlichen Erklärung für das Scheitern der Verhandlungen. Die Partei, die zu Arbeitskampfmaßnahmen greift gibt zu verstehen, daß die Verhandlungen gescheitert sind.81“
Der eigentliche Einbruch in das System erfolgt dadurch, daß das BAG für die Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunk- tes, ab dem Kampfmaßnahmen eingeleitet werden können, nicht mehr darauf abstellen will, ob tatsächlich alle Ver- handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und ob weitere Verhandlungen noch Aussicht auf eine Einigung bieten82.
Früher bedeutete dies, die Einhaltung von Schlichtungsver- fahren83.
Desweiteren geht diese Entscheidung an den Auslegungsmaßstäben vorbei.
Da nun jede Tarifvertragspartei nach Ablauf der Friedens- pflicht Arbeitskampfmaßnahmen einleiten kann und dies dem Tarifgegner nicht offiziell erklären muß, führt dies zur Unsicherheit. Der Tarifgegner kann nicht klar erkennen, ob die Verhandlungen weitergeführt werden sollen und der Ar- beitskampf somit eine Unterstützungsfunktion hat, oder ob die Verhandlungen generell als gescheitert angesehen wer- den. Unter Umständen kann diese Auslegungsproblematik zu unbilligen Ergebnissen führen. Eine weitere logische Kon- sequenz wäre, daß nach der ersten Arbeitsniederlegung auch Aussperrungen zulässig wären. War die Frage 1984 nach ei- ner (Warn)-aussperrung ungeklärt, weil der Warnstreik nur ein verhandlungsbegleitendes Kampfmittel, nicht aber als ultima- ratio gesehen wurde, und die Aussperrung aus kampfparitätischen Gründen rechtswidrig war, so ist das mit der Gleichsetzung von Warn- und Erzwingungsstreiks in dieser Entscheidung anders.
Ein neueres Urteil besagt, daß Arbeitgeber auch auf Kurz- streiks mit Abwehraussperrungen antworten können, wobei eine zweitägige Aussperrung auf einen halbstündigen Streik unverhältnismäßig ist84.
Eine Gewerkschaft, die ihre eigene Kampfstärke testen will, muß nun bei jeder kurzen Arbeitsniederlegung mit Aussperrung rechnen.
Die Auffassung des BAG, die Verhandlungen zwischen den Ta- rifvertragsparteien könnten weitergeführt werden, obwohl in verhandlungsbegleitenden Streiks die Erklärung des Scheiterns liegt, ist daher widersprüchlich85.
cc)WarnstreikundUrabstimmung
Eine weitere Frage , die das Verständnis des ehemaligen Warnstreiks als Erzwingungsstreik aufwerfen kann, ist die nach dem Erfordernis einer Urabstimmung.
Mit der Gleichsetzung von Warn- und Erzwingungsstreik könnte angenommen werden, daß auch vor dem bisherigen Warnstreik eine Urabstimmung erforderlich sei, sofern die Satzung einer Gewerkschaft diese vorschreibe. Mit einer solchen Forderung werden aber unzulässigerweise aus der rechtlichen Einhebung von Warn- und Erzwingungsstreiks Konsequenzen für das innerverbandliche Recht, etwa Satzun- gen und Arbeitskampfordnungen, gezogen. Diese sollen al- lerdings nur den demokratischen Aufbau der Gewerkschaft sichern, nicht aber die Verpflichtung gegenüber Dritten.
Auch dürfte es im innerverbandlichen Recht ohne weiteres möglich sein, weiterhin unterschiedliche Definitionen für Warnstreik und Erzwingungsstreik festzuschreiben86.
Mit der h.M. ist davon auszugehen, daß im Verhältnis des sozialen Gegenspielers die Abhaltung einer Urabstimmung keine Voraussetzung eines rechtmäßigen Streiks ist.
2.Stellungnahme
Die Kehrtwende des BAG hinsichtlich der Bewertung von Warnstreiks in Form der neuen Beweglichkeit ist zu begrü- ßen, da sich dieses Arbeitkampfmittel nicht vom Erzwin- gungsstreik abgrenzt. Unverständlich bleibt allerdings die Auflockerung bzw. die Umdeutung des ultima- ratio- Prin- zips.
Der Gesetzgeber hätte die in der Entscheidung von 1984 ge- troffene Aussage zurücknehmen können und in der Ausgangsentscheidung von 1976, deren schlichter Leitsatz „Kurze Warnstreiks zur Unterstützung von Tarifverhandlungen nach Ablauf der Friedenspflicht sind zulässig“ einfach nur näher definieren müssen, was kurz iMsit87d.iesem Urteil wird eine Fehleinschätzung der wirkli- chen Lage provoziert. Die Gewerkschaften, die Warnstreik- aktionen eröffnet, muß künftig wie bei den traditionellen Erzwingungskämpfen mit der vollen Gegenwehr der Arbeitge- ber rechnen. Diese muß ebenfalls mit einer harten Antwort rechnen. Somit kann leichtes Geplänkel leicht zum großen Arbeitskampf werden88.
VII. Ergebnis:
Nachdem die Entwicklung in der Rechtsprechung aufgezeigt wurde, stellt sich nun die Ausgangsfrage, ob es den Warn- streik eigentlich noch gibt.
Das BAG hat in seinen Urteil von 1988 Warnstreiks auch in Form der „ Neuen Beweglichkeit“ dem Erzwingungsstreik gleichgesetzt. Die Konsequenzen liegen zutage. Der Warn- streik als privilegierte, d. h. von der ultima- ratio- Re- gel entbundene Arbeitskampfform ist abgeschafft. Die rechtliche Unterscheidung ist somit weggefallen, aller- dings stellt sich die Frage, warum den immer wieder bei den heutigen Streiks der Begriff des Warnstreiks Verwen- dung findet.
Zum einen kann dies mit der vorhergenannten Auslegungs- problematik zusammen hängen. Die Gewerkschaften geben des- halb den Arbeitgebern zu verstehen, daß es sich um einen Kurzstreik handelt, um somit das Risiko einer Abwehraus- sperrung zu vermeiden. Schließlich liegt es auch im Inte- resse des Arbeitgebers auf einen Kurzstreik nicht sofort mit der Aussperrung zu reagieren, da der wirtschaftliche Schaden für ihn enorm wäre.
Zweitens hängt die Verwendung des Begriffs Warnstreik mit den Satzungen der Gewerkschaften zusammen.
Für einen Erzwingungsstreik haben die meisten Gewerkschaf- ten ein erhebliches Hemmnis für den Beginn des Arbeits- kampfes, die erforderliche Urabstimmung. So heißt es in § 19 Nr. 2 der Satzung der ÖTV89:
„ Vor einem Streik muß grundsätzlich eine Urabstimmung durchgeführt werden. Die Urabstimmung darf erst durchge- führt werden , wenn alle Verhandlungsmöglichkeiten ausge- schöpft sind und keine Verständigung zustande gekommen ist. Für einen Streik ist in der Urabstimmung eine Mehr- heit von mindestens 75% der Abstimmungsberechtigten erfor- derlich.“
Diese Richtlinien sind, sofern es sich weder um staatliche Vorgaben im Drittinteresse noch um Beschränkungen der Ver- tretungsmacht handelt, von interner Bedeutung90. Bei einem Verstoß der Vertretungsmacht gegen diese Satzungsinhalte, dürfen Sanktionen gegen die Mitglieder nicht in Betracht kommen. Desweiteren sind die Mitglieder in einem solchen Fall nicht verpflichtet, dem Streikaufruf zu folgen.
In den dazu ergangenen Richtlinien wird für den Warnstreik zur Unterstützung von Tarifaktionen eine Ausnahme ge- macht91.
Somit entfällt die Bindung an eine Urabstimmung.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zahlung von Streik- geld. Bei einem Erzwingungsstreik sind die Gewerkschaften verpflichtet ihren Mitgliedern Streikunterstützung zu zah- len. Bei einem Warnstreik liegt es in derem Ermessen.
Sieht man nun die Stellung der Gewerkschaften, so fällt auf, daß sie aufgrund des Mitgliederschwundes schwächer werden und sie dadurch nicht mehr genügend Geld in ihre Streikkassen bekommen. Jedem Arbeitnehmer ist es zuzumuten mal eine Stunde keinen Lohn zu bekommen, um somit die Streikkassen zu schonen. Die sich aufdrängende Frage ist, inwieweit der Gesetzgeber nun in diese Satzungen eingrei- fen darf, da die Gewerkschaften frei entscheiden können, wann sie bei einem Warnstreik zahlen und die Mitglieder somit deren Willkür unterworfen wären. Allerdings würde die Beantwortung der Frage den vorgegeben Rahmen sprengen, so daß die Frage im Raum bleiben muß.
Im übrigen sieht es in der Praxis meistens so aus, daß der Arbeitgeber bei einem Warnstreik den Lohn weiterzahlt, weil es mit erheblichen Aufwand verbunden wäre, festzu- stellen, wer, wann, wo, gestreikt hat.
Die Unterscheidung von Warn- und Erzwingungsstreik in den Satzungen ist also von großer Bedeutung, wobei wie bereits erwähnt, rechtlich keine Unterschiede mehr gemacht werden. Mit der Formulierung „ Warnstreiks auch in Form der neuen Beweglichkeit“, hat das BAG auch den traditionellen Warn- streik aus der Rechtslandschaft verbannt.
Folglich bleibt nur festzustellen:“Warnstreiks gibt es nicht mehr!“
Literaturverzeichnis
Adomeit, Klaus Das Warnstreikurteil- ein Warnsignal Veröffentlicht in: NJW 1985, S. 2515- 2517
Buchner, Herbert Der „Warnstreik“ nach der Bundesar- beitsgerichtsentscheidung vom 21. Juni 1988
Veröffentlicht in: BB 1989, S. 1334- 1338
Brox, Hans
Brox, Hans; Rüthers, Bernd
Arbeitsrecht
11. Auflage 1993 Stuttgart - Berlin - Köln
Arbeitsrecht
12. Auflage1995 Stuttgart- Berlin- Köln
Däubler, Wolfgang Arbeitskampfrecht
1. Auflage 1984 Baden - Baden
Das Arbeitsrecht 1
14. Auflage 1990 Hamburg
Ehmann, Horst Vom Arbeitskampfrecht zur Mitbestim- mung- Entwicklung in der Krise des Sozi- alismus
Veröffentlicht in: NZA 1991, S. 1- 40
Dörner; Luczak; Wildschütz Arbeitsrecht in der anwaltlichen und ge- richtlichen Praxis 1997
Dorndorf, Eberhard Arbeitskampf als Tarifpolitik und Ultima- ratio- Prinzip
Veröffentlicht in: AuR 1990, S. 65- 77
Dütz, Wilhelm Arbeitsrecht
Auflage 1990 München
Glaubitz, Werner Neue Form der Tarifauseinandersetzung durch sog. Warnstreiks
Veröffentlicht in: DB 1982, S. 1514- 1517
Groggert, Christian Der ultima- ratio- Grundsatz im Warn- streikrecht des Bundesarbeitsgerichts Veröffentlicht in: DB 1988, S. 2097- 2101
Götz, Hilmar Grundzüge des Arbeitsrechts 2 Bd. 2 Kollektives Arbeitsrecht Auflage 1989
München
Halbach, Günter; Paland, Norbert; Schwedes, Rolf; Wlotzke, Otfried
Übersicht über das Arbeitsrecht
5. Auflage 1994 Bonn
Hanau, Peter; Adomeit, Klaus Arbeitsrecht
11. Auflage 1994 Neuwied - Kriftel - Berlin
Heinze, Meinhard Der Warnstreik und die neue Beweglich- keit
Veröffentlicht in: NJW 1983, S. 2409- 2418
Hirschberg, Lothar Der Warnstreik nach der jüngsten Ent- scheidung des Bundesarbeitsgerichts Veröffentlicht in: RdA !989, S. 212- 216
Hoffmann, Rudolf, Aktuelle Rechtsfragen des Warnstreiks Veröffentlicht in: DB 1981, S. 1188- 1190
Hohenstatt, Klaus-Stefan; Schaude, Rainer
Abschied vom ultima-ratio-Prinzip? Veröffentlicht in: DB 1989, S. 1566- 1571
Hoyningen-Huene, Gerrick von Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen aktuel-
ler Arbeitskampfmittel der Gewerkschaf- ten
Veröffentlicht in JuS 1987, S. 505-513
Lieb, Manfred
Löwisch, Manfred
Arbeitsrecht
5. Auflage 1994 Heidelberg
Warnstreik und kein Ende? Veröffentlicht in ZfA 1990, S. 357- 375 Arbeitsrecht
3. Auflage 1991 Düsseldorf
Loritz, Karl- Georg Das Bundesarbeitsgericht und die >Neue
Beweglichkeit>
Veröffentlicht in: ZfA 1985, S. 185- 212
Mayer- Maly, Theo Der Warnstreik
Veröffentlicht in: BB 1981, S. 1774- 1780
Picker, Eduard Ultima-ratio- Prinzip und Tarifautonomie Veröffentlicht in: RdA 1982, S. 331- 355
Arbeitskampfrecht und Gesamtrechtsord- nung
Veröffentlicht in: DB: 1989, Beilage 16, S. 1-16
Rebel, Wolfgang Die Zulässigkeit von Warnstreiks Veröffentlicht in: RdA 1979, S. 207- 216
Reuter, Dieter Die unfaßbare „ Neue Beweglichkeit“- BAG, NJW 1985, S. 19- 24
Richardi, Reinhard Arbeitsrecht
6. Auflage 1991 Heidelberg
Richardi, Reinhard; Wlotzke, Otfried Münchner Handbuch Arbeitsrecht Bd.3
Kollektives Arbeitsrecht München 1993
Rögler, Richard Einführung in das Arbeitsrecht
1. Auflage 1994 Freiburg
Rüthers, Bernd Der Abbau des „ ultimaratio“-Gebotes im Arbeitskampfrecht durch das Bundesar- beitsgericht
Veröffentlicht in DB 1990, S. 113- 123
Schaub, Günter Arbeitsrechts-handbuch
6. Auflage1987 München
Scholz, Ruppert Verfassungsrechtliche Grundlagen des Arbeitskampfes,
Veröffentlicht in ZfA 1990, S. 377-401
Schmid/ Trenk Grundzüge des Arbeitsrechts Auflage 1981
Söllner, Alfred Grundriß des Arbeitsrechts
11. Auflage1994
Zöllner, Wolfgang; Loritz, Karl- Georg
München Arbeitsrecht
4. Auflage 1992
München
[...]
1 Glaubitz, DB 1982, S. 1514ff; Lieb,NZA ,1985, S. 265ff; Reuter, JuS 1986, S. 19ff; Richardi, JZ 1985, S. 410ff
2 vgl. Söllner, § 12 I 2, S. 85
3 Brox, Kapitel 10, Rn. 302
4 Söllner, § 11 II 2
5 vgl. Brox, Rn. 302
6 vgl. Löwisch, Rn. 233
7 Hanau/ Adomeit, C III 3
8 vgl. Schmid/ Trenk, § 25, S. 260
9 Schmid/ Trenk, § 25 S. 260
10 Brox/ Rüthers; Rn 303
11 Schmid/ Trenk, § 26, S. 277
12 Brox/ Rüthers, Rn. 304
13 Däubler, Arbeitskampfrecht, 1984, Rn. 102
14 Zöllner, § 40 II 2
15 Zöllner, § 40 II a, vgl. Schmid/ Trenk, § 25, S. 265
16 vgl. Lieb, § 7I 2a, vgl. Brox, Rn. 306
17 vgl. Brox, Rn. 308 m.w.N.
18 Hoyningen-Huene, JuS 1987, S. 506
19 Hanau/ Adomeit, C III,5b
20 20 vgl. Lieb, §7I 2a bb m.w.N.
21 21 vgl. Dütz, § 10 III, Rn. 649
22 vgl. Lieb, § 7 I , 2 a bb; Schaub, § 193 , 1 II 5d
23 Brox/ Rüthers, Rn. 296
24 vgl. BAGE vom 21.4.1971, Bd. 23, 292- 320
25 vgl. Brox, Rn. 313
26 vgl. Dütz, Rn. 608
27 Brox, Rn. 313
28 vgl. BAG Großer Senat vom 21.4.1971, BAG Bd. 23, 292- 320; Löwisch, §9, Rn. 346
29 vgl. Dörner/ Luczak/ Wildschütz, G. Rn. 27
30 Brox/ Rüthers, Rn. 318
31 Zöllner/ Loritz, § 40 VI 4a,
32 vgl. Zöllner/ Loritz, § 40 VI 4a aa
33 BAG vom 21.4.1971, BAGE Bd. 23, 292- 320
34 Dörner/ Luczak/ Wildschütz, G Rn. 32
35 Zöllner/ Loritz, § 40 VI. 4b
36 vgl. Brox/ Rüthers, Arbeitsrecht,Rn. 321
37 BAG vom 10.6.1980; in BAGE Bd. 33, S. 140- 159
38 Däubler, Wolfgang; Das Arbeitsrecht I, S. 275;
39 Hoffmann, DB 1981, S. 1188
40 Glaubitz, DB 1982, S. 1514; m.w. N.
41 NJW 77, 1079; BB 77, 595; BAG vom 17.12.1976, Bd. 28 , 295- 302
42 vgl. BAG vom 17.12.1976
43 Mayer-Maly, BB 1981, S. 1775
44 Picker, RdA 1982, S. 337
45 Vgl. BAG vom 17.12.1976
46 Vgl. Mayer- Maly, BB 1981, 1775; Löwisch, BB 1982, 1375
47 Rüthers, DB 1990, 117
48 Vgl. BAG vom 12.9.1984, in BAGE Bd. 46, S. 364- 394; in DB 1984, S. 2563; JuS 1986, S.19ff, Anm.Reuter ; NJW 1985, S. 85; NZA 1984, S. 393
49 Rüthers, Db 1990, S. 117
50 Vgl.Glaubitz, DB 1982, S. 1517
51 vgl. Hirschberg, RdA 1989, S. 213
52 vgl. Hirschberg, RdA 1989, S. 213
53 BAGE vom 12.9.1984, Bd. 46, S. 322- 358
54 BAGE, Urteil vom 12.9.1984; vgl. JuS 1986 S. 19 Reuter; DB 1984, S. 2563f, NZA 1984, S. 393, NJW 1985, S. 85,
55 BAG vom 12.9.1984, s.o.
56 BAG vom 12.9.1984, s. o.
57 BAG vom 12.9.1984, s. o.
58 Bobke, BB 1982, S. 865ff; Däubler, ArbR 1, 1985, S. 222;
59 Picker, RdA 1982, S. 331ff; Zöllner/ Loritz, $ 40 VI. 4bb
60 Heinze, NJW 1983, S. 2409; Loritz, ZfA 1985, S. 199; Mayer-Maly, BB 1981, S. 1774; Reuter; JuS 1986, S. 19ff
61 Löwisch, BB 1982, 1375
62 Löwisch, BB 1982, 1376
63 Vgl. Fn. 61-64
64 Heinze, NJW 1983, S. 2409; Rebel, RdA 1979, S. 207; Hanau, DB 1982, S. 377
65 Hanau, DB 1982, S. 377; Heinze, NJW 1983, S. 2409
66 Heinze, NJW 1983, S. 2409; Loritz, ZfA 1985, S. 199; Mayer-Maly, BB 1981, S. 1774; Reuter, JuS 1986, S. 19ff
67 Loritz, ZfA 1985, S. 201
68 vgl. Picker, DB 1985, Beilage 5, S. 1ff; vgl. Hanau, DB 1982, S. 377
69 BAG vom 29.1.1985- 1 AZR 179/ 84
70 RdA 85, 252; NZA 85, 508
71 BAGE 28, 295- 302
72 BAG- Urteil vom 21.6.1988
73 BAG- Urteil vom 8.6.1982- 1 AZR 464/ 80= DB 1982, S. 1827
74 BAG-Urteil vom 21.6.1988- 1 AZR 651/86; NZA 1988, 846-850
75 BAGE 58, S. 364- 394
76 Hirschberg, RdA 1989, S. 214
77 Buchner, BB 1989, S.1334
78 BAG 21.6.1988
79 „BAG 21.6.88
80 Scholz, ZfA 1990, S. 402; Buchner, BB 1989, S. 1334; Lieb; Arbeitsrecht, § 7 I 1
81 BAG vom 21. 6.1988
82 Buchner, BB 1989, S. 1335
83 Scholz, ZfA 1990, S. 403
84 BAG vom 11.8.1992, NZA 1993, S. 39-42
85 Lieb, Arbeitsrecht, § 7 I , S. 172
86 Vgl. Hirschberg;RdA 1989, S. 212 m.w.N.
87 BAG -Urteil vom 21.6. 1988, JZ 1989, S. 92, Anm. Löwisch und Rieble
88 Picker, DB 1989, Beilage 16, S. 6
89 In der ab 28.5.1991 gültigen Fassung, abgedruckt im ötv- magazin 1991 Nr. 7/8, S. 19ff
90 Richardi, Reinhard; Wlotzke, Otfried, § 278, Rn. 112
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Warnstreik und seine Rolle im Arbeitskampfrecht?
Der Warnstreik ist ein arbeitskampfrechtliches Thema, das in den letzten Jahren diskutiert wurde. Die Urteile des BAG (Bundesarbeitsgericht) zum Warnstreik sind umstritten. Ein Arbeitskampf findet statt, wenn Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite kollektive Maßnahmen zur Störung der Arbeitsbeziehungen ergreifen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Beteiligte sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die als Kollektiv agieren müssen. Der Streik ist ein wichtiges Arbeitskampfmittel der Arbeitnehmerseite, während Arbeitgeber mit Aussperrung reagieren können.
Welche Rechtsgrundlagen hat der Arbeitskampf?
Das Recht des Arbeitskampfes ist gesetzlich nicht geregelt, sondern entsteht durch Richterrecht. Internationale Vereinbarungen wie die Europäische Sozialcharta (ESC) regeln das Recht auf kollektive Maßnahmen. Im Grundgesetz (GG) wird der Arbeitskampf in Artikel 9 III erwähnt, wobei die Tarifautonomie gewährleistet wird. Einige Landesverfassungen erwähnen Streik und Aussperrung. Gesetze wie § 2 I Nr. 2 ArbGG und § 74 II BetrVG weisen allgemein auf den Arbeitskampf hin, aber es gibt keine detaillierten gesetzlichen Vorschriften.
Welche Voraussetzungen müssen für die Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfes erfüllt sein?
Da es an gesetzlichen Vorschriften fehlt, hat die Rechtsprechung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsrechtswissenschaft Normen entwickelt, um die Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfes zu beurteilen. Der Arbeitskampf muss von einer tariffähigen Partei (Gewerkschaften, Arbeitgeber, Arbeitgebervereinigungen) getragen werden. Das Ziel muss tariflich regelbar sein, politische Streiks sind daher rechtswidrig. Die Friedenspflicht muss während der Laufzeit des Tarifvertrages eingehalten werden.
Welche allgemeinen Grundsätze gelten für eine rechtmäßige Kampfführung?
Der Große Senat des BAG entwickelte 1971 die allgemeinen Grundsätze rechtmäßiger Kampfführung. Hierzu zählen das Gebot der Kampfparität und das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Kampfparität bedeutet, dass ein Verhandlungs- und Kampfgleichgewicht zwischen den Tarifparteien bestehen muss. Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass Arbeitskampfmaßnahmen geeignet und erforderlich sein müssen, um wirtschaftlichen Druck auszuüben, und die Beeinträchtigungen Dritter nicht außer Verhältnis zu dieser Funktion stehen dürfen. Es gilt das Ultima-Ratio-Prinzip, wonach der Arbeitskampf nur eingesetzt werden darf, wenn schonendere Mittel nicht zum Ziel führen.
Welche Kampfverbote gibt es?
Der Einsatz der Kampfmittel und die Art der Kampfführung dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Dazu gehören das Streikverbot für Beamte, Kampfhandlungen, die gegen das Strafrecht verstoßen (Nötigung, Körperverletzungen) und Arbeitskampfmaßnahmen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber (§ 74 II 1 BetrVG).
Wie hat sich die Rechtsprechung zum Warnstreik entwickelt?
Warnstreiks waren in den sechziger Jahren üblich. Das BAG-Urteil vom 17.12.1976 erkannte kurze Arbeitsniederlegungen während laufender Tarifverhandlungen als rechtmäßig an, sofern die Friedenspflicht abgelaufen war. Das Warnstreikurteil von 1976 führte zur Entwicklung eines neuen Arbeitskampfkonzepts, der „Neuen Beweglichkeit“, bei dem gezielt neuralgische Punkte im Produktionsbereich bestreikt werden. Das BAG-Urteil vom 12.9.1984 stellte auf das äußere Erscheinungsbild ab und sah keinen wesentlichen Unterschied zwischen sporadischen und geplanten Warnstreiks.
Was besagt das BAG-Urteil vom 21.6.1988 und welche Konsequenzen hat es?
Das Urteil von Juni 1988 lehnt eine Unterscheidung zwischen Warn- und Erzwingungsstreiks ab und stellt beide unter die gleichen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen. Das BAG ordnet das Ultima-Ratio-Prinzip dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu und will keine Ausnahme für den Warnstreik mehr zulassen. Dies bedeutet, dass Arbeitskampfmaßnahmen nicht erst dann zulässig sind, wenn das Scheitern der Tarifvertragsverhandlungen offiziell erklärt wurde, sondern wenn eine der Tarifvertragsparteien die Verhandlungen als gescheitert ansieht. Diese Entscheidung führt zu Unsicherheit, da der Tarifgegner nicht klar erkennen kann, ob die Verhandlungen weitergeführt werden sollen. In der Literatur wird kritisiert, dass diese neue Auslegung des Ultima-Ratio-Prinzips möglicherweise zu unbilligen Ergebnissen führen kann und eine Aussperrung seitens des Arbeitgebers nach Arbeitsniederlegung des Arbeitnehmers zulässig macht.
Was ist das Ergebnis der Analyse in Bezug auf Warnstreiks?
Das BAG hat Warnstreiks in Form der „Neuen Beweglichkeit“ dem Erzwingungsstreik gleichgesetzt. Der Warnstreik als privilegierte Arbeitskampfform ist somit abgeschafft. Rechtlich gibt es keinen Unterschied mehr, allerdings wird der Begriff des Warnstreiks weiterhin verwendet. Dies hängt mit Auslegungsproblematiken und den Satzungen der Gewerkschaften zusammen. Für einen Erzwingungsstreik ist in den meisten Gewerkschaften eine Urabstimmung erforderlich. Die Unterscheidung von Warn- und Erzwingungsstreik in den Satzungen ist also von großer Bedeutung, wobei rechtlich keine Unterschiede mehr gemacht werden. Folglich bleibt nur festzustellen: "Warnstreiks gibt es nicht mehr!".
- Quote paper
- Martina Jordan (Author), 1998, Warnstreiks - Gibt es die noch ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98794