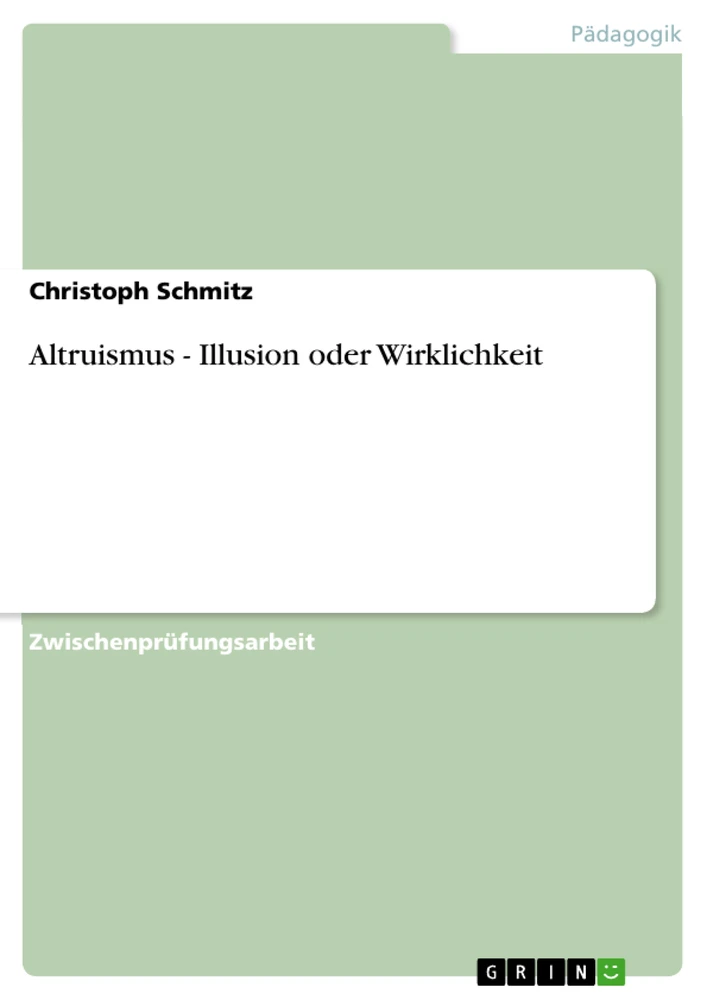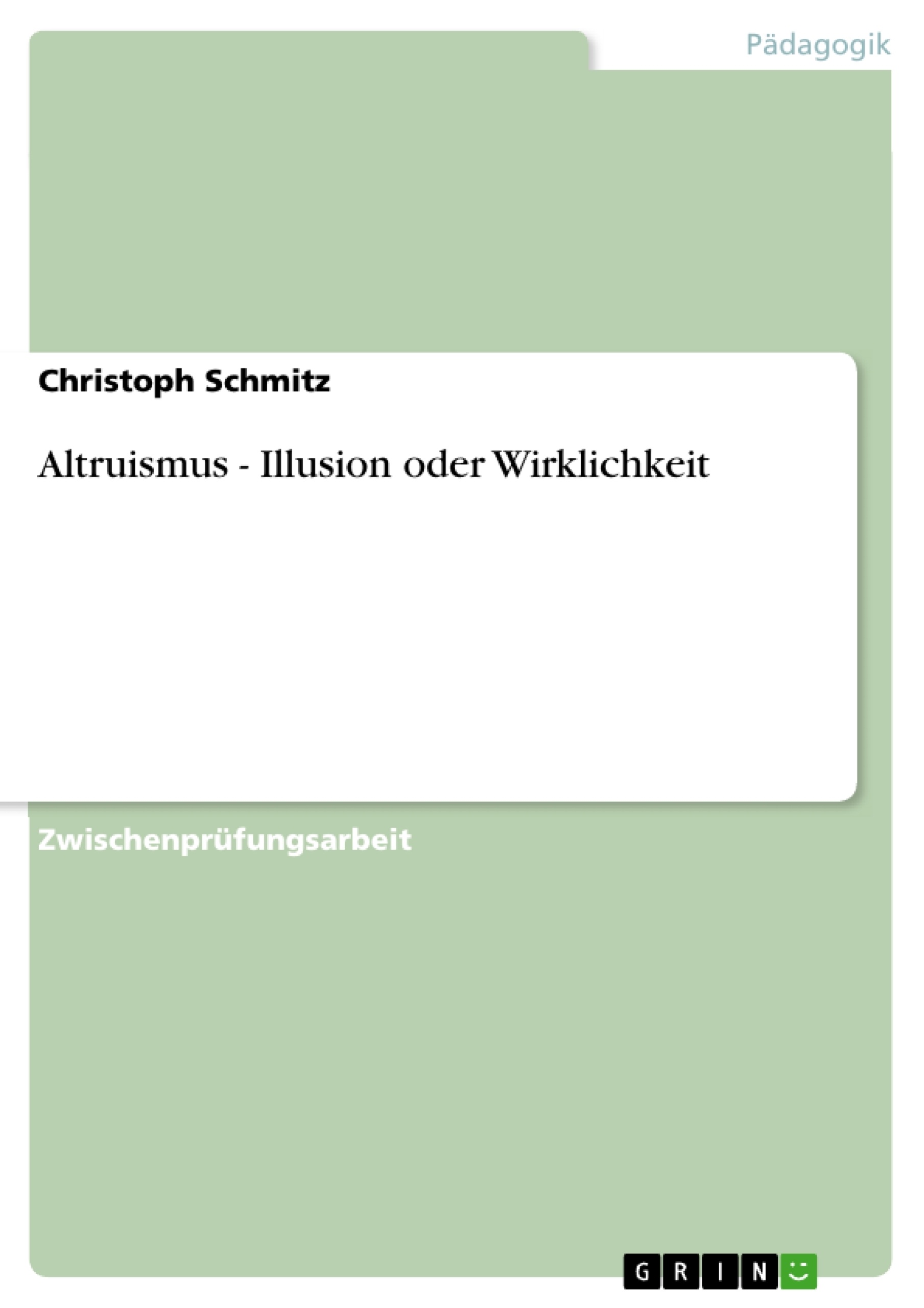Altruismus, das scheinbar selbstlose Handeln, hat Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen seit langem fasziniert und herausgefordert. Diese Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Ansätzen zur Erklärung von Altruismus, darunter der soziobiologische, soziopsychologische und philosophische Ansatz sowie verschiedene Experimente und Theorien.
Beginnend mit einem Zitat von Henry David Thoreau, das den skeptischen Blick auf altruistisches Handeln einfängt, wird die Definition von Altruismus diskutiert. Dabei werden die Unterschiede zwischen scheinbarem Altruismus, reziprokem Altruismus und echtem Altruismus beleuchtet, um zu klären, ob selbstloses Handeln wirklich existiert oder ob es letztlich von Eigeninteresse motiviert ist.
Die Argumente der Soziobiologie, die behauptet, dass Altruismus letztlich nur eine Form von Täuschung ist, werden betrachtet, und es wird hinterfragt, ob diese Ansichten mit der Vielfalt des menschlichen Verhaltens und der Komplexität sozialer Interaktionen übereinstimmen.
Im soziopsychologischen Ansatz wird untersucht, wie die Sozialwissenschaften dazu neigen, altruistisches Verhalten als Ausnahme zu betrachten und stattdessen das Paradigma des Eigeninteresses zu unterstützen. Ein Blick wird auf die Experimente von C. Daniel Batson und seine Versuche geworfen, die Motive hinter altruistischem Handeln zu verstehen.
Schließlich wird der philosophische Ansatz betrachtet, der die verschiedenen Formen von Altruismus unterscheidet und die Möglichkeit erwägt, dass echter Altruismus in der menschlichen Gesellschaft existieren kann. Die Bedeutung psychologischer und evolutionärer Aspekte wird diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der soziobiologische Ansatz: Der wahre Egoist kooperiert
2.1 Der Egoismus der Gene
2.2 Reziproker Altruismus
3. Der Soziopsychologische Ansatz: Das Paradigma des Eigeninteresses oder die Verneinung altruistischer Motivation
3.1 Die Sicht der Sozialwissenschaften tendiert gegen Altruismus
3.2 Die Batson-Experimente: Die Sozialwissenschaften entdecken den Altruismus
4. Der philosophische Ansatz: Das Paradoxon Altruismus
4.1 Psychologischer Altruismus und Evolutionärer Altruismus - Formulierung eines Paradoxons
4.2 Ein Auflösungsversuch des Paradoxons
4.3 By-product theory
4.4 Continuing adaptation theory
5. Zusammenfassung
Literatur
1. EINLEITUNG
"If I knew for a certainty that a man was coming to my house with the conscious design of doing me good, I should run for my life."Henry David Thoreau1
Daß wir Menschen uns gegenseitig helfen, ist ein normaler alltäglich zu beobachtender Vorgang. Solange es uns nichts "kostet" zu helfen, oder wir helfen, weil wir wissen, daß uns die gleichen Leute auch in anderen Situationen zur Seite stehen, brauchen wir nicht großartig nach den Gründen für die Hilfe zu suchen. Dieses kooperative Verhalten bringt allen Beteiligten in der Summe nur Vorteile. Kooperation und Arbeitsteilung finden sich schon auf Zellebene und sind Grundvoraussetzungen für das Entstehen des uns bekannten Lebens.2
Wie aber kann selbstloses Handeln erklärt werden, bei dem der Handelnde "draufzahlt" und der, dem das Handeln zugute kommt, der große Nutznießer ist. Wird letzterer sich irgendwann revanchieren, ist die Selbstlosigkeit nur eine reine Zeitfrage. Was ist aber, wenn der Helfende nicht damit rechnen kann, daß ihm in Zukunft von dieser Person geholfen wird, oder es auch gar nicht erwartet. In einem solchen Fall können wir von echtem Altruismus sprechen, im ersten Fall nur von scheinbarem oder reziproken Altruismus.
Unter Altruismus verstehen wir selbstloses Handeln. Ich handel dann selbstlos, wenn ich meine eigenen Interessen und Bedürfnisse nicht zur Grundlage meines Handelns mache, sondern alleine im Sinne des Wohlergehens meines Gegenübers agiere. Die extremste Form kann sogar zur Gefährdung des eigenen Lebens führen, wenn z.B. jemand in ein reißendes Wasser springt, um einen anderen zu retten.
Wir werden sehen, daß wir verschiedene Arten von Altruismus genau voneinander unterscheiden müssen und daher auch unterschiedliche Definitionen für die Typen von Altruismus finden müssen.
In dieser Arbeit möchte ich das Problem des Altruismus näher beleuchten.
Was ist Altruismus, gibt es echten Altruismus oder steckt dahinter letztendlich doch nur Eigennutz?
Was ist reziproker Altruismus und was ist Nepotismus? Ist der Verwandtschaftsgrad ein Maß für die Häufigkeit altruistischen Verhaltens?
Ist es denkbar, daß echter Altruismus im Laufe der Evolution des Menschen entstanden sein kann, als eine evolutionär stabile Strategie?
Wann können wir von echtem Altruismus sprechen?
Wird altruistisches Verhalten unter Menschen nur deshalb gezeigt, weil ein wohltätiger Akt mit Anerkennung belohnt wird?
Daß es echten Altruismus, Altruismus ‚sensu stricto‘, geben könnte, wird spätestens seit dem Aufkommen der Soziobiologie bestritten. Begründet wird dies mit dem Paradigma des selbstbezogenen Eigennutz. Reiner Altruismus ist reine Heuchelei.
Dahl z.B. sagt: "Kratz einen Altruisten, und du siehst einen Heuchler bluten".3
Ich werde auf die Position der Soziobiologie näher zu sprechen kommen. Sie bietet sehr gute Erklärungsansätze für eine Vielzahl von natürlichen Verhaltensweisen. Wir müssen aber hinterfragen, ob das Konzept des reziproken Altruismus, was als Erklärung für Beobachtungen im Tierreich schlüssig erscheint, menschliches Verhalten ausreichend erklären kann, und ob es sich bei dieser Form um einen Altruismus ‚sensu stricto‘ handelt.
Im soziopsychologischen Ansatz werde ich zunächst aufzeigen, daß die Sozialwissenschaften von dem Dogma des Selbstinteresses geprägt sind. Und das, obwohl ihr Begründer Auguste Comte 1875 formulierte "the greatest problem of life [was achieving] the ascendancy of altruism over egoism".4 Ironischerweise wurde gerade die Wissenschaft, die dem Altruismus zum Durchbruch verhelfen sollte, zum Prediger seines Gegenteils.
Gegen diese Sicht stellen sich die Versuche von C. Daniel Batson und seinen Mitarbeitern, die als die bislang gründlichsten gelten, die im Bereich Altruismusforschung durchgeführt wurden. Dabei werde ich mich auch mit den Motiven für altruistisches Verhalten auseinandersetzen.
Der philosophische Ansatz führt uns zu einer genauen Trennung und Begriffsklärung der Typen von Altruismus. Der Aufsatz von Neven Sesardic will zeigen, daß echter Altruismus in der menschlichen Gesellschaft entstehen und sich durchsetzen kann. Er unterscheidet zwischen einem psychologischen und einem evolutionären Altruismus und erläutert ihren Zusammenhang.
Zum Schluß möchte ich auf Grundlage der zuvor vorgestellten Modelle meine Vorstellung von der Möglichkeit des Altruismus erläutern.
2. DER SOZIOBIOLOGISCHE ANSATZ: DER WAHRE EGOIST KOOPERIERT
"Altruism is defined in biology, as in everyday life, as a selfdestructive behavior for the benefit of other." E.O. Wilson
Im Februar 1978 wurde anläßlich der Jahresversammlung der American Association for the Advancement of Science in Washington das Thema Soziobiologie behandelt. Der Gründervater dieser Disziplin, Edward O.Wilson, hielt dort einen Vortrag. Als er mit seiner Rede begann, marschierte ein Mitglied der Gruppe des International Committee against Racism zum Podium und übergoß ihn mit Wasser. Dieser trocknete sein Gesicht mit einem Taschentuch und setzte seine Rede fort. Die im Vortragssaal entstandene Unruhe legte sich, und am Ende erntete Wilson stehenden Applaus; seine Gegner hatten sich zurückgezogen.5
Dieser Vorfall zeigt, daß Edward O. Wilson mit seinem 1975 erschienenen Buch "Sociobiology: The New Synthesis" heftige und zum Teil auch unsachliche Diskussionen ausgelöst hat. Wilson behauptet darin, daß menschliches Verhalten und auch Sozialverhalten von biologischen und genetischen Faktoren bestimmt werde. Er folgerte daraus, daß die Biologie früher oder später andere Wissenschaften wie die Soziologie und die Philosophie schlucken werde. Diese Forderung mußte bei Vertretern dieser Wissenschaftsgebiete natürlich Empörung hervorrufen, einerseits weil sie ihre Ressorts verteidigen müssen, andererseits schien der Gedanke, der Mensch sei eine Marionette seiner Gene, unhaltbar. An die Macht egoistischer Gene, wie von R. Dawkins in seinem Buch "The selfish gene" (1976) beschrieben, konnte (oder wollte ?) man nicht glauben. Die Annahmen der Soziobiologie fußen auf den Grundlagen Darwins und seiner Evolutionstheorien und widersprechen entschieden dem Paradigma der Arterhaltung, das von der klassischen Ethologie, als Vertreter sei Konrad Lorenz genannt, postuliert wurde.
Ich möchte in dieser Arbeit nicht darlegen, welche Seite Recht haben könnte und welche nicht. Nur sollte der Soziobiologie nicht vorgeworfen werden, sie betreibe einen Sozialdarwinismus und vertrete eine düstere Ideologie. Vielmehr sollte sie zunächst als das gewertet werden, was sie ist, nämlich ein Zweig der Biologie, der nach den Methoden der Naturwissenschaft agiert und dessen Erkenntnisse naturwissenschaftlichem Anspruch genügen müssen und nicht geisteswissenschaftlichem, sie ist also ideologieneutral. Obwohl man Wilson vorhalten muß, durch seine Äußerungen diese Grenze überschritten zu haben.
2.1Der Egoismus der Gene
Die Soziobiologie hat interessante Erkenntnisse über den Einfluß der Gene auf das Verhalten zutage gefördert. Im deutschsprachigen Raum sind beispielsweise Arbeiten von Christian Vogel und Volker Sommer zu nennen, die Studien an sozial lebenden Affen durchgeführt haben. Sie bieten Erklärungen für solche Phänomene wie Infantizid, Schwangerschaftsabbruch, unterschiedliche Sexualmoral von Männchen und Weibchen und die Tötung von Artgenossen. Letzteres ist beispielsweise eine Erscheinung im Tierreich für die die klassische Ethologie keine Erklärung finden konnte. Lorenz nannte dies eine pathologische Erscheinung.
Der Kern soziobiologischer Ansichten läßt sich so zusammenfassen:
"Die Soziobiologen verfechten strikt die Ansicht, daß nur 'genetischer Eigennutz' via 'natürlicher Selektion' entstanden sein kann und daß somit auch der biologische Kern unserer praktizierten Moralen von Anbeginn an nur 'genetischer Eigennutz' gewesen sei. Kooperation und jede Form von 'Altruismus' sozial lebender Organismen habe sich letztendlich aus dem - auch den mathematischen Spieltheoretikern vertrauten - Prinzip: 'Der wahre Egoist kooperiert!' entwickelt."6
Das der biologischen Evolution zugrunde liegende Prinzip heißt Konkurrenz, und zwar genauer gesagt, innerartliche Konkurrenz zwischen Artgenossen um möglichst gute Fortpflanzungschancen. Die natürliche Selektion arbeitet über den differentiellen Reproduktionserfolg. Dieses Programm steckt zwangsläufig in unseren Genen, es bedarf also keiner besonderen Intention. Wer am erfolgreichsten dieses Programm umsetzt, wird mit den zahlreichsten Nachkommen gesegnet. Das einzige, was zählt, ist die Weitergabe der eigenen Gene.
Es gibt eine altbaltische Fabel, die den Titel Krähenweisheit trägt, welches diese strenge evolutionsbiologische Sichtweise darstellt:7
"Eine Krähe hat auf einer Insel ihr Nest gebaut und füttert dort ihre drei Jungen groß. Eines Nachts zieht ein gewaltiger Gewittersturm auf. Die Insel wird überflutet, schon steigt das Wasser den Stamm des Nestbaums hinauf. Die Krähe, erkennend, daß sie ihre Kinder nur vor dem Tod bewahren kann, wenn sie diese von der Insel aufs Festland bringt, und zugleich wissend, daß sie kaum alle drei Jungen wird retten können, ergreift das erste Junge und fliegt mit ihm über das Meer. Unterwegs fragt sie ihr Kind: "Wie wirst du mir später einmal vergelten, daß ich dich jetzt vorm sicheren Tod errette?". Daß Junge antwortet: "Mutter, wenn ich groß bin und du bist alt und schwach, dann werde ich dich pflegen und verwöhnen." "Du sprichst falsch!" ruft die Mutter, "du verdienst nicht, gerettet zu werden", und läßt ihr Kind in das tosende Meer fallen. Schnell fliegt sie zurück, ergreift das nächste Junge - die Flut hat das Nest schon fast erreicht. Der Dialog wiederholt sich, das zweite Junge gibt die gleiche Antwort wie das erste, und wieder läßt die Mutter das Kind fallen. Dem letzten Kind steht das Wasser schon am Hals, als die Mutter es ergreift. Wieder fragt sie: "Wie wirst du mir dereinst meine Tat vergelten?" "Mutter" antwortet das Kind, "wenn ich erwachsen bin, werde ich meinen Kindern gegenüber genauso handeln wie du jetzt mir gegenüber". "Du sprichst gut!" ruft die Mutter, "du verdienst, gerettet zu werden. Bei uns Krähen sorgt man nicht für die alternden Eltern, sondern für die künftige Generation!" und trägt das Junge ans rettende Land.
Die Fabel zeigt, daß es nicht um die eigene Langlebigkeit oder das Wohlergehen im postreproduktiven Alter geht. Was einzig zählt, ist die Weitergabe der eigenen Gene, das Individuum ist dazu geschaffen, dies zu gewährleisten.
Es gilt für das Individuum, sich eigennützig und egoistisch um seinen Fortpflanzungsvorteil zu kümmern. Dabei ist (fast?) jedes Mittel recht, sei es Kampf, Kooperation oder auch altruistisches Verhalten.
Das letztere erscheint wie ein Widerspruch. Das uneigennützige Helfen eines anderen Individuums geht zu Lasten der eigene Reproduktionschancen. Da dies zu Lasten der eigenen Gene geht, und damit zu Lasten der Reproduktionserfolges der Gene, die für das altruistische Verhalten codieren, kann sich ein solches Verhalten in der Selektion nicht durchsetzen.
Im Darwinschen Sinne kann es somit keinen Altruismus geben, der die eigenen Fortpflanzungschancen verringert.
2.2 Reziproker Altruismus
Reziproker Altruismus ist nur scheinbar uneigennützig, in Wahrheit versteckt sich dahinter auch der Egoismus der Gene.
"Ein reziproker Altruist ist jemand, der zunächst auf die volle Ausschöpfung seiner persönlichen Reproduktionschancen zugunsten Dritter verzichtet. Er wird dadurch belohnt, daß man seine Opferhaltung bei anderer Gelegenheit erwidert. Die Nettobilanz solch gegenseitiger Unterstützung weist einen Fitneßgewinn für alle Beteiligten aus, der die ursprünglichen altruistisch entstandenen Kosten mindestens ausgleicht."8
Für diese Haltung gibt es im Alltagssprachgebrauch viele Phrasen: "Wie du mir, so ich dir", "Kratz mir den Rücken, dann kratz ich dir den Rücken", "Eine Hand wäscht die andere" usw. Dieses auch alstit for tatbekannte Verhalten erscheint uns also nicht ungewöhnlich.
Was wir solchen Wortspielen entnehmen ist, daß es sich letztendlich nicht wirklich um altruistisches Verhalten handelt, sondern sich dahinter wieder der Eigennutz versteckt, wie La Rochefoucauld treffend bemerkte:
"When we help others in order to commit them to help us under similar circumstances, [the] services we render them are, properly speaking, services we render to ourselves in advance."9
Rawls bevorzugt es daher, nicht von reziproken Altruismus sondern besser von Reziprozität zu sprechen.10
Diese Haltung erfordert, daß der, der gibt, auch wirklich erwarten kann, daß er in mindestens gleichem Maß zurückbekommt. Nur unter dieser Bedingung kann das Prinzip der Gegenseitigkeit funktionieren. Da man bei einem Fremden nicht sicher sein kann, wie er reagieren wird, findet sich dieses Verhalten vornehmlich bei Gruppen, in denen sich die Individuen kennen, bzw. in der Lage sind, eigene Gruppenangehörige von anderen unterscheiden zu können. Das gilt im besonderen Maße für menschliche Sozietäten, bei Tieren ist dies schwerer zu belegen. Es existieren aber Arbeiten von Primatologen, die solches Verhalten aufzeigen.11
2.3 Inclusive fitness und kin-selection
Unterstützung eines anderen im Tierreich läßt sich vornehmlich in Gruppen beobachten. Diese wird aber nur dann für das Individuum sinnvoll sein, wenn auch ein genetischer Vorteil dabei gesichert ist. Um das zu erklären, beschäftigt sich die Soziobiologie mit der Gesamtfitness oderinclusive fitness. Gesamtfitness setzt sich zusammen aus der durch eigene Fortpflanzung erreichten Eignung (auch Darwin-fitness genannt) und der durch Gruppenunterstützung erzielten Eignung. Es gilt die Formel: Gesamteignung ist die direkte Eignung plus indirekte Eignung.12 Also nicht nur der individuelle Fortpflanzungserfolg zählt, sondern auch der Anteil, den ein Individuum am Fortpflanzungserfolg anderer hat, indem es diese unterstützt. Die anderen sind in der Regel nahe Verwandte. Da jeder meiner Verwandten einen Teil meiner Gene trägt, macht es rechnerisch Sinn, diese zu unterstützen und somit indirekt meine Gene weiterzuvererben. Der Verwandtschaftskoeffizient r beträgt z.B. zwischen jedem Elternteil und einem Kind r = 0.5., d.h., jedes meiner Kinder ist zu 50% mit mir genetisch identisch. Das gleiche gilt für Geschwister untereinander. Onkel bzw. Tanten haben zu Neffen/Nichten eine Wert von r = 0.25, Vettern und Basen einen r = 0.125. Vom rein genetischen Standpunkt aus ist es also gleichbedeutend, ob ich oder zwei meiner Geschwister ihre Gene in die nächste Generation weitergeben.
Ein Soziobiologe brachte dies auf den Punkt, indem er sagte, daß er für zwei seiner Kinder oder vier seiner Vettern sterben würde.
J.B.S. Haldane schrieb schon 1932:
"Insofar as it makes for the survival of one`s descendants and near relation, altruistic behavior is a kind of Darwinian fitness, and may be expected to spread as a result of natural selection."13
Wir erkennen, daß altruistisches Verhalten umso mehr Sinn macht, je näher der Nutznießer mit einem verwandt ist. Dieses Prinzip ist als Nepotismus oderkin-selectionbekannt, was sich mit dem Begriff Vetternwirtschaft recht gut charakterisieren läßt.
Da die Individuen einer Gruppe von Tieren in der Regel miteinander verwandt sind, läuft die Unterstützung nicht auf die Arterhaltung hinaus, dahinter steckt vielmehr das Prinzip derkin- selection,die Weitergabe möglichst vieler der eigenen oder nah verwandten Gene.
Die Soziobiologie widerspricht damit der klassischen Ethologie mit Vertretern wie K. Lorenz und N. Tinbergen, die glaubten, daß die Arterhaltung die oberste Prämisse tierischen Verhaltens sei. Erstaunlicherweise aber hat schon Darwin festgestellt, daß Hilfeleistungen verschiedenster Art durchaus nicht auf alle Individuen derselben Spezies ausgedehnt werden, sondern nur auf die derselben Gemeinschaft.14
Ein altes arabisches Sprichwort pointiert diese Einstellung:
"Ich gegen meinen Bruder; ich und mein Bruder gegen unsere Vettern; ich, mein Bruder und meine Vettern gegen die, die nicht mit uns verwandt sind; ich, mein Bruder, meine Vettern und Freunde gegen unsere Feinde im Dorf; sie alle und das ganze Dorf gegen das nächste Dorf." 15
Nun bleibt die Frage, ob das, was im übrigen Tierreich sich mit den Regeln der Soziobiologie erklären läßt, uneingeschränkt auf den Menschen übertragen werden kann.
Dabei müssen wir zunächst festhalten, daß der Mensch wie jedes andere Tier den biologischen, chemischen und physikalischen Gesetzen unterliegt.
Das mag für die rein organischen Vorgänge stimmen. Unbestritten aber ist, daß der Mensch als anima ratio, wie Aristoteles formulierte, eine Sonderrolle im Tierreich einnimmt. Die Hypertrophierung des Gehirns und die damit verbundenen kognitiven Leistungen beeinflussen zunehmend seine Evolution. Längst ist die kulturelle Evolution an die Seite der biologischen getreten bzw. an ihre Stelle. Mit der Vernunft ist eine ganz neue Qualität in der Natur hervorgegangen, und damit sind Entwicklungen einhergegangen, die nicht mehr dem Primat der Gene unterliegen.
Wenn wir über Altruismus sprechen, müssen wir über einen echten Altruismus sprechen, nicht über einen Pseudo-Altruismus, wie es der reziproke Altruismus ist. Viele Wissenschaftler lehnen es darum ab, die Bezeichnung Altruismus für diese Form zu benutzen. Aber wenn wir die Aktionen von Menschen durchleuchten, die sich altruistisch verhalten, werden wir oft solchen reziproken Altruismus vorfinden. Der britische Historiker Edward Gibbon hatte mit seiner sarkastischen Bemerkung nicht unrecht:
"Man traue keinem erhabenen Motiv für eine Handlung, wenn sich auch ein niedrigeres finden läßt." 16
Die Argumente der Soziobiologie leisten einen wichtigen Beitrag für die Erklärung tierischen Verhaltens. Evolutionär stabil kann nur solches Verhalten sein, was nicht den eigenen Fortpflanzungserfolg mindert. Echter Altruismus kann aber gerade zu einer solchen Minderung führen und kann wahrscheinlich auch nicht das Ergebnis einer genetischen Anlage sein. Inwieweit wir für den Menschen aber anders argumentieren können, sollen die folgenden Erklärungsansätze zeigen.
3. DER SOZIOPSYCHOLOGISCHE ANSATZ: DAS PARADIGMA DES EIGENINTERESSES ODER DIE VERNEINUNG ALTRUISTISCHER MOTIVATION
"Whether one spoke to a biologist, a psychologist, a psychiatrist, a sociologist, an economist, or a poltical scientist the answer was the same: Anything that appears to be motivated by a concern for someone else's needs will, under closer scrutinity, prove to have ulterior motives."17
Die Sozialwissenschaften wurden lange Zeit von dem Paradigma des Selbstinteresses geprägt. Selbstinteresse scheint den Menschen hinlänglich zu charakterisieren.18 In den letzten Jahrzehnten wurde dieses Dogma immer mehr in Frage gestellt. Es fanden sich Indizien für einen genuinen Altruismus, der sich nicht auf ein verstecktes Selbstinteresse zurückführen läßt. Die bestdokumentiertesten Untersuchungen zum empirischen Nachweis von Altruismus wurden von C. Daniel Batson und seinen Mitarbeitern durchgeführt.
3.1 Die Sicht der Sozialwissenschaften tendiert gegen Altruismus
Wie das oben aufgeführte Zitat zeigt, werden (oder wurden?) die Sozialwissenschaften und die anverwandten Gebiete wie die Psychologie vom Dogma des Selbstinteresses geprägt. Sears und Funk kommen zu dem Ergebnis, daß die vorherrschenden modernen psychologischen Theorien der Motivation fundamental egoistisch und hedonistisch sind.19 Auch Freuds Psychoanalyse konzentriert sich auf das Ego. Mag das in der Psychologie noch verständlich sein, so verwundert es doch, daß auch in der Soziologie egozentrische Sichtweisen vom Menschsein dominieren. Grant führt als Beispiele Karl Marx an, bei dem es um das kollektive Interesse von Klassen geht, die Organization-Theory von Max Weber und auch G.H.Meads Symbolischen Interaktionismus. Darüber schreibt er:
"The image of humanity that is assumed in this social science liberation is that of the rational calculator, approaching life from the vantage point of sodt-benefit analysis. The outlook even impinges on the more holistic approaches to sociology, such as George H. Mead`s symbolic interactionism. Reference to the other in Mead`s notion of the generalized other turns out to involve capacities of the self to incorporate others, individually and collectively (Sykes 1980, 171.f), and so once again raises the spectre of a fundamentally egocentric outlook."20
Besonders deutlich wird die Bedeutung des Eigeninteresses in der Ökonomie, hier vor allem in Adam Smiths Programm der freien Marktwirtschaft. Sein politisches Äquivalent finden wir in Thomas Hobbes, dessen Charakterisierung des Lebens kurz und knapp ausfällt: "solitary, poor, nasty, brutish, and short."
Die Fixierung auf das Eigeninteresse wird auch in den sieben Todsünden thematisiert.
In den letzten 20 Jahren wird in allen genannten Bereichen, selbst in den ökonomischen und politischen, das Prinzip des Eigeninteresses als Charakteristikum des Menschseins verstärkt in Frage gestellt.21
3.2 Die Batson-Experimente: Die Sozialwissenschaften entdecken den Altruismus
In den Jahren 1962 bis 1982 sind mehr als tausend empirische Studien über Altruismus publiziert worden. Ihre Erkenntnisse waren durchgehend unbrauchbar, da die Konzepte unklar waren und die zugrunde liegende motivationale Basis nicht hinterfragt wurde. Dennis Krebs stellte 1975 fest:
"psychologist have manipulated antecedents of helping behavior and studied their effects, and they have measured a number of correlates of pro-social events; however, they have done little to examine the extent to which the acts that they investigated were oriented to the welfare of either the person who was helped or the helper."22
C. Daniel Batson und seine Mitarbeiter führten ab Anfang der 80er Jahre eine Reihe von Experimenten durch, die so angelegt waren, daß die Motivation, die hinter den Handlungen stand, nicht auf ein Selbstinteresse reduziert werden konnte.23 Sie formulierten die Empathie- Altruismus-Hypothese, welche besagt, daß das Gefühl von Empathie gegenüber einer Person in Not eine wichtige Motivation zur Hilfe sei. Unter Empathie versteht man die uneigennützige Sorge um das Wohlbefinden eines anderen24 bzw. die Fähigkeit sich in andere hineinzuversetzen und damit die Möglichkeit, Mitgefühl zu entwickeln. In Anlehnung an einige andere Autoren vertritt Batson die Meinung, daß diese Motivation altruistischer Natur sei. Die Motivation zielt in letzter Konsequenz darauf, die Not eines anderen zu mindern.
Das steht im Widerspruch zur vorherrschenden egoistischen Sichtweise menschlichen Verhaltens, bei der das Ziel letztendlich der eigene Vorteil oder das eigene Wohlbefinden ist. Bei einer solcherart motivierten Hilfeleistung ist diese nur scheinbar altruistisch (wir finden hier den Gedankengang der Soziobiologie wieder), tatsächlich steht dahinter aber das egoistische Verlangen nach Ehre und Anerkennung, wie die 'empathy specific reward hypothesis' behauptet, bzw. das Vermeiden von Schuldgefühlen oder die Ächtung durch andere, was die Behauptung der 'empathy specific punishment hypothesis' ist.25
Sollte einer dieser Einstellungen zutreffen, ist zwar das gezeigte Verhalten altruistisch, aber die zugrunde liegende Motivation egoistisch.
Aus diesen Konzepten für Altruismus und Egoismus lassen sich 3 Aussagen ableiten:26
a) Hilfe, als eine Verhaltensweise, kann entweder altruistisch oder egoistisch motiviert sein. Aber nicht das gezeigte Verhalten, sondern das damit letztendlich verbundene Ziel ist es, was bestimmt, ob die Tat altruistisch ist.
b) Die Motivation muß nicht streng altruistisch oder egoistisch sein, auch eine Mischung aus beiden ist denkbar.
c) Die Erhöhung des Wohlbefindens des anderen ist notwendig und ausreichend zur Erreichung eines altruistischen Zieles.
Ist die Hilfe altruistisch motiviert, so ist die Erhöhung des Wohlbefindens des anderen kein Zwischenprodukt oder Mittel zur Erhöhung des eigenen Wohlbefindens (egoistisch), sondern ist ein Zweck in sich selbst.
Batson und seine Mitarbeiter haben einen Versuchsansatz entwickelt, bei dem sie einerseits das Verhalten messen konnten (helfen = altruistisch, der Situation entfliehen = egoistisch) und gleichzeitig, und das war das entscheidende neue an ihrem Ansatz, die zugrunde liegende Motivation erfassen konnten.
Bei dem Versuch wurde eine Situation geschaffen, bei der die Versuchsperson die Möglichkeit hatte, einer anderen Person in einer Notlage zu helfen.
Der Aufbau des Versuches in Kurzform:27
Das Untersuchungsziel eines vorgetäuschten Versuches sollte die Beeinflussung der Arbeitsfähigkeit unter Streß sein. Dieser wurde hervorgerufen durch die Gabe von Elektroschocks. Ein Proband (stets weiblich) hatte diese Rolle zu übernehmen, ein anderer sollte diesen über eine Videokamera beobachten. Die Rollenverteilung wurde angeblich per Los entschieden, tatsächlich sollten die Probanden immer die Rolle des Beobachters übernehmen. Die Funktion der Streßperson wurde von einer eingeweihten Frau, Elaine, übernommen. Elaine täuschte eine ungewöhnlich heftige Reaktion auf die Elektroschocks vor, die als persönliche Überreaktion erklärt wurde.
Erfassung altruistischen Verhaltens: Die Beobachterinnen wurden nach zwei Schocks gefragt, ob sie die Rolle Elaines übernehmen würden, damit der Versuch zu Ende durchgeführt werden könnte.
Schwierigkeit des Entkommens:
- Leicht: Probandinnen mußten nur die beiden Durchgänge zu Ende beobachten und durften dann gehen.
- Schwer: Probandinnen mußten noch acht weitere Durchgänge beobachten. Beeinflussung des Empathiegefühls bei den Beobachterinnen
- Hoch: Durch einen präparierten Fragebogen, den Elaine angeblich ausgefüllt hatte und den die Probandinnen vor dem Experiment zu lesen bekamen, wurden viele Gemeinsamkeiten zwischen Elaine und den Beobachterinnen vorgetäuscht.
- Niedrig: Präparierter Fragebogen, bei dem keine Gemeinsamkeiten vorgetäuscht wurden. Mittels eines Fragebogens sollten die Beobachterinnen nach zwei Durchgängen ihren Eindruck von Elaine abgeben, ihr Gefühl der Ähnlichkeit zu ihr beschreiben und schätzen, wie unangenehm die Stromschläge für sie sind.
Der Versuchsaufbau wurde als 2x2 Faktoren Design angelegt (Tab. 1).28
Tab. 1: Theoretisch erwartete Häufigkeit der Hilfeleistung unter verschiedenen Schwierigkeitsgraden der Situation zu Entkommen und verschiedenen Motivationsbedingungen, egoistisch oder altruistisch.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für den Ausgang des Experiments ergeben sich folgende Überlegungen:
a) Die egoistische Motivation: Das Ergebnis, was am wenigsten überraschen würde, wäre das, daß die Probandinnen nicht die Plätze mit Elaine tauschen. Besonders in der Situation, wo nach zwei Durchgängen die Beobachtung beendet werden konnte (Schwierigkeit des Entkommens: leicht), ist dieses das wahrscheinlichste Verhalten.
In der Situation, wo noch weitere acht Durchgänge zu beobachten sind (schweres Entkommen), ändert sich die Lage für den Zuschauer. Das weitere Leiden Elaines nötigt ihn, die Plätze zu tauschen. Dieses altruistische Verhalten sagt aber noch nichts über die Motivation aus. Diese kann altruistisch motiviert sein, es kann aber auch die Abwehr eigenen Unbehagens oder das Schamgefühl, nicht geholfen zu haben, zugrunde liegen. Die Hilfe wäre dann nur das Mittel zur Wiederherstellung des eigenen Wohlbefindens, damit aber egoistisch motiviert.
b) Die altruistische Motivation: Die zuletzt genannte Variante wird auch bei der altruistischen Motivation zu beobachten sein. Um diese Motivation von der egoistischen unterscheiden zu können, müssen wir den Ausgang des Experiments bei der Faktorenkombination Altruistisch (hohe Empathie) x leichtes Entkommen betrachten. Da hier die Abwehr eigenen Unbehagens bzw. des Schamgefühls keine Rolle spielt (der Zuschauer wurde nach der Frage, ob er die Plätze tauschen möchte, nicht gedrängt, einem weiteren Durchgang beizuwohnen), kommen diese Gründe nicht mehr in Betracht. Das Einverständnis zum Tausch der Plätze hat nur das Ziel, Elaines Unbehagen zu beenden und zwar unabhängig von der Schwierigkeit des Entkommens aus dieser unangenehmen Situation. Dann wäre die Motivation rein altruistisch. Der Versuch ist also so angelegt, daß nicht nur die Häufigkeit altruistischen Verhaltens gemessen werden konnte, sondern darüber hinaus auch ein Rückschluß auf die zugrunde liegende Motivation möglich war, was das neue und besondere an den Experimenten von Batson war. Darüber hinaus sollten die Versuche zeigen, ob die Empfindung von Empathie für
einen anderen zu einer altruistischen Motivation führen kann. Tabelle 2 zeigt die gemessenen Ergebnisse.29
Tab. 2: Anteile der Zustimmung, die Plätze mit Elaine zu tauschen, unter den Bedingungen der Tabelle 1.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ma Durchschnittliche Anzahl an Elektroschocks (von 0 bis 8) welche die Probandinnen für Elaine zu übernehmen bereit waren.
Die Ergebnisse in Tabelle 2 bestätigen die erwarteten Ergebnisse aus den vorhergehenden Überlegungen. Bei einem niedrigen Empathiegefühl beeinflusste die Manipulation der Entkommensmöglichkeit aus der Versuchssituation drastisch die Häufigkeit der Hilfe. Ist das Entkommen schwierig, scheint es einfacher selbst die Elektroschocks auszuhalten, als weiter Elaine leiden zu sehen. Kann man dagegen leicht entkommen, so nutzt man diese Möglichkeit. Ist das Empathiegefühl für Elaine dagegen hoch, bot die Mehrzahl der Probandinnen tatsächlich ihre Hilfe an, auch wenn sie der Situation hätten leicht entkommen können. Im Vordergrund für sie stand, Elaine aus der mißlichen Lage zu befreien, nicht sich selbst.
Die Ergebnisse dieses Versuches stützen also Batsons Empathie-Altruismus Hypothese. Je höher das Empathiegefühl ist, desto größer die Motivation dem Adressaten des Gefühls zu helfen.
Batson hat noch weitere Experimente durchgeführt, um unter anderen Bedingungen seine Hypothese zu belegen. Dazu gehörte z.B. die Manipulation des Empathiegefühls durch Verabreichung eines Placebos, welches angeblich als Nebeneffekt ein Gefühl von Wärme und Empfänglichkeit hervorrufen würde. Einer zweiten Gruppe wurde als Nebeneffekt des
Placebos ein Gefühl von Unbehagen und Unruhe suggeriert.30 In späteren Arbeiten hat er die 'empathy specific reward hypothesis' und die 'empathy specific punishment hypothesis' als Gründe für die Motivation altruistischen Verhaltens widerlegt.31
Batson Erkenntnisse faßt Grant folgendermaßen zusammen:32
"If the altruism is real, it can be expected to have significance for our living. In fact, if it is believed to be real, it can be expected to have significance. This is Batson`s view. "If it turns out that we are capable of altruism," he suggests, "then our moral horizon - and our potential for moral responsibility - broadens considerably" (Batson, C.D., 1991, 4). But this means that far from being a matter of empirical revision of our understanding of human nature, the altruism studies involve a vision of human potential. Not only what we are but what we might become, as individuals and as a society, is at stake. "If our belief in universal egoism is wrong and we are actually capable of altruism, then possibilities arise for the development of more caring individuals, and a more compassionate, human society" (1991, 4). Here we are dealing not only with empirical information but also with moral transformation."
Batson leitet aus der Möglichkeit zum Altruismus eine moralische Herausforderung für menschliches und gesellschaftliches Verhalten ab. Er sieht aber auch zwei wichtige Einschränkungen seiner Hypothese. Die erste ist, daß Altruismus abhängt vom Grad der Empathie und dieser Grad in der Praxis beschränkt ist. Das zweite Problem ist, daß, je höher die Kosten der Hilfe sind, desto mehr tritt das Selbstinteresse in den Vordergrund. Aber das wichtige an diesen Experimenten bleibt die Überlegung, ob altruistisches Verhalten ohne egoistische Motivation wirklich möglich ist und damit das Dogma des Selbstinteresses angegriffen werden kann. Um noch einmal Batson zu zitieren:33
"If we are capable of altruism, then virtually all of our current ideas about individual psychology, social relations, economics and politics are in an important respect wrong."
Und Jane Mansbridge formulierte den gleiche Gedanken aus einer anderen Sicht:
"because thinking that another has acted unselfishly often leads people to behave unselfishly themselves, underestimating the frequency of altruism can itself undermine unselfish behavior".34
Die unterstellte Motivation bei anderen beeinflußt unsere eigenen Einstellungen. Deshalb ist es wichtig, dieser Bedeutung zu schenken und es nicht offen zu lassen, ob sie nun altruistisch oder egoistisch ist. Es bleibt also abzuwarten, ob weitere Untersuchungen altruistisches Verhalten beim Menschen hinreichend belegen können.
4. DER PHILOSOPHISCHE ANSATZ: DAS PARADOXON ALTRUISMUS
“Inveterately altruistic creatures have a pathetic tendency to die before reproducing their kind." W.V.O. Quine Im vorliegenden Kapitel beziehe ich mich im wesentlichen auf den Artikel von Neven Sesardic.35 Er schreibt in seiner Einleitung über das Paradoxon Altruismus:36
"To begin with, here is a crude version of the paradox of altruism: on one hand it seems that the existence of human altruism is an undeniable psychological fact, but on the other hand it seems, on evolutionary grounds, that altruism cannot exist, because species with this trait are expected to have gone extinct through the process of natural selection."
4.1Psychologischer Altruismus und Evolutionärer Altruismus - Formulierung eines Paradoxons
Zur Lösung dieses Problems bedient sich der Autor zweier Definitionen von Altruismus, einer psychologischen und einer evolutionären:
A verhält sich altruistischp = A agiert mit der Intention, die Interessen eines anderen zu fördern auf Kosten seiner eigenen Interessen.
A verhält sich altruistische = Der Effekt des Verhaltens von A ist die Steigerung der Fitness eines anderen auf Kosten seiner eigenen Fitness.
Das Paradoxon läßt sich so beschreiben: Altruismusp ist eine (psychologische) Tatsache und Altruismuse ist eine (evolutionäre) Unmöglichkeit. Es ist aber noch nicht ausreichend, verschiedene Definitionen einzuführen, um das Problem vollständig zu lösen. Sesardic stellt vier Bedingungen vor, "the incongrous tertrad", die zunächst nicht offensichtlich übereinstimmen:
(1) Altruisme is a selectively disadvantageous trait.
(2) Altruismp tends to lead to altruisme.
(3) Altruismp exists.
(4) Altruismp is a product of natural selection.
Der Zusammenhang zwischen diesen Vorbedingungen ist folgender: Bedingung (1) ist eine Aussage über Altruismuse, (3) und (4) über Altruismusp. Bedingung (2) ist die Verbindung zwischen beiden.
Das Paradoxon kann auf zwei Arten aufgelöst werden. Entweder man beweist, daß mindestens eine der vier Bedingungen falsch ist oder daß die zunächst widersprüchlich wirkende Tetrade tatsächlich kohärent ist.
Interessanterweise spiegeln diese beiden Möglichkeiten die verschiedenen gegenwärtigen Standpunkte in der Diskussion um das Thema Altruismus wider.37
4.2Ein Auflösungsversuch des Paradoxons
Sesardic untersucht die o.g. vier Bedingungen daraufhin, ob sie wahr sind oder ob zumindest eine sich als falsch erweist. Er führt für jede der vier Bedingungen Argumente für ihre mögliche Richtigkeit oder ihre Unrichtigkeit an. Ich möchte nicht seinen kompletten Gedankengang hier nachzeichnen, sondern mich auf einige wenige Ausführungen beschränken, die einige bislang noch nicht erwähnten Argumente für ein Vorhandensein bzw. gegen ein Vorhandensein von psychologischem und altruistischem Altruismus bieten.
Zwei Erklärungen für Altruismuse existieren in der Literatur, das Konzept der kin-selection und das Prinzip der Gruppenselektion. Auf die kin-selection bin ich schon in Kap. 2.2 eingegangen. Wegen der inclusive fitness macht es Sinn, nahen Verwandten zu helfen, auch auf Kosten der individuellen Fitness. Betrachten wir aber bei dieser Aussage allein das Individuum, und dieses ist ja zunächst Emitter der Handlung und damit der Angriffspunkt der Selektion, so bringt die Verwandtenunterstützung keinen Vorteil. Damit wäre die Bedingung (1) erfüllt, wenn bei dieser Aussage allein das Individuum betrachtet werden soll.
Das Konzept der Gruppenselektion wird sehr kontrovers in der Biologie diskutiert, befürwortet z.B. durch Wynne-Edwards, attackiert von G.C. Williams. Leicht vorstellbar ist, daß Gruppen aus Altruisten einen Vorteil gegenüber Gruppen aus Egoisten besitzen. Aber in altruistischen Gruppen besteht immer die Gefahr, daß Egoisten sie unterwandern. Aus der Sicht der Gruppe ist es besser, viele Altruisten zu haben, aus der individuellen Perspektive ist es besser, in einer solchen Gruppe egoistisch zu sein. Wir könnten also homogene Gruppen erwarten, die entweder nur aus Egoisten oder nur aus Altruisten bestehen. Realistischer sind aber inhomogene Gruppen, in welchen ein bestimmtes Verhältnis zwischen den Verhaltensmustern auftaucht. Mathematische Modelle zeigen, daß solche Situationen entstehen und stabil sein können.38 Heinsohn und Packer berichten sogar von Löwen, die altruistisches Verhalten in einer Gruppe zeigen, unabhängig von der Verwandtschaftssituation. 39
Gruppen-Selektion wird als möglicher evolutionärer Prozeß gesehen, aber viele Biologen glauben, daß dieser nur unter sehr speziellen Bedingungen (kleine Gruppen, geringe Migration zwischen den Gruppen) vorkommen kann.40 Sesardic kommt zu folgender Einschätzung der Gruppenselektion 41:
"[...] that it is improbable that a massive presence of human altruism could be adequately accounted for by such a delicate and extremely fine-tuned causal mechanism."
Evolutionsfaktor. Als physiologisches Mängelwesen (A. Gehlen) ist er besonders in der Frühzeit auf ein gut funktionierendes Gruppenleben angewiesen.
Betrachten wir noch Bedingung (3): Existiert ein psychologischer Altruismus?
Dieser Frage bin ich in dem Kapitel 3.3 nachgegangen. Sesardic bewertet die Batson Experimente als "[...] the most serious challenge to psychological egoism, and quite possibly its burier too."42
Bleibt noch die Frage, ob Altruismusp, vorausgesetzt es gibt ihn, wirklich auch evolutionär stabil sein kann. Interessanterweise ist altruistisches Verhalten weitverbreitet auf der Welt und findet sich auch schon bei Kindern, es scheint also beim Menschen eine Prädisposition dafür vorzuliegen.43 Alexander Rosenberg faßt das so zusammen:44
"one is tempted to say that the only likely explanation of why Homo sapiens cooperate, despite the temptations of costless free riding, must be evolutionary."45
Trotz aller Argumente scheint es doch ein Rätsel, daß sich ein für ein Individuum nachteiliges Verhalten weitervererben kann. Ungeklärt ist meines Wissens, ob die Neigung zum altruistischen Verhalten genetisch fixiert ist, mir sind dafür keine Belege bekannt. Wenn wir also von einer Vererbung sprechen, müssen wir uns das nicht auf der genetischen Ebene vorstellen, sondern auf der sozialen bzw. kulturellen. Dieser "Ausweg" ist für Sesardic aber nicht akzeptabel. Die Erhaltung eines ‚memes‘ für Altruismus in einer Population ist für ihn nicht weniger rätselhaft wie die Erhaltung eines Altruisten-Gens.46
4.3 By-product theory
Der vorangegangene Ansatz diente der Überlegung, die Haltbarkeit der vier einzelnen Bedingungen zu untersuchen. Im folgenden geht es darum, einen besonderen Blick darauf zu werfen, ob ein Altruismusp zu einem Altruismuse führen kann. Wir setzen voraus: Es gibt einen Altruismusp, und dieser führt zu einem Altruismuse. Aber kann Altruismusp, wenn Altruismuse ein für die Fitness des Individuums nachteiliges Verhalten ist (1), ein Produkt der Selektion sein?47 Sober unterscheidet zwischen einer "Selektion von" und einer "Selektion auf". Daß Altruismusp ein Produkt von natürlicher Selektion ist, legt nahe, daß notwendigerweise auch eine Selektion auf, also in Richtung dieses Verhaltens stattgefunden hat. Die By-product theory besagt, daß Altruismusp ein Nebenprodukt einer anderen Eigenschaft ist, auf die hin selektiert worden ist. Altruismusp selbst ist also nicht adaptiv.
Um diese By-product Theorie zu stützen, müssen drei Fragen geklärt werden:
(1) Existiert eine solche andere Eigenschaft?
(2) Wird sie positiv selektiert?
(3) Ist Altruismusp untrennbar mit ihr verbunden?
Als die gesuchte Eigenschaft wird die Vernunft genannt. Die weitreichende Besiedlung unserer Welt durch den Menschen zeigt, daß Vernunft und Verstand einen erheblichen Selektionsvorteil bieten. Insoweit können die Fragen (1) und (2) beantwortet werden.
Bedingt aber Vernunft zwangsläufig Altruismus?
Ein Verfechter dieser Annahme ist Thomas Nagel. Er ist der Meinung, daß jeder vernünftige Mensch ein Mindestmaß an Sorge für andere mitbringt. Dahinter verbirgt sich Kants Praktische Philosophie. Ob dieser Zusammenhang mittels Vernunft bewiesen werden kann, ist unter Philosophen höchst umstritten. Die Sozialwissenschaften lehren uns, daß Vernunft bzw. vernünftige Überlegungen alleine keine ausreichende Motivation für Handlungen sind:48
"[...] takes at it starting point the assumption that reason is motivationally inert. According to this widely shared view, rational considerations cannot move us to action by themselves, the main impulse always coming from some of our basic preferences that stand completely outside the jurisdiction of reason."
Wenn der Kantsche Ansatz also nicht die Entstehung von Altruismus erklären kann, welche andere Möglichkeiten bleiben noch?
Sesardic greift an dieser Stelle auf das Konzept derkin-selectionzurück (s. Kap. 2.3). Nach seiner Definition handelt es sich hierbei um Altruismusp, nicht Altruismuse:49
"So it seems afer all that kin selection could provide a mechanism for injecting the first, minimal dose of altruismp and that by conferring a selective advantage on the carriers of this trait it could then set the stage for the circle of altruism expanding further afterward [...] The point that there is this cleavage between the two concepts of altruism (i.e., that altruisme is about genes whereas altruismp is about individuals) is both congent and important."
Die Aufgabe ist aber die Herleitung eines universellen Altruismus und nicht eines selektiven, wie es die Verwandtenunterstützung ist. Dies ist insofern zwingend, da die Soziobiologie erklärt hat, daß sich dahinter letztendlich genetischer Eigennutz verbirgt. Die Herleitung eines "narrow-scope altruism" aus biologischer Sicht ist damit gelungen.
Gibt es aber auch eine Argumentation, die sich aus der Vernunft herleitet?
Schließlich ist es nicht ausreichend zu sagen, Altruismusp sei zunächst in Ansätzen biologisch entstanden und habe sich dann aus Vernunftsgründen weiterentwickelt50:
"Therefore the cognitivist argument, labeled here, cannot bootstrap itself by appeal to the factual premise that evolutionary forces have produced one kind of altruismp, in the hope that it has then only to proceed further and broaden the scope of this other- benefiting behavioral tendency. No, reason has to take the uphill path and develop the rational defense of altruim all the way from the very beginning."
Dies scheint bis heute noch nicht überzeugend gelungen zu sein. Forschungen in der Kindespsychologie haben gezeigt, daß Kinder Sorge um andere entwickeln können, in einem Entwicklungsstadium, indem sie noch keinerlei Moralvorstellungen besitzen.
Einen anderen Ansatz, eine Brücke zwischen Altruismus und natürlicher Selektion zu schlagen, verfolgen R. Boyd und Peter J. Richerson. Ihre Argumentation beinhaltet zwei Annahmen: 51
(1) Unter bestimmten Bedingungen, v.a. in heterogenen Umgebungen, existiert ein Selektionsvorteil in Richtung unkritischer Konformität.
Konformität bedeutet das Kopieren des meistgebräuchlichsten Verhaltens durch Subpopulationen, ohne vorab zu prüfen, ob dieses Verhalten unter den gegebenen Umständen das angebrachteste ist. Ferner tendieren die best-angepaßten Verhaltensweisen meist dazu, die gebräuchlichsten in einer Subpopulation zu werden. Ein Konformist zu sein bringt einem Individuum den Vorteil, ohne kostspieligen Lernprozeß das beste Verhalten zu erwerben.
(2) Altruismus ist eine Konsequenz der Konformität. Der zugrunde liegende Mechanismus ist die kulturelle Gruppenselektion. Boyd und Richerson vermuten eine genetische Disposition zur Konformität. Dadurch kann sich Altruismus in einer Gruppe, in der dieser entstanden ist, unter Umständen stabil halten. Selbst gegen das Eindringen von Egoisten von außerhalb oder innerhalb führt die Neigung zur Konformität zu einer Etablierung des altruistischen Verhaltens. Das Vorkommen von Altruismus in einer Gruppe führt zur Übernahme dieses Verhaltens von allen und auch von den Nachkommen.
Der Wert dieses Ansatzes liegt in der eleganten Verknüpfung von biologischer und kultureller Selektion.
Zu dieser Theorie müssen m.E. zwei Anmerkungen gemacht werden:
(1) Die biologischen Ursprünge für zumindest einen ansatzweisen Altruismus halte ich wie schon erwähnt für überzeugend. Herausgestellt werden müßte aber noch, daß das Leben in Kleingruppen diesen einen Evolutionsvorteil gebracht hat. Die Geschichte der Menschheit und die Vorstellung vom Mensch als Mängelwesen (A. Gehlen) scheint dies hinreichend zu belegen. Aber, ab welcher Gruppengröße, ab welcher Staatsgröße funktionieren die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr so, wie in der Kleingruppe? Speziell der Hang zur Konformität scheint mir in kleinem Maßstab zu gelten52, im großen aber auch noch? Dies scheint mir nicht mehr gegeben zu sein. Die Tendenz ein Verhalten zu übernehmen, weil "man das immer so gemacht hat", funktioniert in vielen Bereichen nicht (setzt sich hier eine egoistische Sichtweise durch?).53 Wir sehen also ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Abwendung vom Konformitätsgedanken. Daß die Konformität verliert (heutzutage immer öfter?), könnte zwei Gründe haben. Erstens die Bildung von Interessengruppen oder Großgruppen anstelle existentiell wichtiger Kleingruppen. Das Leben in unserer heutigen Gesellschaft ist nicht mehr geprägt durch den Kampf ums Überleben, die Bindung an eine Gruppe nicht mehr existentiell und daher nicht mehr so stark selektioniert. Die Bindung zwischen den Gruppenmitgliedern bekommt somit eine andere Bedeutungsdimension. Dadurch dürfte der Hang bzw. Zwang zur Konformität auch an lebensnotwendiger Wichtigkeit verloren haben. Anerkennung in einer Gruppe ist immer noch eine Motivation, aber wohl eher aus psychologischen Gründen denn aus existenziellen.
(2) Der zweite Grund, entgegen dem Konformitäts-Dogma zu handeln, ist der, daß in einer aufgeklärten Informationsgesellschaft das (Pseudo-)Argument "weil man das immer so gemacht hat" nicht mehr funktioniert. Wir geben uns nur mit echten Begründungen und Erklärungen zufrieden. Eine kritiklose Nachahmung widerstrebt unserem Verstand.
4.4 Continuing adaptation theory
Anders als die By-product theory vertritt sie die Ansicht, daß Altruismusp ein Produkt natürlicher Selektion ist (hier stimmen beide Theorien noch überein) u n d adaptiv. Letztere Aussage ist entscheidend. Rückblickend auf die vier Eingangsaussagen des Paradoxons gelangt Sesardic zum Widerspruch:
"[...] can we coherently entertain the idea that it may be selectively advantageous to possess a selectively disadvantageous trait?"54
Betrachten wir zu dieser Überlegungen ein Gefängnis-Dilemma (Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Das Gefangenen-Dilemma
k = Kooperation, u = Treuebruch
Die Situation:
Jeder Gefangene, A und B, hat die Wahl zwischen Kooperation (k) und Treuebruch (u). Es gibt vier Kombinationsmöglichkeiten, wobei A immer zuerst entscheiden soll.
Fall 1: B erfährt, wie A sich verhält, und A weiß das.
Bei diesem Fall wird immer die Treuebruch-Strategie herauskommen, wobei das Resultat (0/0) ist.
Fall 2: B könnte zur Kooperation neigen, wenn A kooperiert. A besitzt eine einigermaßen zuverlässige Methode zur Erkennung einer solchen Verhaltensdisposition in B. Damit ergäbe sich auch eine andere Möglichkeit, nämlich daß beide kooperieren mit einem Ergebnis (1/1).
Es ist die Haltung von B, der wir unsere Aufmerksamkeit widmen müssen. Denn, wenn A kooperiert, gewinnt B am meisten (2), wenn er untreu wird. Das zeigt, daß eine Haltung von Kooperation nachteilig für B ist (Nettogewinn von 1 statt 2). Falls B also in der letztgenannten Situation kooperiert, ist das ein Beispiel für Altruismuse, denn es minimiert seine Fitness und besitzt von daher keine evolutionäre Rechtfertigung.
Wäre B also nicht dumm, sich so zu verhalten? Wie kann eine solche Verhaltensweise selektiert werden?
Der entscheidende Punkt in dem Gefangenen-Dilemma ist der, daß es in B`s Interesse liegt, daß A kooperiert. Andernfalls kann B nicht über einen Nettogewinn von (0) hinauskommen. Die einzige Möglichkeit für B, A zur Kooperation zu bewegen, ist die, ihn in Kenntnis zu setzen, daß B selbst auch kooperieren wird. Und daß B die Disposition zur Kooperation besitzt, demonstriert er A am besten dadurch, daß er ein solches Verhalten auch tatsächlich zeigt bzw. schon einmal gezeigt hat.
Das Ergebnis, A und B werden mit einem Gewinn von (1/1) belohnt. Auf diese Weise kann sich die Disposition zu einer verinnerlichten Haltung entwickeln und sich als evolutionär stabile Strategie entwickeln.55
Die Neigung zur Kooperation ist nach der o.g. Definition ein evolutionärer Altruismus, weil B durch seine Kooperation einen Fitnesspunkt verliert.
Genauer gesagt, erst der Übergang von der Neigung zur Kooperation (was A veranlaßt zu kooperieren) zum tatsächlich gezeigtem Verhalten (denn erst hier manifestiert sich der bewußt in Kauf genommene Fitnessverlust von B, nachdem er erfahren hat, wie A sich verhalten hat) ist ein wirklicher Altruismus. Denn die beste Taktik für B wäre, A eine Disposition zur Kooperation vorzugaukeln, um ihn dann im Stich zu lassen und dabei den größten Gewinn (2) einzufahren.
5. ZUSAMMENFASSUNG
Wir haben gesehen, daß wir verschiedene Formen von Altruismus unterscheiden müssen, daß es sich z.B. beim reziproken Altruismus nicht um einen wirklichen Altruismus handelt. Da Altruismus ‚sensu stricto‘ immer mit der Verringerung der eigenen Fortpflanzungschancen einhergeht, kann sich ein solches Verhalten eigentlich nicht in der Evolution etablieren. Wir finden aber solche Verhaltensmuster auf der ganzen Welt, es kann sich also nicht nur um eine seltene kuriose Erscheinung halten.
Es ist nicht bekannt, ob eine altruistische Disposition in irgend einer Weise genetisch fixiert ist. Dagegen spricht z.B., daß im familiären Umfeld von Heiligen oder sehr aufopferungsbereiten Menschen keine Häufung solchen Verhaltens beobachtet werden kann. Möglicherweise ist altruistisches Verhalten ein Kind der kulturellen Evolution, und wir müssen uns gar nicht mit genetischen Fragen beschäftigen.
Ich will diese letzte Überlegung noch etwas ausführen. Der Mensch ist ein sozialer Organismus und daher spielen Verhaltensformen, welche die Gruppe betreffen, eine große Rolle. Betrachten wir die Frühzeit der menschlichen Entwicklung sehen wir, daß er vielen existenziellen Bedrohungen ausgesetzt war, z.B. durch Raubtiere. Die Gruppe bot dagegen einen Schutz, aber auch nur, wenn ihre Mitglieder in der Lage waren, zu kooperieren. Da es aber unmöglich ist, stets gleiches mit gleichem zu vergelten, dietit-for-tatStrategie nur rein hypothetisch aufgehen kann, konnte die Hilfe einzelner gar nicht „kostenneutral“ vergolten werden. Als Konsequenz blieben zwei Möglichkeiten:
1. Ich kooperiere nur, wenn die Rückzahlung gesichert ist.
2. Ich kooperiere auch dann, wenn ich damit rechnen muß, das mir meine Hilfe nicht adäquat vergolten wird (werden kann).
Im ersten Fall findet jedes gruppendienliche Verhalten ein schnelles Ende. Fall 2 kann bei jenen, die desöfteren ‚draufzahlen‘, Frustration oder Wut auslösen. Der Ausgleichsmechanismus besteht im zweiten Fall in der sozialen Anerkennung und Wertschätzung des altruistisch Handelnden. Durch die Achtung wird altruistisches Verhalten belohnt und gefördert und kann so als vorbildliches Handeln stabil in einem sozialen System
bestehen. Dabei wird die Etablierung zunächst über die Gruppenselektion gegangen sein. Die Gruppenstruktur ermöglicht es, daß die Mitglieder sich untereinander kennen und ihre Verhaltensdispositionen transparent sind (vgl. das Gefangenen-Dilemma).
In der Kleingruppe kommt eine neue Dimension ins Spiel. Dastitdestit-for-tatkommt nicht immer unmittelbar vom Adressaten des altruistischen Verhaltens, sondern kann von einem anderen Gruppenmitglied stammen.56 Es wird dann also nicht mehr die konkrete Handlung und nicht mehr das ersthandelnde Individuum belohnt, sondern die generelle Disposition zu altruistischem Verhalten. Es findet eine Selektion nicht mehr der Personen statt, sondern eines Verhaltensmusters.
Somit unterliegt möglicherweise der Altruismus allein der kulturellen und nicht (mehr?) der genetischen Evolution.
Altruismus dürfte in unserer heutigen Gesellschaft Wirklichkeit sein, wenn auch das Ausmaß gering ist. Aber vielleicht ist es eine Illusion zu meinen, daß diese Disposition genetisch codiert ist.
Wir müssen uns fragen, ob der zuletzt genannte Punkt uns Sorgen bereiten sollte oder ob es nicht eine rein akademische Frage ist. Ich halte es vor dem Hintergrund der kulturellen Vererbung für wichtiger, die sozialen Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß altruistisches Verhalten positiv beurteilt wird und eine Vorbildfunktion bekommt.
LITERATUR
Batson, C.D. (1991): The altruism question: Toward a social-psychological answer. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Batson, C.D., Duncan, B.D., Ackerman, P., Buckley, T., and Birch, K. (1981): Is empathic emotion a source of altruistic motivation?.Journal of Personality and Social Psychology40, S. 290-302
Batson, C.D., Dyck, J.L., Brandt, J.R., Batson, J.G., Powell, A.L., McMaster, M.R., and Griffitt, C. (1988): Five studies testing two new egoistic alternatives to the empathy-altruism hypothesis.Journal of Personality and Social Psychology55 (1988), S. 52-77.
de Vos, H. and Zeggelink, E. (1997): Reciprocal altruism in human social evolution: The viability of reciprocal altruism with a prefernce for „old-helping-partners“.Evolution and Human Behavior18, S. 261-278.
Donato, R., Peliti, L., and Serva, M. (1997): The selection of altruistic behaviour.Theory Biosciences116, S. 309-320.
Grant, C. (1997): Altruism: A social science chameleon.Zygon32, S. 321-340. Haldane, J.B.S. (1932): The causes os evolution. London: Longman.
Heinsohn, R. and Packer, C. (1995): Complex cooperative strategies in group-territorial African lions.Science269, S. 1260-1262.
Krebs, D.L. (1975): Eempathy and altruism.Journal of Personality and Social Psychology
32, S. 1134-1146.
Mansbridge, J.J. (1990): On the Relation of altruism and self-interests. In: Beyond Self- interest, ed. J.J. Mansbridge. Chicago: Univ. of Chicago Press.
Maturana, H.R. and Varela, F.J. (1987): Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. Bern, München: Scherz
Piliavin, J.A., and Charng, H.W. (1990): Altruism: A review of recent theory and research.
Annual Review of Sociology16, S. 27-65.
Sesardic, N. (1995): Recent work on human altruism and evolution.Ethics106, S. 128-157.
Vogel, Ch. (1989): Vom Töten zum Mord. Das wirklich Böse in der Evolutionsgeschichte. München: Hanser.
Wutketits, F.M. (1997): Soziobiologie. Heidelberg: Springer.
RWTH Aachen
Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft
Zwischenprüfungsarbeit:Altruismus – Wirklichkeit oder Illusion?
Betreuer: Prof. Dr. phil. Franz Hargasser
Name: Christoph Schmitz
Studienfächer: Biologie / Kath. Theologie Semester: 12 / 5
Matrikelnummer: 167783
Aachen, den 25.06.99
[...]
1 zit. in Grant,C.: Altruism: A social science chameleon. S. 336
2 Maturana, H.R. and Varela, F.J.: Der Baum der Erkenntnis
3 zit. in: Wutketits, F.: Soziobiologie. S. 91
4 Grant, C.: Altruism: A social science chameleon. S. 335
5 Wutketits, S.1
6 Vogel, Ch.: Vom Töten zum Mord. S. 17
7 Vogel, S.26
8 Voland, E., zit. in Wutketits, S.84.
9 Sesardic, N.: Recent work on human altruim and evolution. S. 130
10 Ebd., S. 130
11 Wutketits, S. 89
12 Ebd., S.88
13 Haldane, J.B.S.: The causes of evolution.
14 Vogel, S. 77
15 Ebd., S.53
16 Vogel, S. 33
17 Piliavin, J.A., and H.W. Charng: Altruism: A review of recent theory and research. S. 28
18 Grant, S. 321
19 Ebd., S. 322
20 Grant, S.323
21 Ebd., S.328
22 Krebs, D.L.: Empathy and altruism.
23 Batson,C.D. et al. (1988): Five studies testing two new egoistic alternatives to the empathy-altruism hypothesis. S. 52
24 Batson, C.D. et al. (1981): Is empathyic emotion a source of altruistic motivation?. S. 291
25 Batson, (1988), S. 52
26 Batson, (1981), S. 291
27 der detaillierte Ve rsuchsaufbau Batson (1981), S. 293ff
28 Batson (1981), S. 292
29 Batson (1981), S. 295
30 Batson (1981), Experiment 2, S. 297ff
31 Batson (1988)
32 Grant, S. 333
33 Batson, C.D. (1991): The altruism question: Toward a social-psychological answer. S. 3
34 Mansbridge, J.J., zit. in Grant, S. 334
35 Sesardic, N.: Recent work on human altruism and evolution.
36 Ebd., S. 128
37 Sesardic, S. 131
38 Donato, R., Peliti, L., and Serva, M.: The selection of altruistic behaviour.
39 Heinsohn, R. and Packer, C.: Complex cooperative strategies in group-territorial African lions
40 Ich halte dagegen die Gruppenselektion besonders für den Menschen als einen bedeutsamen
45 Es bleibt bei dieser Aussage zu fragen, ob Rosenberg kooperatives Verhalten meint oder altruistisches. Kooperation ist zum Vorteil beider Akteure und unbestreitbar ein Selektionsvorteil.
46 Der Begriff ‚meme‘ wurde von R. Dawkins geprägt. Er ist analog zum Begriff Gen zu verwenden, aber auf der Ebene der kulturellen Evolution, nicht der biologischen. Ein ‚mem‘ ist eine Information, Eigenschaft oder eine Idee, die weitergegeben - weitervererbt - wird an andere Generationen. Ist sie erfolgreich, bleibt sie in der Gesellschaft erhalten, ist sie es nicht, verschwindet sie aus dem Wissenspool.
47 Sesardic, S. 141
48 Sesardic, S. 146
49 Ebd., S.146
50 Ebd., S. 147
51 Sesardic, S. 147
52 Bsp. könnten das Tragen bestimmter Markenartikel oder das Vereinsleben sein.
53 Beispiel ist die Kirche und der Glaube, die sich davon zu entfernen scheint, eine Massenbewegung zu sein. Für meine Generation ist es nicht mehr selbstverständlich, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, wie es vielleicht in meiner Elterngeneration noch üblich war.
54 Sesardic, S. 148
55 Die Berechnung solcher evolutionär stabilen Strategien ist das Feld der Spieltheoretiker wie J.B.S. Haldane und M. Eigen. Zunächst nichtmöglich erscheinende Verhaltensweisen können sich unter bestimmten Bedingungen durchsetzen. Ein klassisches Beispiel ist das Falken-Tauben Szenario, beschrieben bei R. Dawkins, The selfish gene. Dabei geht es um die Frage, ob sich eine neu entstandene kämpfende Subpopulation (bezeichnet mit Falken) in einer friedlichen Population (bezeichnet mit Tauben) durchsetzen kann. Das Ergebnis ist, daß sich ein bestimmtes Verhältnis zwischen beiden Typen als stabil erweist.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der soziobiologische Ansatz in Bezug auf Altruismus?
Der soziobiologische Ansatz erklärt Altruismus durch den "Egoismus der Gene". Er argumentiert, dass Verhalten, das auf den ersten Blick selbstlos erscheint, letztlich dem Ziel dient, die eigenen Gene weiterzugeben. Reziproker Altruismus, bei dem Hilfeleistung erwartet wird, und Verwandtenselektion, bei der Verwandte unterstützt werden, um gemeinsame Gene zu fördern, sind Beispiele dafür.
Was ist reziproker Altruismus?
Reziproker Altruismus ist ein scheinbar uneigennütziges Verhalten, bei dem erwartet wird, dass die Hilfe in der Zukunft erwidert wird. Es basiert auf dem Prinzip "Wie du mir, so ich dir" und dient letztlich dem eigenen Vorteil, indem es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man selbst in Zukunft Hilfe erhält.
Was ist Nepotismus (kin-selection)?
Nepotismus oder Verwandtenselektion ist die Unterstützung von Verwandten, um die Weitergabe gemeinsamer Gene zu fördern. Da Verwandte einen Teil der eigenen Gene tragen, macht es rechnerisch Sinn, sie zu unterstützen und somit indirekt die eigenen Gene weiterzuvererben.
Was ist der soziopsychologische Ansatz in Bezug auf Altruismus?
Der soziopsychologische Ansatz untersucht die Motivationen hinter altruistischem Verhalten. Lange Zeit wurde in den Sozialwissenschaften das Paradigma des Selbstinteresses betont. Die Empathie-Altruismus-Hypothese von C. Daniel Batson besagt jedoch, dass Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, eine wichtige Motivation für altruistisches Handeln ist.
Was ist die Empathie-Altruismus-Hypothese?
Die Empathie-Altruismus-Hypothese besagt, dass das Gefühl von Empathie gegenüber einer Person in Not eine wichtige Motivation zur Hilfe ist. Unter Empathie versteht man die uneigennützige Sorge um das Wohlbefinden eines anderen.
Wie haben die Batson-Experimente zum Verständnis von Altruismus beigetragen?
C. Daniel Batson und seine Mitarbeiter führten Experimente durch, die darauf abzielten, die Motivation hinter Handlungen zu untersuchen. Ihre Ergebnisse deuteten darauf hin, dass Empathie tatsächlich zu altruistischem Verhalten führen kann, das nicht auf ein verstecktes Selbstinteresse zurückzuführen ist.
Was ist der philosophische Ansatz in Bezug auf Altruismus?
Der philosophische Ansatz betrachtet das Paradoxon Altruismus. Er unterscheidet zwischen psychologischem Altruismus (Handeln mit der Intention, die Interessen eines anderen zu fördern) und evolutionärem Altruismus (Verhalten, das die Fitness eines anderen auf Kosten der eigenen steigert). Es stellt sich die Frage, wie psychologischer Altruismus, der evolutionär nachteilig sein sollte, entstanden sein kann.
Was ist die "By-product theory" im philosophischen Kontext des Altruismus?
Die "By-product theory" besagt, dass Altruismus ein Nebenprodukt einer anderen Eigenschaft ist, auf die hin selektiert worden ist, z.B. die Vernunft. Altruismus selbst ist also nicht adaptiv, sondern ein unbeabsichtigter Effekt einer anderen adaptiven Eigenschaft.
Was ist die "Continuing adaptation theory" im Kontext des Altruismus?
Die "Continuing adaptation theory" vertritt die Ansicht, dass Altruismus ein Produkt natürlicher Selektion ist und adaptiv ist. Das bedeutet, dass Altruismus unter bestimmten Umständen einen Selektionsvorteil bieten kann, z.B. durch die Förderung von Kooperation in Gruppen.
Welche Rolle spielt die kulturelle Evolution bei Altruismus?
Es ist möglich, dass altruistisches Verhalten ein Produkt der kulturellen Evolution ist. Soziale Anerkennung und Wertschätzung des altruistisch Handelnden können dieses Verhalten belohnen und fördern, was zu seiner Stabilisierung in einem sozialen System führt.
- Quote paper
- Christoph Schmitz (Author), 1998, Altruismus - Illusion oder Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98793