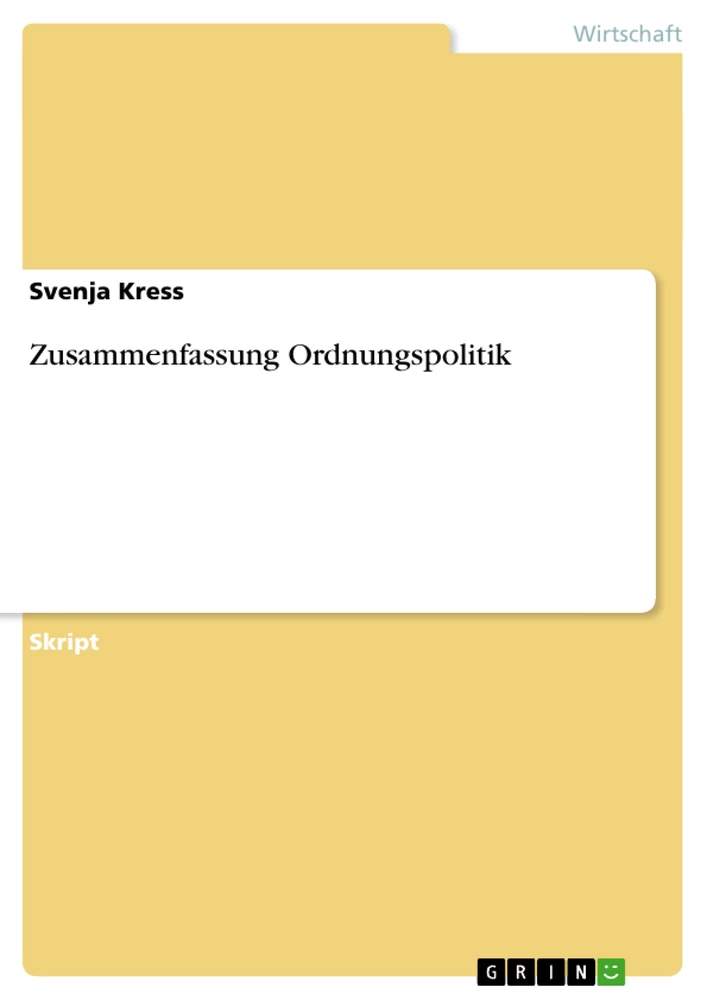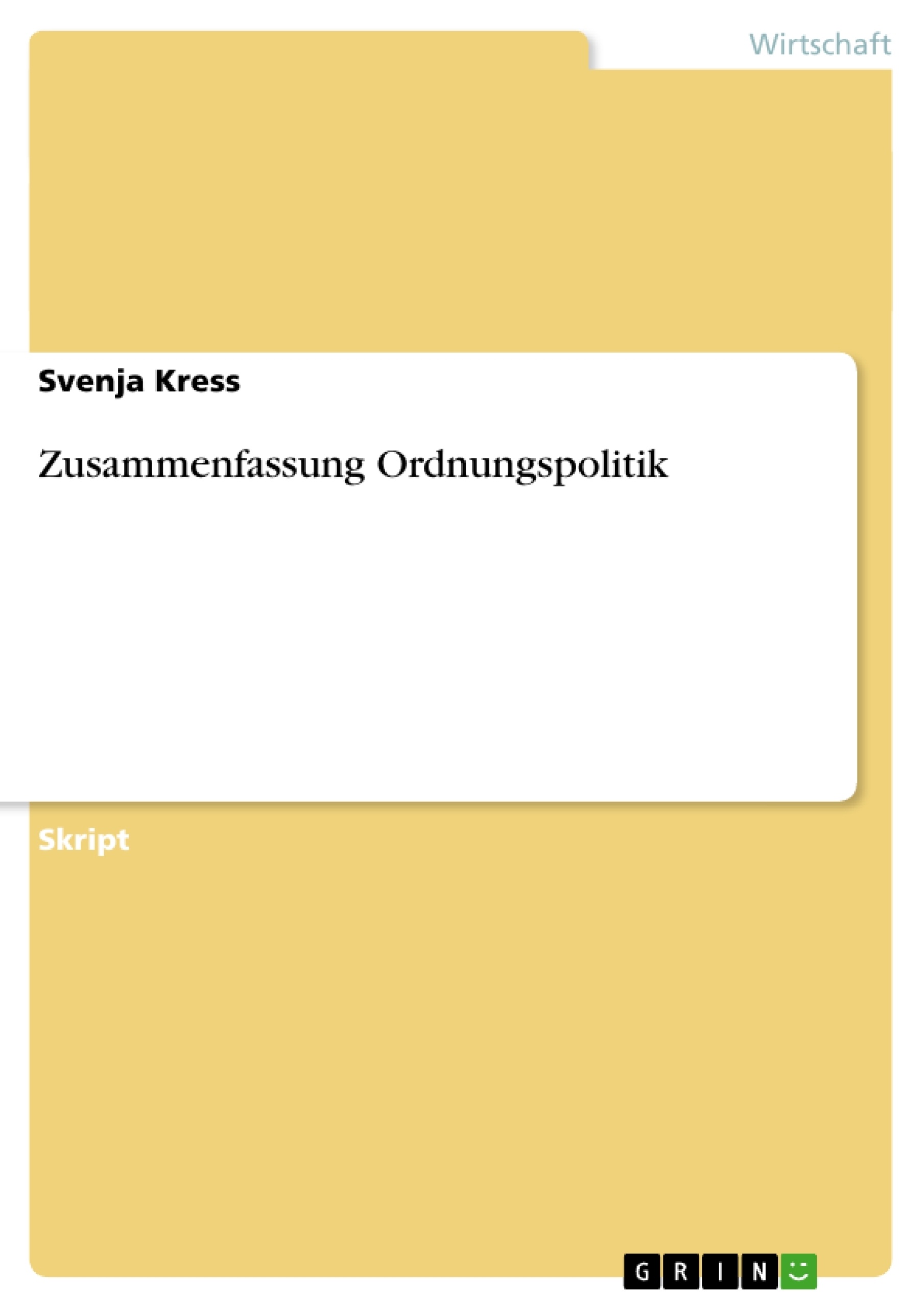Zusammenfassung Seminar Ordnungspolitik
längerfristige rechtlich-organisatorische Rahmenbedingungen Eingrenzen der Handlungs- und Entscheidungsspielräume
? Solzialordnung zwischen Liberalismus und Schutz
Ziel: Wohlfahrtsgewinn für alle Mitglieder einer Gemeinschaft Kollektivinteresse erste GKV 1883 Bismarck, früher eher Lohnersatz kostentreibend
Problem: KOSTENEXPLOSION, Ausgaben 11,5% des BIP ca. 3.000,00 DEM/ Kopf (1970 noch DEM 400,00) mit steigender Tendenz, vor allem in Ostdeutschland mögliche Gründe:
? ? demographische Entwicklung
? ? technischer Fortschritt
? ? konjunkturelle Entwicklung
? ? allgemeine Preissteigerungen (Inflation)
? ? gesellschaftliche Entwicklung (superiore Güter)
? ? Gesundheitsbewußtsein der Patienten
? ? Ineffizienz durch falsche Anreize
(Abhängigkeiten zw. Punkt 1 und 2 strittig)
Es fehlt die Koordination der Interessen (Marktwirtschaftlich möglich, Voraussetzung: Marktfähigkeit der Güter und Leistungen)
Gleichzeitig: Schwächen des Versicherungsprinzips (Umverteilungselemente,
Sachleistungsprinzip, kassenärztliche Bedarfsplanung, Arbeitgeberanteil), Teufelskreis der Beitrags-Anspruchs-Spirale (Free Rider, Moral hazard, angebotsinduzierte Nachfrage? Anspruchsdenken/ Nachfrage ? ? Steigende Defizite bei den Kassen ? Beiträge ? ? da capo)
Thema 1: Ordnungspolitische Gestaltungsalternativen der Gesundheitsversorgung
Leistungsträgerschaft:
Privat (USA)
Staatlich (GB)
Mischsysteme (Kanada, NL, Deutschland)
Ordnungsprinzipien der Daseinsvorsorge nach Sozial oder Individualprinzip
Gestaltungsprinzipien:
Privat: Sparen oder Versicherungsprinzip
staatlich: Versicherungsprinzip, Versorgungsprinzip oder Fürsorgeprinzip (Anspruch "dem Grunde nach", keine garantierten Leistungen, Subsidiaritätsprinzip)
Versicherung kann nach Äquivalenzprinzip,
Vorsorge (genereller Rechtsanspruch) nach dem Äquivalenz- oder Solidarprinzip ausgestaltet sein
Risikoträger und Finanzierungsart variieren entsprechend.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eigenverantwortung (Markt) vs. Schutz des Individuums (Marktversagen)
Sparen = Konsumverzicht, Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bekannt ebensowenig Kosten, potentielle Sozialfälle durch systematisches Unterschätzen des Risikos und Unvorhersehbarkeit
? = Krankheitsw'keit = 0,5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Prämie beträgt somit
Prämiensatz: ? . (wh - wn ) individualäquivalent
Transformation von werw in w! Versicherung gleicht den Verlust bei Krankheit aus. Das heißt, w ist sicheres Vermögen = ? . wn + (1-? ) . wh
in diesem Fall entspricht die Versicherungsprämie der Krankheitswahrscheinlichkeit!
in der Realität sind aber nur 20% der Fälle abschätzbar ? Rückgriff auf Basisindikatoren: Alter, Geschlecht und Risikofaktoren (Vorerkrankungen, "Risk rating" bei gefährlichen Sportarten etc. bei der PKV) Zentrales Problem: Finanzierbarkeit!
ex post - Vergleich ist hier nicht relevant, ex ante ist die Versicherung immer überlegen! Genforschung???
Versicherung = Risikomischung durch das Kollektiv, "Gesetz der großen Zahl" Vorteil: sofort umfassender Schutz
Umverteilungseffekte bei Solidarprinzip (GKV)
reich? arm, jung? alt, Männer? Frauen, kinderlos? kinderreich, gesund? krank
Thema 2: Akteure und Institutionen, Interessen und Konfliktpotentiale
Gebietskörperschaften (Wahl durch den Patienten)
? ? Bund (KaiG)
? ? Länder (Ministerien, Landesbehörden, Gesundheitsämter)
? ? Kommunen (Gesundheitsämter)
? ? EU (Angleichung der Vorschriften, Verbraucherschutz)
Finanzierungsinstitutionen: (Beiträge des Patienten)
? ? Gesetzliche Krankenkassen (AOK, BKK, IKK, Ersatzkassen, See-KK, Bundesknappschaft, Landw. KK)
? ? Weitere SV-Institutionen (LVAs, Berufsgenossenschaften etc.)
? ? Versorgungs- und Fürsorgeinstitutionen
? ? Private KV (Verband von 52 Mitgliedern)
Gesundheit ist "undankbares Thema", Wählerstimmen durch Bevölkerung und durch Verbände, wenig Aufklärung unter der Bevölkerung, Konfliktverlagerung: KaiG bisher nur geringe Durchschlagskraft, reine Kostenorientierung, Dilemma zw. Effizienz des wettbewerblichen Marktes und Sozialprinzip in der Ausgestaltung einzelner Bereiche, es konkurrieren Individual- und Kollektivnutzen
Institutionen der Leistungserbringer: (Nachfrage durch den Patienten)
? ? Kassenärztliche Vereinigungen
? ? Kammern freier Gesundheitsberufe
? ? Krankenhausgesellschaften
? ? Verbände freier Wohlfahrtspflege
? ? Apothekerkammern
Ziele von Ärzteverbänden:
Schutz vor Wettbewerb
Zugang zu öffentlichen Mitteln
Durchsetzung von Preisdifferenzen (Abschöpfung durch preisdiff. Monopol)
Kontrolle des Marktzutritts
heute existierende Regelungen zu Gunsten der Ärzteschaft:
freie Arztwahl
Kollektivverträge und Selbstkontrolle (Ärzte die nachher wieder praktizieren als Kontrollorgane)
Einzelleistungsvergütung
allgemeine Kassenzulassung
Numerus Clausus/ Medizinertest
Selbstverwaltung (Zahlung der Kassen an die Verbände)
4,2 Mio Beschäftigte im deutschen Gesundheitswesen
Finanzierung zu 61% durch die GKV, 11% durch öffentliche Hand, 7,7% durch PKV, 10% durch private HH und Rest durch GRV
kaum internationale Konkurrenz
Doppelrolle der KV und Ärzte auch als Arbeitgeber, oft ausgenutzt als Argument für höheren Finanzierungsbedarf, geringer Organisationsgrad des paramedizinischen Personals
Trends:
? ? vom Allgemeinmediziner zum Facharzt, mehr in Krankenhäusern als ambulant
? ? vom Akut- zum Spezialkrankenhaus, von kleinen zu großen, von öff. zu privaten
Leistungsnehmer:
Gesundheit = Grundlage des Einkommens
Existenzsicherung, aber Nutzenmaximierung, d.h. möglichst wenig Einkommensverlust systematisches Unterschätzen des Risikos = Versicherungspflicht keine Organisation für Rechte/ Interessen der Patienten (weitestgehend fremdbestimmt durch Vorschriften und Informationsmangel) Markttheorie/Theorie über Kollektiventscheidungen kann somit nicht angewandt werden
Konfliktpotential:
Gemeinwohl ? materielles Individualinteresse Macht, Opportunismus technischer Fortschritt, bestmögliche Qualität ? Kosten
Wählerstimmen ? Kostenkontrolle, Krankenhausträgerschaft der öffentlichen Hand Rationalisierung ? Arbeitsplatzerhalt
Eid des Hypokrates ? Zieleinkommen
(Thema 3: Marktversagen auf Märkten für Gesundheitsgüter) selbst
Pareto-Optimum bei marktwirtschaftlicher Gestaltung?
Angebot:
angebotsinduzierte Nachfrage, Einkommensorientierung der Leistungserbringer, Honorarverfahren, Ärztedichte (Abbau von NF-Überhang, Qualitätsverbesserung, umgekehrte Kausalität?)
Nachfrage:
Alter, ökonomischer Status, Bildung, nach Gesundheit/ Gesundheitsgütern, preisunelastisch, Sättigung nicht möglich
Gut:
positive Externe Effekte (Kollektivgutcharakter), Optionsgutcharakter, Markttransparenz und Konsumentensouveränität
mehr Berücksichtigung des Outputs, mehr Information, Schulungen der Leistungserbringer bzgl. der Präferenzen der Konsumenten
(Thema 4: Marktversagen auf Krankenversicherungsmärkten) Eva
Adverse Selektion:
asymmetrische Informationsverteilung bei Vertragsabschluß, Nutzenmaximierung der Konsumenten, Abwandern "guter Risiken" ? Neukalkulation der Beiträge ? weiteres Abwandern
Trittbrettfahrerverhalten/ Free Rider:
wenn keine Versicherungspflicht besteht und Individuen sich nicht versichern, sondern auf Eingreifen des Sozialstaates vertrauen ? Belastung der Allgemeinheit Moral Hazard:
nach Vertragsabschluß, Herbeiführen des Schadensfalls, Änderung des Lebensstils, erhöhte Prämien, vertragstreue Mitglieder wandern ab
? gute Risiken würden unterversichert bleiben
Lösungsansätze:
zur Beseitigung der Informationsasymmetrie Signaling:
Reputationen, Garantien, Selbstbeteiligungen, Akzeptanz von Wartezeiten
Screening: (seitens des schlechter informierten)
Gutachten durch sachverständige Dritte oder durch die Kasse selbst
Subventionierung für Bedürftige
Versicherungspflicht
steuerfinanzierte Sicherung
(Thema 5: GKV, Ordnungsprinzipien, Ausgabenentwicklung) Kathrin
Solidarprinzip
Umlageprinzip
Versicherungspflicht Sachleistungsprinzip Selbstverwaltung Subsidiarität
Paritätische Mittelaufbringung: 50% durch Arbeitgeber
Koexistenz von PKV und GKV, Wahlfreiheit ab 6450,- (Pflichtgrenze + Beitragsbemessungsgrenze "Friedensgrenze")
Beitragsatzstabilität angestrebt (somit kein Wettbewerbsparameter) ebenso fester Leistungskatalog in der GKV
Kostendämpfung somit im Vordergrund
Rationierung:
(kann als Aushöhlung des Solidaritätsprinzips? Vollversicherung/ Chancengleichheit gesehen werden)
harte Rationierung: kein privater Zukauf erlaubt
explizite Rationierung: Festlegung von Höchstalter etc. durch Gesetz
kann im Extremfall zu Systemtransformation führen ? Verlagerung der Vorsorge auf den privaten Bereich
add-on Techniken führen zu besseren Diagnosen und Therapiemöglichkeiten, während unterproportionaler Anstieg der Einkommen erwartet wird ? 25% Beitragssatz in 2030 (18,2% demographischer Effekt Rest Medizintechnik)
Rationalisierung:
durch Anreise zu größerer Effizienz und leistungsorientierte Entlohnung können Wirtschaftlichkeitspotentiale bis zu einem gewissen Grad ausgeschöpft werden und so ohne Rationierung zu verbesserter Qualität führen
Zweistufiges Budgetierungssystem: Gesamtvergütung Kasse an Ärztevereinigung und Verteilung über Punktesystem führte zum Hamsterradeffekt, daher inzwischen Praxisbudgets
Thema 6: GKV, Kassenwahlfreiheit und RSA
1992 erste Freigaben der Kassenwahl für Angestellte (50-60% der Versicherten) Kassenwahlfreiheit 1997 auf alle Versicherungsgruppen ausgedehnt, Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhungen, Leistungsumfang seit 1996 vorgeschrieben
RVO-Kassen waren Zuweisungskassen, gewachsenes GKV-System, Kontrahierungszwang und Diskriminierungsverbot da Beiträge einkommensproportional und nicht risikoäquivalent
Wanderungen von AOK und EK zu den BKK (ca. 1 Mio Mitglieder seit Öffnung), der Beitragssatz liegt hier ca. 1% unter dem der AOKn (z.T. durch niedrigere Verwaltungskosten), es haben sich aber auch nicht alle Kassen geöffnet, keine tats. Preissignale durch Beitragssätze, 50% Arbeitgeberanteil ebenfalls problematisch
RSA seit 01.01.1994:
Soll Entsolidarisierung und Risikoentmischung verhindern (Zahlungskraft und Bedarf der Versichertengruppen sehr unterschiedlich)
Instrument zur Verknüpfung von sozialpolitischer Zielsetzung (Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse) ? wettbewerbspolitischer Zielsetzung (zw. den Kassen, keine Anreize zur Risikoselektion)
Risikofaktoren:
Grundlöhne, Familienlast, Alter, Geschlecht, Invalidität
RSA berücksichtigt jedoch nur Alter und Geschlecht!
darüber hinaus werden keine Defizite kompensiert!
Einteilung in Kohorten gemäß Alter und Geschlecht, dann daraus jeweils 3 Statusgruppen und Extraklasse für Rentner (Morbiditätsbedingte Sonderbelastung)
Errechnet werden der Beitragsbedarf für standardisierte Leistungen (also nicht die tats. Ausgaben) anhand von Stichproben pro Kopf für die jeweilige Kohorte und
Finanzkraft der einzelnen Kassen anhand eines rechnerischen Beitragssatz für die risikodurchschnittliche Kasse multipliziert mit der Einkommenssumme der Mitglieder einer Kasse (also nicht der tats. erhobene Beitrag)
Somit ist ein Ausgleich aufgrund von unwirtschaftlicher Handlung im Einzelfall nicht gegeben. (Verwaltungskosten und Gestaltungsleistungen lösen keinen Anspruch aus) So verhindert der RSA Risikoselektion, sichert den Wettbewerb und schafft Effizienzanreize.
Zahlungen folgen in Richtung der AOK (40% Rentneranteil), BKN und Seekasse und von West nach Ost
Volumen insgesamt 14,4 Mrd. DEM
für temporären RSA spricht:
früher keine Wahlfreiheit
für permanenten RSA spricht:
es kommt zur Risikoselektion aufgr. von Informationsasymmetrien seitens der Kassen und seitens der Versicherten aufgrund von Beitragsdifferenzen (schlechte Risiken verbleiben), Monopolisierung der GKV ohne RSA wahrscheinlich
Gegenargumente/ Kritik an der bisherigen Form:
? ? bundesweiter Ausgleich führt zu Verzerrungen zwischen regional tätigen und überregionalen Kassen (regionale erhalten entsprechend mehr oder weniger je nach Verhältnis zum Durchschnitt - fiskalische Äquivalenz nicht gegeben, landesspezifische Abgrenzung jedoch in der Praxis äußerst schwer) auch die Einkommen sind regional u. U. sehr unterschiedlich, dies wird beim RSA aber in der Finanzkraft der Kasse berücksichtigt. Ein Vorschlag zur Verbesserung wäre hier eine kassenübergreifende Poolbildung von Härtefällen und solidarische Finanzierung (gleiches Problem dann auf anderem Niveau?)
? ? administrativ herbeigeführte Umverteilungselemente der GKV sind einziger Grund für Notwendigkeit
? ? Rentensuche und Arbitrage werden so möglich (Kassen und Unternehmen)
? ? die Berechnung des RSA selbst führt zu hohen Verwaltungskosten (Bürokratie) ? ? der Absatzwettbewerb wird noch weiter eingeschränkt (Staat macht bereits bei Leistungen und Beiträgen Vorschriften, absatz- und beschaffungsseitige Einschränkung, Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt)
? ? die Ausgestaltung wird dahingehend kritisiert, daß zu wenig Risikofaktoren berücksichtigt werden und ein "Rosinenpicken" durch jüngere Kassen am Markt zu Vorteilen gereicht (diese sind aber auch bzgl. des Bedarfsatzes entsprechend niedriger einzustufen ... ); andererseits klagt die TK über zu hohe Zahlungsaufforderungen fühlt sich für effizientes wirtschaften bestraft (hier ist auch viel Politik im Spiel!)
Möglichkeit: Zuweisungen und Finanzausgleich bei den Mitgliedern oder Einheitskasse (komplizierte Verwaltung und falsche Anreize)
Freigabe des Wettbewerbs auf der Leistungsseite (es ist nicht hinreichend bekannt, wie die Präferenzen der Konsumenten verteilt sind)
Thema 7: PKV, Ordnungsprinzipien, Funktionsprobleme und Reformbedarf
1950 - 1980 von 100 auf 38 Unternehmen gesunken, heute bereits wieder 52 m(jedoch sehr starke Konzentration 5 große halten 50%, 18 kommen auf 90% ? Teiloligopol mit stabilen Marktpositionen (Übertrittshemmnisse? s.u.) internationaler Wettbewerb kaum gegeben.
GKV-freundliche Gesetzgebung, Musterbedingungen, Mindeststandards sind vorgeschrieben. Es bleibt jedoch Raum für Tarifgestaltung (Angebotsdifferenzierung) im Rahmen von Zusatzleistungen Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, Selbstbeteiligungen etc. Auch Beitragsrückerstattungen werden durchgeführt. Schadensquote knapp 75%, Erstattungsprinzip, freie Arztwahl (Gebührenordnung staatlich festgelegt)
Prämie berechnet sich aus leistungsspezifischen normierten Teilkopfschäden für die jeweilige Altersgruppe getrennt nach Geschlechtern
Individual- und Äquivalenzprinzip, Anwartschaftsdeckungsverfahren (Altersrückstellungen für die Phase der Fehlbeträge: Leistungsausgaben > Nettoprämien, durchschnittlich nur 15 Jahre positive Beiträge) Die Jahresprämie soll im Zeitablauf konstant gehalten werden (in Summe entsprechen sich Nettoprämien und Kopfschäden). Sparen in Periode a für Periode b. Keine Mitversicherung von Angehörigen
Adverse Selektion/ moral hazard ? Screening und Signaling
Die Nettoprämie berücksichtigt Storno- und Sterbewahrscheinlichkeiten Beitragsanpassungen sind jedoch bei Kostensteigerungen +/- 10% möglich Problem: auch die ARS müssen aufgestockt werden ? stärkere Belastung älterer Versicherter (mathematischer Effekt)
Hauptproblem: Wettbewerb um Altversicherte = Bestandswettbewerb Austrittsoptionen sind gegeben, Wiedereintritt jedoch erschwert! Wechselhemmnisse ergeben sich aus
? ? erneute Risikoprüfung durch den Folgeversicherer
Risikozuschläge und Leistungsausschlüsse evtl. sogar Ablehnung, dies ist jedoch keine Willkür der Versicherungen, sondern systemimmanent aufgrund der Risikoäquivalenz
? ? Wartezeiten von 3- 8 Monaten bis der volle Versicherungsschutz greift (viele Versicherer nehmen aus Wettbewerbsgründen Abstand hiervon)
? ? Nichtübertragbarkeit der Altersrückstellungen
mit zunehmendem Alter steigt die Prämie der Folgeversicherung, weil die Jahre des Ansparens nachfinanziert werden müssen. Dies ist nicht versicherungstechnisch zwingend. Die mangelnde Möglichkeit des Rückkaufs ist eine bewußte Flukuationseindämmung
Reformbestrebungen:
Standardtarife gesetzlich vorgeschrieben (ähnl. GKV) in die z. Bsp. Rentner unter Mitnahme der ARS wechseln können, hierüber wird aber unzureichend informiert; bzw. gründen die Kassen Tochterfirmen, in die dann die ARS nicht mitgenommen werden können (Einrechnung der Stornowahrscheinlichkeiten führt zu niedrigeren Prämien insgesamt, d.h. die bei Wechsel verbleibenden ARS kommen allen verbleibenden Mitgliedern zu gute)
Zur Vermeidung von Beitragserhöhungen insbesondere für ältere Mitglieder ist die PKV verpflichtet 80% des Zinsmehrgewinns (Teil über den angerechneten 3,5%) hälftig auf über 65-jährige und übrige Mitglieder aufzuteilen.
Übertragung der rechnungsmäßigen ARS: wenn nur durchschnittliche Anteile mitgegeben werden könnten ohne Kontrahierungszwang oder RSA nur gute Risiken wechseln, die also voraussichtlich nicht mehr als die mitgebrachte ARS verbrauchen werden ? adverse Selektion
Übertragung der individuellen ARS hier würden die übertragenen Sparsummen genau dem zu erwartenden Risiko entsprechen, somit wären die PKV guten und schlechten Risiken ggü. indifferent. Diese Möglichkeit scheitert aber an der praktischen Durchführbarkeit einer genauen Risikoüberprüfung und -beurteilung. (Kassen würden sich hierüber nicht einig)
Der Verzicht auf ARS würde die Beiträge/ Prämien zum Alter hin ansteigen lassen hier entsteht die Gefahr potentieller Sozialfälle. Weiterhin würde adverse Selektion stattfinden.
Im Zusammenhang mit der Versicherungspflichtgrenze müßte überprüft werden, ob die Versicherten der PKV (ca. 25% der Bevölkerung nicht versicherungspflichtig) nicht grundsätzlich höhere Einkommen beziehen und auch höhere Vermögen besitzen, so daß die höheren Selbstbeteiligungen oder Prämien im Alter sogar finanzierbar sind. (Substitutive, keine Versicherungspflicht/ Nichtsubstitutive, Freistellung auf Antrag) Sozialverträglichkeit? neue Armutsklasse?
Verschärfung der Informationspflicht
Thema 8: private Gesundheitsversorgung in den USA
keine Versicherungspflicht in den USA für Härtefälle Medicare und Medicaid (steuerfinanziert), Fürsorgeprinzip Ziel: kostenbewußte, flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung
Ergebnisse:
Abbau von Krankenhauskapazitäten (-34% 1981 - 1993), etwa ½ des Volumens in der BRD, Verweildauer in der BRD ebenfalls doppelt so hoch
Marktdurchdringung HMO 39% (Zusammenschluß von Leistungsanbietern und Versicherung), Zusammen mit POS (Partnerschaft von Ärzten) und PPO (Versicherung mit Netzwerk von Ärzten, dennoch Wahlfreiheit bei Eigenanteil) 54,6% Managed Care 1996, 77% in 1998
Pluralität der Kostenträger ? Käufermarkt (im Gegens. zu deutschen Kollektivverträgen und Gebührenordnungen)
insgesamt stärkerer Einfluß auf die Leistungserbringer, intensive Interaktion kein geschlossenes Konzept, sondern Sammlung von Instrumenten mehr Eigenverantwortung der Verbraucher
Prämienkalkulation nach gruppenbezogener Risikoäquivalenz, keine individuellen Risikoaufschläge und Diskriminierungsverbot
Niedergelassener Arzt als Kostenhebel, hier in der BRD 25% der Kosten Rest bei verwiesenen Leistungsträgern - in den USA überwiegend ambulante Behandlung
1. Honorierungssysteme ? Fall-/ Kopfpauschalen (ökonomische Anreize) Capitation
2. Qualitätsnormen ? Positivlisten, Peer Review, Kontrollen, Behandlungsrichtlinien
3. Vorstrukturiertes Leistungsangebot ? Primärarztsystem, Gatekeeper, Prävention, Koordination
Für den Versicherten:
? ? geringere Kosten und breites Leistungsspektrum
? ? Prävention
? ? Koordination
? ? aber auch Einschränkung der Wahlmöglichkeiten
Für die Leistungserbringer:
? ? Verpflichtung zur Koordination und Information
? ? Mehr Kontrolle (Wirtschaftlichkeit von Technologien)
? ? Einschränkung der Behandlungsfreiheit
? ? fester Patientenstamm
Kritik:
? ? Neue Verfahren und Therapieformen könnten nicht zur Anwendung kommen
? ? Gefahr der Qualitätseinbußen
? ? Arbeitslosigkeit und Jobwechsel
? ? Bürokratie, mangelnde Entscheidungseffizienz
(Thema 9: staatliche Gesundheitsversorgung in GB) Christian
Thema 10: Internationaler Effizienzvergleich von Gesundheitssystemen
Komponenten von Effizienz: Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Qualität, hier ist auch normierende Beurteilung enthalten "wünschenswertes Ergebnis" Verhältnis von Input und Output soll gemessen werden:
Die Gesundheitsausgaben sind jedoch nicht unbedingt aussagekräftig für das Input! Genauere Daten zu den einzelnen Faktoren sowie Umwelteinflüsse (Tuberkulose im Ruhrgebiet), Lebensweise (individuelle Maßnahmen), Ernährung und sozialer Kontext (vorzeitige Sterblichkeit in Berliner Stadtteilen) gelten als äußerst einflußreich (Vgl. Utah und Nevada, Sterberaten sind schon gesunken bevor entscheidende Medikamente erfunden wurden, Gesundheit von Kindern deren Eltern weniger für Gesundheit ausgeben)
Wirksamkeit und Leistung (Output) sind ebenfalls äußerst schwer meßbar.
Indikatoren:
? ? Säuglingssterblichkeit (bei Herausrechnen des pK - BIP keine Signifikanz der
Gesundheitsausgaben)
? ? Lebenserwartung (mit oder ohne Säuglingssterblichkeit)
? ? Zufriedenheit
Hinzu kommt die Problematik international in Art und Umfang sehr unterschiedlicher Berechnungen der relevanten Daten. Zum Beispiel die Abgrenzung zwischen Gesundheits- und Sozialleistungen.
Die Produktionsfaktoren sind die Leistungserbringer aber auch deren Ausbildung und die Organisation von Faktorleistungen sowie technischer Fortschritt spielen hierbei eine Rolle.
Verschiedene Ansätze der Effizienzmessung von Einzelleistungen (mikroökonomische Ansätze) aber nur vergleichend zwischen 2 Handlungsalternativen und unter Berücksichtigung des Ergebnisses:
Kosten-Effektivitäts-Analyse: Kosten in GE/ Erträge in gewonnenen Lebensjahren
qualitativ identische Wirkung und keine Nebenwirkungen sind Bedingung diese Methode liefert nur eine Rangordnung, nur ein festes Budget kann hier zu eindeutiger Lösung führen
Kosten-Nutzwert-Analyse und QUALY's:
hier werden als Outputgröße qualitätsbereinigte Lebensjahre verwendet, mehrdimensionale Betrachtung: Umrechnung von Lebensqualität in Lebensdauer 1 Qualy ist ein Lebensjahr im Idealzustand also bei optimaler Gesundheit ( Skala 0 = Tod - 1 = vollständige Gesundheit)
Hierzu gibt es einen speziellen Fragebogen der verschiedene Gesundheitsdimensionen abdeckt
Kosten in GE/ gewonnene QUALY's
aber auch hier ist die Übertragung individuellen Empfindens auf die Gemeinschaft schwierig
Kosten-Nutzen-Analyse:
positive Meßergebnisse werden hier in Geldeinheiten bewertet. Die Bewertung selbst ist aber äußerst fraglich.
ethisch äußerst Problematisch, daher öffentliche Diskussion eher makroökonomisch - der Mensch als statistische Größe.
Auch wird weniger auf die Wirtschaftlichkeit einer medizinischen Leistung abgezielt, sondern die Organisation und Finanzierung angegriffen. Also keine undifferenzierte Kostendämpfung mit der Folge unmenschlicher Einzelentscheidungen (s. auch Rationierung)
In Deutschland "Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information" DIMDI analysiert Kosten und Nutzen medizinischer Verfahren, Produkte und übergeordnete Prozesse (Rehabilitationen). Hierbei werden auch soziale, rechtliche, ethische und epidemilogische Aspekte berücksichtigt
Bei einem internationalen Vergleich der Systeme muß man die Strukturen genaustens berücksichtigen.
Die Lebenserwartung scheint nicht mit den pK - Ausgaben zu korrelieren (Bsp. USA und Griechenland) Ebenso ist die Zufriedenheit trotz der hohen Ausgaben in den USA (Staatsanteil nur ca. 40%) wesentlich geringer, in England (niedrige pK - Ausgaben, aber staatl. Anteil 80%) dagegen herrscht große Zufriedenheit.
das realisierte System als Kostenverursacher verzerrt die Ergebnisse dieser Betrachtung ist aber auch nicht allein verantwortlich für die Unterschiede in den einzelnen Ländern. Insgesamt ist es noch nicht gelungen einen Index zu finden, der Vergleiche möglich macht. Der einzelne Fall bleibt hier ausschlaggebend - Informationen, Vorsorge, Bildung und Sensibilisierung der Patienten würde in jedem Fall das Verantwortungsgefühl für den Umgang mit knappen Ressourcen steigern und so zu mehr Effizienz führen.
REFORMANSÄTZE
Kassen - Patienten:
? ? individuelle Beteiligung der Versicherten (Selbstbehalt)
? ? Ausnutzen von Effizienzpotentialen
? ? Beitragsrückerstattungen aber jährlicher Gesundheitscheck (mehr Vorsorge)
? ? Mehr Information über Wahlrechte der Patienten
? ? Schaffen "echter" Wahlrechte
Kassen - Leistungserbringer:
? ? Outputorientierte Honorierung (z. Bsp. Einschreibung)
? ? weniger kollektive Verhandlungen
? ? Ökonomisierung, Wettbewerb zwischen Kassen und Leistungserbringern (Angebots-
und Beschaffungsseite)
Leistungserbringer - Patienten:
? ? Aufklärung der Patienten
? ? Schulung der Anbieter über die Präferenzen
Gesundheitsreform: Gesundheitsstrukturgesetz (erstmals ordnungspolitisch) 1992
? ? Praxisnetze eingeschränkte Wahlfreiheit
? ? mehr ambulante Behandlung
? ? Fallpauschalen
? ? Datenaustausch zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen und Koordination ? ? bessere Wirksamkeitskontrollen bei Medikamenten
Reformvorschläge für GKV:
1. Finanzierung
Herausnahme von Umverteilungselementen ? risikoäquivalente Prämien + Transfers Freigabe zusätzlicher Wettbewerbsparameter (Angebots- und Beschaffungsseite) Freie Wahl des Erstattungsprinzips/ Selbstbeteiligung/ Beitragsrückerstattung (evtl. i.V.m. jährlicher Pflichtuntersuchung)
Abschaffung oder Festschreibung der Arbeitgeberbeiträge
2. Ambulante Versorgung
Abschaffen der Bedarfsplanung
Niederlassungsfreiheit und keine Zwangsmitgliedschaft in Verbänden Freigabe der Honorierungsformen Unregulierte Werbung
3. Stationäre Versorgung
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptprobleme im deutschen Gesundheitssystem laut dieser Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung nennt eine Kostenexplosion, Ineffizienz durch falsche Anreize, fehlende Koordination der Interessen und Schwächen des Versicherungsprinzips (Umverteilungselemente, Sachleistungsprinzip etc.) als Hauptprobleme.
Welche ordnungspolitischen Gestaltungsalternativen der Gesundheitsversorgung werden erwähnt?
Die Alternativen sind privat (USA), staatlich (GB) und Mischsysteme (Kanada, NL, Deutschland). Es wird auch auf die Prinzipien der Daseinsvorsorge nach Sozial- oder Individualprinzip eingegangen.
Welche Akteure und Institutionen sind im Gesundheitswesen beteiligt?
Genannt werden Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Kommunen, EU), Finanzierungsinstitutionen (gesetzliche Krankenkassen, private Krankenversicherungen) und Institutionen der Leistungserbringer (Kassenärztliche Vereinigungen, Kammern freier Gesundheitsberufe, Krankenhausgesellschaften etc.).
Welche Konfliktpotentiale existieren im Gesundheitswesen?
Konflikte bestehen zwischen Gemeinwohl und materiellem Individualinteresse, Macht und Opportunismus, technischem Fortschritt und Kosten, Wählerstimmen und Kostenkontrolle, Rationalisierung und Arbeitsplatzerhalt sowie dem Eid des Hippokrates und Zieleinkommen.
Welche Arten von Marktversagen werden auf Märkten für Gesundheitsgüter identifiziert?
Angebotsinduzierte Nachfrage, Einkommensorientierung der Leistungserbringer, Preisunelastizität der Nachfrage sowie positive externe Effekte und mangelnde Markttransparenz werden genannt.
Wie äußert sich Marktversagen auf Krankenversicherungsmärkten?
Adverse Selektion, Trittbrettfahrerverhalten (Free Rider) und Moral Hazard werden als Formen des Marktversagens genannt. Lösungsmöglichkeiten werden auch besprochen.
Was sind die Ordnungsprinzipien der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)?
Solidarprinzip, Umlageprinzip, Versicherungspflicht, Sachleistungsprinzip, Selbstverwaltung und Subsidiarität.
Was ist der Risikostrukturausgleich (RSA) und welchen Zweck hat er?
Der RSA soll Entsolidarisierung und Risikoentmischung verhindern, indem er Zahlungskraft und Bedarf der Versichertengruppen berücksichtigt und Anreize zur Risikoselektion vermeidet.
Welche Ordnungsprinzipien gelten für die Private Krankenversicherung (PKV)?
Individual- und Äquivalenzprinzip, Anwartschaftsdeckungsverfahren. Probleme und Reformbedarf werden auch angesprochen.
Welche Probleme existieren im Zusammenhang mit der PKV und dem Wechsel zu einer anderen Versicherung?
Erneute Risikoprüfung, Risikozuschläge, Leistungsausschlüsse, Wartezeiten und Nichtübertragbarkeit der Altersrückstellungen erschweren den Wechsel.
Wie ist die Gesundheitsversorgung in den USA und Großbritannien organisiert?
In den USA gibt es keine Versicherungspflicht, sondern Medicare und Medicaid für Härtefälle. In Großbritannien existiert eine staatliche Gesundheitsversorgung.
Welche Komponenten von Effizienz sind im internationalen Effizienzvergleich von Gesundheitssystemen relevant?
Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Qualität. Die Messung von Input und Output sowie die Berücksichtigung von Umwelteinflüssen, Lebensweise und sozialem Kontext sind wichtig.
Welche Reformansätze werden für das deutsche Gesundheitssystem vorgeschlagen?
Individuelle Beteiligung der Versicherten, Ausnutzen von Effizienzpotentialen, mehr Information über Wahlrechte, outputorientierte Honorierung, weniger kollektive Verhandlungen und Aufklärung der Patienten.
- Quote paper
- Svenja Kress (Author), 2000, Zusammenfassung Ordnungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98755