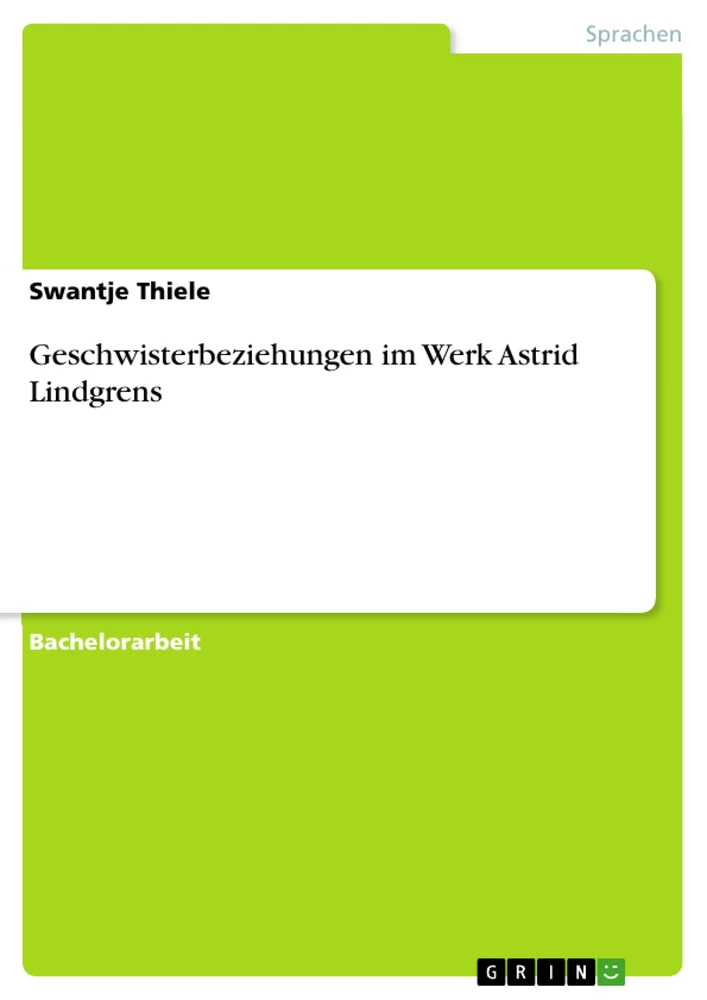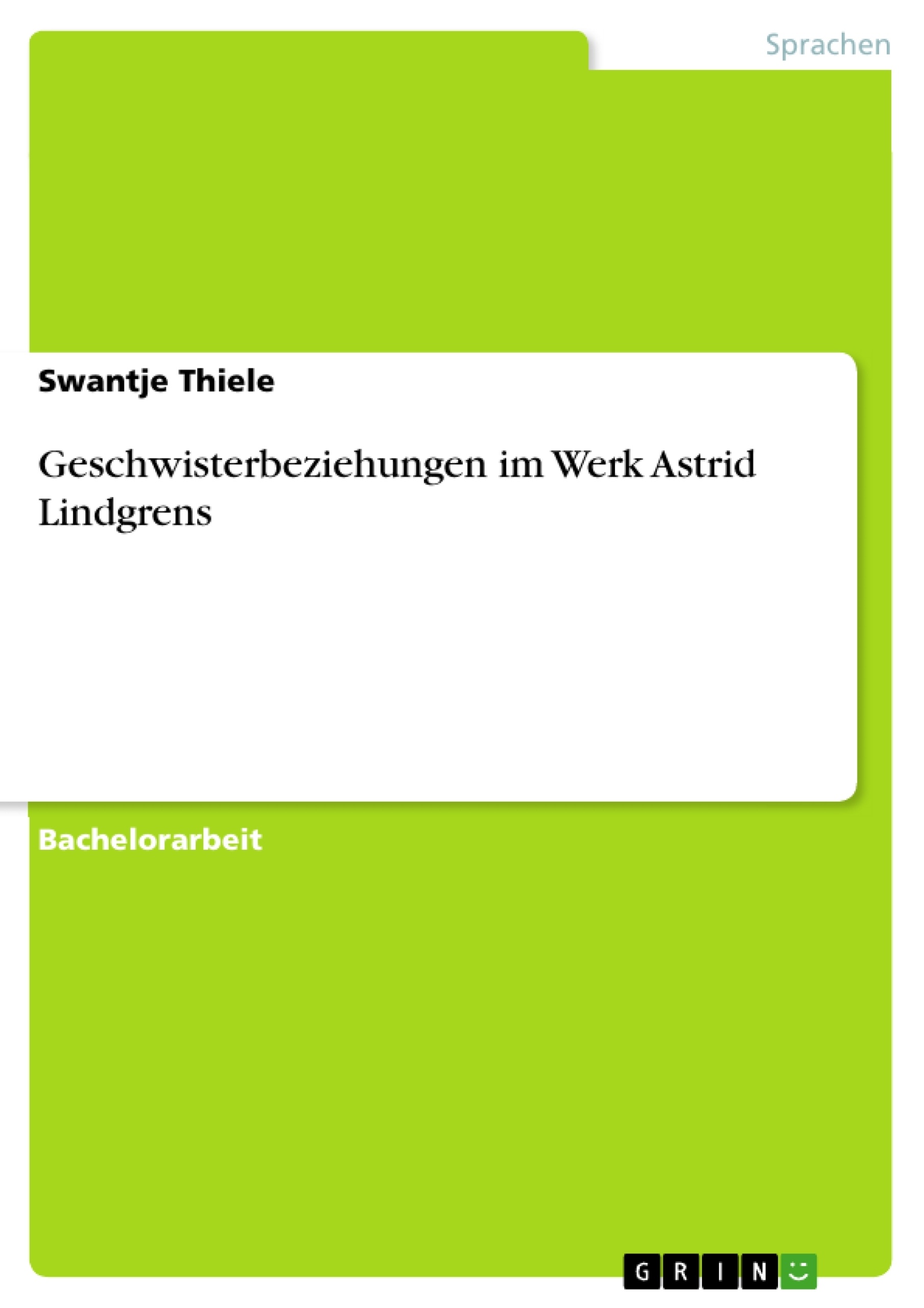Die Bachelorarbeit widmet sich der Geschwisterbeziehung als Motiv in Astrid Lindgrens Werken.
Die Arbeit verfügt über einen theoretischen Teil, indem die Geschwisterbeziehung als psychologisch-soziologisches Phänomen dargestellt und zudem ein Überblick über ihre Verwendung als kinderliterarisches Motiv gegeben wird. Der analytische Teil untersucht einige ausgewählte Werke Astrid Lindgrens genauer und beschreibt die jeweilige Darstellung der Geschwisterbeziehung.
In Kapitel 1 werden dabei vorläufig die theoretischen Grundlagen, welche das Fundament der Analyse bilden, dargestellt und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Brüder und Schwestern – eine spezielle Form familiärer Beziehungen
- Die Geschwisterbeziehung in der (Kinder-)Literatur
- Analyse
- „Und wir spielten und spielten und spielten“: Geschwisterbeziehungen in ausgewählten Werken
- Die Kinder aus Bullerbü
- Madita
- Ich will auch Geschwister haben
- Die Brüder Löwenherz
- Geschwisterlosigkeit als Mangel in Nils Karlsson-Däumling
- „Ich wünschte, du wärst mein Bruder!“: Wahlgeschwister in Ronja Räubertochter
- „Und wir spielten und spielten und spielten“: Geschwisterbeziehungen in ausgewählten Werken
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Geschwisterbeziehungen im Werk Astrid Lindgrens. Ziel ist es, die Bedeutung und Funktion von Geschwisterbeziehungen (und deren Abwesenheit) in ausgewählten Werken zu analysieren und die zugrundeliegenden Motive und Themen zu identifizieren. Dabei wird auch der Bezug zur Biografie der Autorin betrachtet.
- Die Ambivalenz von Geschwisterbeziehungen: Liebe und Konflikte
- Die Rolle von Geschwistern in der kindlichen Entwicklung und Selbstfindung
- Der Einfluss autobiografischer Elemente auf die Darstellung von Geschwisterbeziehungen
- Geschwisterbeziehungen im Kontext von Spiel und kindlicher Freiheit
- Der Wunsch nach Geschwistern und die Erfahrung von Geschwisterlosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt mit einem Zitat aus "Die Kinder aus Bullerbü" die Ambivalenz von Geschwisterbeziehungen ein – Liebe und Ärger existieren nebeneinander. Sie hebt die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen in der Entwicklungspsychologie hervor und stellt fest, dass dieses Thema in vielen Werken Astrid Lindgrens präsent ist, von spielerischen Auseinandersetzungen bis hin zu bedingungsloser Liebe. Die Einleitung betont den autobiografischen Bezug und die Frage nach der Funktion von Geschwisterbeziehungen in Lindgrens Erzählungen. Sie kündigt an, dass die Arbeit die Motive und Themen im Zusammenhang mit den dargestellten Geschwisterbeziehungen untersuchen wird. Der Bezug zu Lindgrens eigener Kindheit mit drei Geschwistern wird hergestellt, und es wird die These aufgestellt, dass ihre realistischen Erzählungen auf ihren Kindheitserinnerungen beruhen.
Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es behandelt die Geschwisterbeziehung als eine spezielle Form familiärer Beziehungen, indem es auf die einzigartige Dynamik und die Ambivalenz der Beziehung eingeht. Der zweite Teil des Kapitels fokussiert auf die Darstellung von Geschwisterbeziehungen in der Kinderliteratur, möglicherweise unter Berücksichtigung der spezifischen literarischen Mittel und Konventionen, die von Astrid Lindgren verwendet werden.
Analyse: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Geschwisterbeziehungen in ausgewählten Werken Astrid Lindgrens. Es untersucht die verschiedenen Facetten der Geschwisterbeziehungen, von der spielerischen Rivalität bis zur tiefen Verbundenheit, und setzt dies in Beziehung zur Entwicklung der Protagonisten. Die Analyse wird wohl die verschiedenen Arten der Darstellung von Geschwisterbeziehungen in verschiedenen Genres (realistische Erzählungen versus fantastische Geschichten) vergleichen und kontrastieren. Der Wunsch nach Geschwistern und das Thema der Geschwisterlosigkeit werden ebenfalls behandelt. Die Kapitel untersuchen die spezifischen Beziehungen in "Die Kinder aus Bullerbü", "Madita", "Ich will auch Geschwister haben", "Die Brüder Löwenherz" und "Ronja Räubertochter" und analysieren, wie diese Beziehungen die Handlung und die Charakterentwicklung beeinflussen. Das Kapitel untersucht auch die Geschwisterlosigkeit in "Nils Karlsson-Däumling" und den Begriff der Wahlgeschwister in "Ronja Räubertochter".
Schlüsselwörter
Astrid Lindgren, Geschwisterbeziehungen, Kinderliteratur, Ambivalenz, Liebe, Konflikt, Spiel, Autobiografische Elemente, Entwicklungspsychologie, Motivforschung, Themenforschung, Realismus, Fantasie, Einzelkind, Wahlgeschwister, Familie.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Geschwisterbeziehungen in Astrid Lindgrens Werken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Geschwisterbeziehungen in ausgewählten Werken Astrid Lindgrens. Der Fokus liegt auf der Bedeutung und Funktion dieser Beziehungen (und deren Abwesenheit) in den Geschichten, den zugrundeliegenden Motiven und Themen sowie dem autobiografischen Bezug zur Autorin.
Welche Werke von Astrid Lindgren werden untersucht?
Die Analyse umfasst folgende Werke: „Die Kinder aus Bullerbü“, „Madita“, „Ich will auch Geschwister haben“, „Die Brüder Löwenherz“, „Ronja Räubertochter“ und „Nils Karlsson-Däumling“.
Welche Aspekte der Geschwisterbeziehungen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Facetten der Geschwisterbeziehungen, darunter die Ambivalenz von Liebe und Konflikt, die Rolle der Geschwister in der kindlichen Entwicklung und Selbstfindung, den Einfluss autobiografischer Elemente, Geschwisterbeziehungen im Kontext von Spiel und kindlicher Freiheit sowie den Wunsch nach Geschwistern und die Erfahrung der Geschwisterlosigkeit. Der Vergleich zwischen realistischen und fantastischen Erzählungen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind die Ambivalenz von Geschwisterbeziehungen, die Rolle von Geschwistern in der kindlichen Entwicklung, der Einfluss autobiografischer Elemente, Geschwisterbeziehungen im Kontext von Spiel und kindlicher Freiheit sowie der Wunsch nach Geschwistern und die Erfahrung von Geschwisterlosigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Theorieteil, einen Analyseteil und einen Schluss. Der Theorieteil legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Geschwisterbeziehungen. Der Analyseteil untersucht die ausgewählten Werke von Astrid Lindgren, wobei die verschiedenen Arten der Darstellung von Geschwisterbeziehungen verglichen und kontrastiert werden. Die Einleitung führt in die Thematik ein und der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Astrid Lindgren, Geschwisterbeziehungen, Kinderliteratur, Ambivalenz, Liebe, Konflikt, Spiel, autobiografische Elemente, Entwicklungspsychologie, Motivforschung, Themenforschung, Realismus, Fantasie, Einzelkind, Wahlgeschwister, Familie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Bedeutung und Funktion von Geschwisterbeziehungen (und deren Abwesenheit) in ausgewählten Werken Astrid Lindgrens und die Identifizierung der zugrundeliegenden Motive und Themen. Dabei wird auch der Bezug zur Biografie der Autorin berücksichtigt.
Wie werden die Geschwisterbeziehungen in den einzelnen Werken analysiert?
Die Analyse untersucht die spezifischen Beziehungen in den einzelnen Werken und analysiert, wie diese Beziehungen die Handlung und die Charakterentwicklung beeinflussen. Es wird beispielsweise die spielerische Rivalität und die tiefe Verbundenheit in den verschiedenen Geschichten beleuchtet.
Gibt es einen autobiografischen Bezug in der Arbeit?
Ja, die Arbeit betrachtet den Einfluss autobiografischer Elemente auf die Darstellung von Geschwisterbeziehungen in Astrid Lindgrens Werken und berücksichtigt den Bezug zu Lindgrens eigener Kindheit mit drei Geschwistern.
- Citation du texte
- Swantje Thiele (Auteur), 2014, Geschwisterbeziehungen im Werk Astrid Lindgrens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987545