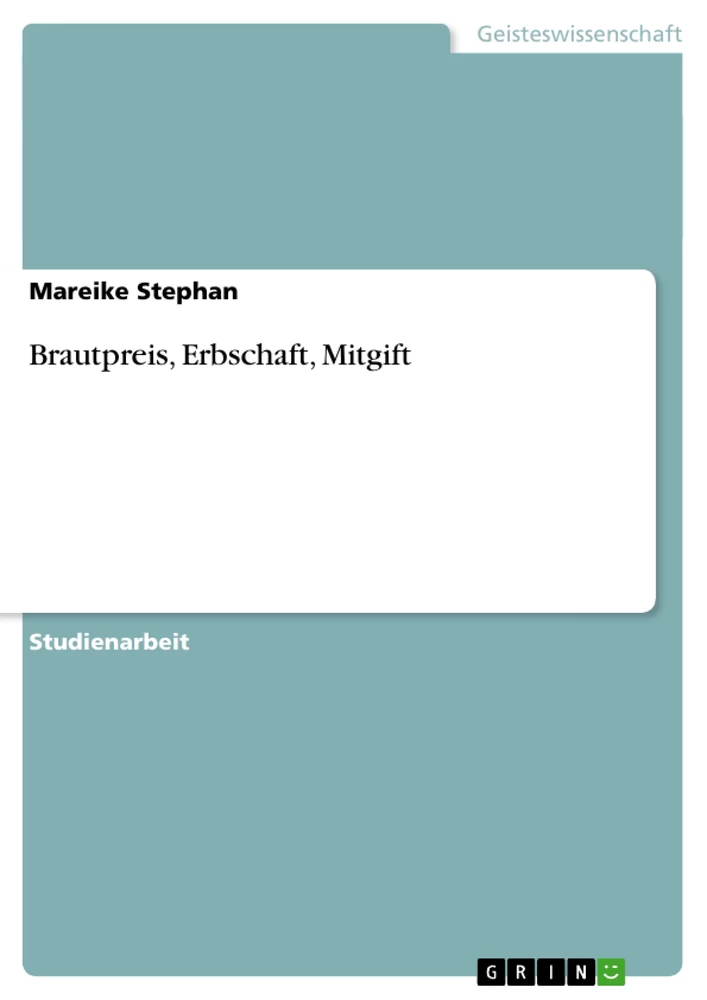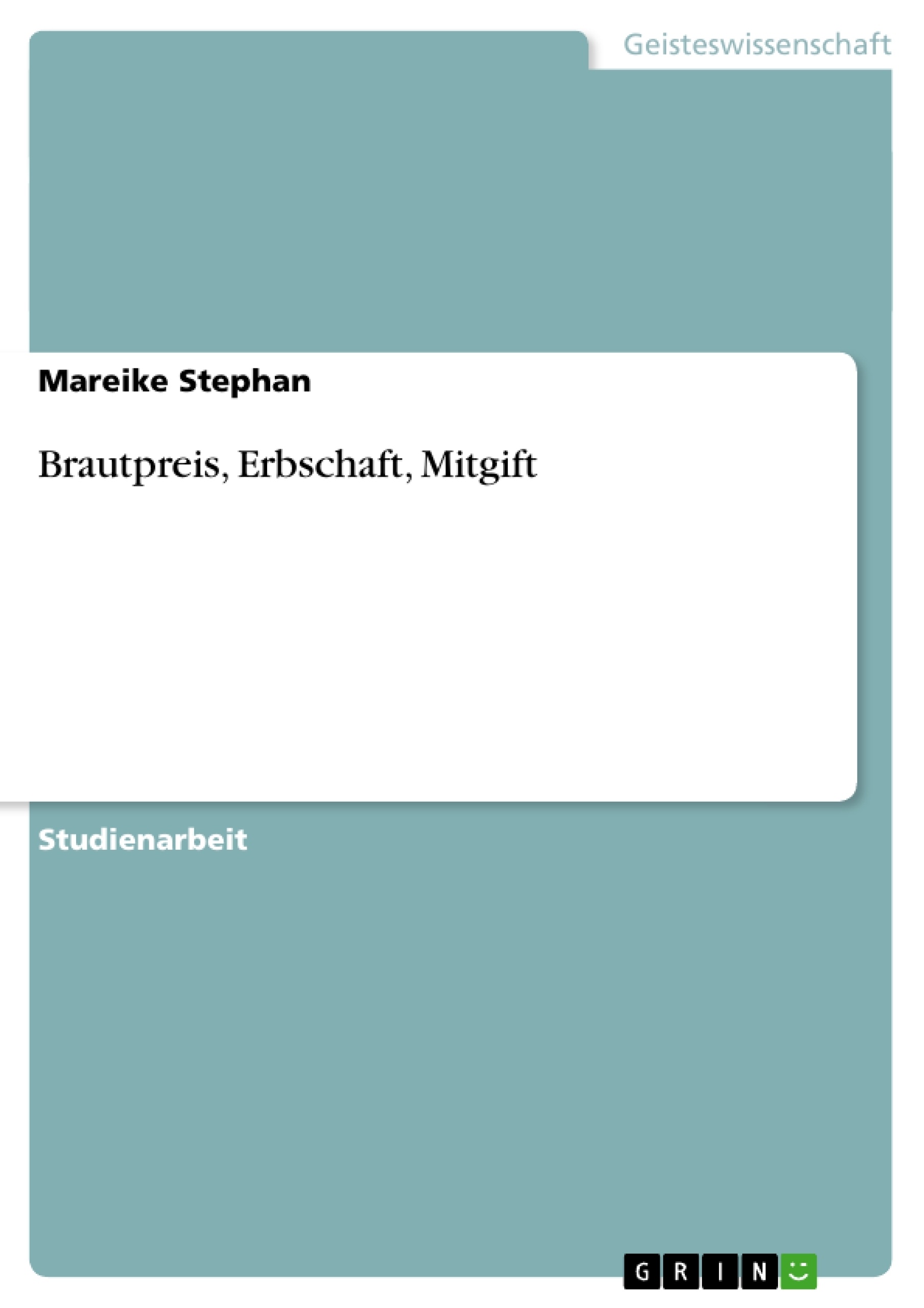Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Ehe nicht nur eine Frage der Liebe, sondern auch des Handels und der Tradition ist. Diese fesselnde Studie entführt Sie in die komplexen und oft überraschenden Welten von Brautpreis, Erbschaft und Mitgift – drei Säulen, die das Fundament vieler Gesellschaften über Jahrhunderte hinweg geprägt haben. Von den einfachen Jäger- und Sammlergesellschaften Afrikas bis hin zur europäischen Arbeiterschicht des Mittelalters beleuchtet dieses Buch die vielfältigen Formen und Funktionen von Heiratstransaktionen rund um den Globus. Entdecken Sie, wie der Brautpreis nicht nur als "Preis" für eine Frau missverstanden werden darf, sondern vielmehr als ein komplexes Tauschgeschäft fungiert, das die soziale Ordnung und den Fortbestand der Familie sichert. Tauchen Sie ein in die subtilen Unterschiede zwischen direkter und indirekter Mitgift, und verstehen Sie, wie diese Traditionen die Rolle der Frau in verschiedenen Kulturen beeinflussen. Erforschen Sie die oft ungleichen Verteilungen von Erbschaften, die Töchter benachteiligen und den Fortbestand des väterlichen Besitzes sichern sollen. Anhand von Beispielen aus Europa, Asien und Afrika werden die ökonomischen, sozialen und kulturellen Implikationen dieser Praktiken aufgedeckt. Erfahren Sie, wie sich diese Traditionen im Laufe der Zeit verändert haben und welche Auswirkungen die moderne Gesellschaft auf Brautpreis-, Mitgift- und Erbschaftspraktiken hat. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Anthropologie, Soziologie, Geschlechterforschung und die faszinierenden Verflechtungen von Kultur und Wirtschaft interessieren. Es bietet eine neue Perspektive auf die Ehe als Institution und die Rolle von Frauen im globalen Kontext. Begleiten Sie uns auf eine außergewöhnliche Reise durch die Welt der Heiratstransaktionen und entdecken Sie die verborgenen Kräfte, die unsere Gesellschaften bis heute prägen. Lassen Sie sich fesseln von den Geschichten hinter den Zahlen und den Schicksalen der Menschen, die in diesem komplexen System gefangen sind. Dieses Buch wirft ein helles Licht auf die oft übersehenen Aspekte der Ehe und bietet einen tiefen Einblick in die menschliche Natur. Die feinen Unterschiede der Traditionen und Gebräuche werden hier verständlich erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1) Brautpreis
2) Erbschaft
3) Mitgift
3.1) Mitgift als vorgezogene Erbschaft
3.2) Direkte Mitgift
3.3) Indirekte Mitgift
Schluss
Abbildungen
Bibliographie
Einleitung
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit Heiratstransaktionen verschiedener Gesellschaften in Europa, Asien und Afrika. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es werden unterschiedliche Gesellschaftsschichten und -formen betrachtet, wie z.B. einfache Jäger- und Sammlergesellschaften Afrikas oder die englische Arbeiterschicht.
Gründe für die Heiratstransaktionen gibt es verschiedene, je nachdem aus wessen Blickwinkel man es betrachtet. Die Familie der Braut hat andere Beweggründe als die des Bräutigams. Sie will bei Brautpreiszahlungen die Tochter gut versorgt wissen, aber auch finanzielle Hintergründe sind wichtig. Je höher der Brautpreis, desto höher ist das Ansehen der Familie. Die Familie des Bräutigams will in erster Linie eine fleißige Frau für den Sohn. Dagegen geht es der Familie der Braut bei Mitgiftzahlungen nur um die gute Verheiratung der Tochter. Dazu gehört eine solide finanzielle Versorgung, ein Ehemann der nicht zu Gewalt neigt und der richtige soziale Status in der Gesellschaft. Wenn man die Tochter in eine höhere Gesellschaftsschicht verheiraten kann, nimmt man auch gerne etwas mehr Mitgift in Kauf. Die Familie des Bräutigams achtet sowohl auf eine hohe Mitgift als auch auf eine fleißige Frau.
Beispiel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zwei Familien treffen Vereinbarungen über die Verheiratung ihrer Kinder bevor diese dem Kindesalter entwachsen sind. Dabei spricht man vom Austausch der Töchter. Es sind aber auch bewegliche Güter mit im Spiel.
Transaktionen wie die obengenannte waren lange Zeit in Europa gültig und werden auch heute noch in Asien und Afrika praktiziert. Sie waren in allen Gesellschaftsschichten üblich und werden bis zum heutigen Tag noch in veränderter Form praktiziert.
Im Folgenden werden die einzelnen Heiratstransaktionen genauer betrachtet.
1) Brautpreis
Definition:
"Brautpreis bildet ein Beweiszeichen für den Ehevertrag, ein Pfand für die gute Behandlung der Frau in der Gruppe des Mannes, ein Entgelt für die Arbeitskraft und Gebärfähigkeit der Frau und eine Regelung der Nachfrage nach Frauen, die in polygynen Gesellschaften prinzipiell unbegrenzt ist."
Der Brautpreis ist auf keinen Fall als der Preis beim Kauf einer Frau zu betrachten, vielmehr als Gegenleistung in einem Tauschgeschäft. Er hat verschiedene Funktionen. Er soll zum einen die Tochter/ Braut an die väterliche Verwandtschaftsgruppe binden, da durch die Tochter die Familie wächst. Zum zweiten wird der Brautpreis als eine Sicherung für eine langanhaltende Ehe gesehen. Wenn ohne Brautpreis geheiratet wird ist die Kontrolle der Eltern über die Tochter größer und der Ausgleich bei Ehebruch fällt geringer aus.
In der Regel verlaufen Brautpreiszahlungen folgendermaßen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach genauen Absprachen über verschiedene Punkte (s. Text weiter unten) zahlt die Verwandtschaft des Bräutigams den Brautpreis an die Verwandtschaft der Braut und erhält im Gegenzug die Braut. Die Absprachen werden über folgende Punkte getroffen:
1. Höhe der Zahlung
2. Zahlart
3. Ob die Zahlung bei frühem Tod oder Scheidung zurückgegeben wird
4. Zahlung fix oder variabel
5. Zeitpunkt der Zahlung
6. Rechte, die die Braut mit dem Transfer erwirbt
Die Höhe der Zahlung ist in den verschiedenen Gebieten Afrikas unterschiedlich. In Ost- und Südafrika fällt der Brautpreis oft geringer aus, da in diesen Gegenden häufiger matrilineare Deszendenzgruppen zu finden sind. Der Grund für den geringen Brautpreis könnte sein, dass mit Matrilinearität auch oft Matrilokalität einhergeht. Der Brautpreis würde also an Ort und Stelle bleiben. In Westafrika gibt es v.a. patrilineare Gesellschaften, daher ist der Brautpreis dort höher.
In Europa wird der Brautpreis v.a. aus beweglichen Gütern bestritten, z.B. Schmuck, Bargeld, Haushaltsgegenstände etc. Dies gilt ebenfalls für Asien, dort sind Stoffe ein beliebtes Zahlungsmittel. In Afrika werden neben Vieh (v.a. in Savanne-Gebieten in Ost- und Südafrika und in Teilen Westafrikas) auch Metallobjekte wie z.B. Hacken in bäuerlichen Familien oder Speere bei Kriegern verwendet. Auch Zierrat wie Ketten und Armbänder sind ein gängiges Zahlungsmittel, besitzen jedoch eher einen ideellen Wert. In Afrika werden auch häufig 'cowrie shells'1 als Zahlungsmittel verwendet.
Die Rückgabe des Brautpreises ist ebenfalls genau geregelt. Sie ist immer abhängig von der Höhe und der Art der Brautpreiszahlung bzw. wie der Brautpreis von der Familie der Braut genutzt wird/ wurde. Aus zwei Anlässen kann der Brautpreis von der Familie des Bräutigams zurückgefordert werden: erstens wenn die Zahlungen von der Fruchtbarkeit der Frau abhängt. Die Frist läuft über mehrere Jahre, z.B. bis die Frau ihr erstes Kind bekommt. Die zweite Möglichkeit ist die frühzeitige Auflösung der Ehe seitens der Frau. Falls die Eltern mit der Rückzahlung der geforderten Summe überfordert sind, wird die Frau entweder dazu gedrängt zu ihrem Ehemann zurückzukehren oder sie muss einen anderen Mann heiraten. Der zweite Fall tritt häufiger ein als der erste. Deshalb gibt es häufig Probleme den Brautpreis zurückzuzahlen. Viele Frauen werden genötigt, bei ihren Ehemännern zu bleiben oder neu zu heiraten.
Der Brautpreis, der für eine Tochter bezahlt wird, wird oft an einen Sohn weitergegeben, damit er seinerseits den Brautpreis zahlen kann. Er wird wie ein Durchlaufposten behandelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Brautpreis dient nicht der Erhöhung des väterlichen Vermögens, er wird vielmehr, wie bereits beschrieben, an die Söhne weitergegeben um ihnen eine Heirat zu ermöglichen. In Hirtengesellschaften gibt es in fast jeder Herde einen bestimmten Anteil an Vieh, der nur für zeremonielle Zahlungen wie z.B. den Brautpreis verwendet wird bzw. er durch ebendiese erhöht wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Europa und Asien wird eher mit Land gehaushaltet, da dies in beiden Ländern kostbares Gut ist, in Afrika nimmt Vieh diese Stellung ein.
Zumeist sind die Beträge fix, aber der "Brautpreismarkt" wird sehr genau überwacht, sowohl von der Familie der Bräutigame als auch von denen der Bräute. Sobald ein Mann für eine Frau einen höheren Brautpreis zahlt, steigt der Preis allgemein an. Wenn der Brautpreis fix ist, haben alle Frauen die gleiche Chance einen Mann zu bekommen.
Der Zeitpunkt der Zahlung ist von den ausgehandelten Bedingungen abhängig. Wenn er z.B. von der Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit der Frau abhängig gemacht wird, erfolgt die Bezahlung erst bei der Geburt des ersten Kindes. In der Regel wird der Brautpreis jedoch sofort gezahlt.
Die Rechte, die die Braut mit der Zahlung des Brautpreises erwirbt, sind die grundsätzlichen Rechte einer Ehefrau.
→ Abb. 1, s. S.11
2) Erbschaft
In Europa wird bei Erbschaftsangelegenheiten großen Wert darauf gelegt, dass das Patrimonium erhalten bleibt. Deshalb hat häufig ein Kind Haus und Ländereien geerbt während alle weiteren Kinder z.B. mit Bargeld, Schmuck etc. abgefunden werden. Der Haupterbe schneidet dabei zumeist am besten ab. Bei divergierender Übereignung ist es jedoch schwierig das Patrimonium als Ganzes zu erhalten. Deshalb wurden Regelungen wie Primogenitur2 oder Ultimogenitur3 eingeführt. Töchter werden meist von der Möglichkeit Grundbesitz zu erben ausgeschlossen. Oft ist der Grundbesitz mit der Patrilinie verknüpft. In Asien soll ebenfalls der Besitz zusammenbleiben. Allerdings kann auch eine Tochter diesen erben. Es werden nicht - wie häufig in Europa - entfernte männliche Verwandte beerbt. Die Töchter erben allerdings nur, wenn sie in der gleichen Gesellschaftsschicht heiraten, bei einem sozialen Abstieg verlieren sie das Recht das Patrimonium zu erben.
Divergierende Übereignung ist oft unbeliebt, da mehrere Kinder den Besitz erhalten, er wird unweigerlich auseinandergerissen. Dies passiert aber nicht nur bei der Erbschaft, auch wenn ein Kind heiratet o.ä. bekommt es einen Teil des Besitzes. Auch Ehefrauen können erben, weil die Kirche sich für sie und ihre Rechte einsetzte. In der Regel fällt der Besitz vom Vater an den Sohn, die Mutter ist von der Gunst ihres Sohnes abhängig. Die Kirche verhalf den Frauen zur Erbschaft, wobei der Hintergedanken, einen Teil davon als Spende zu bekommen, eine große Rolle spielte. Eine gesetzliche Einschränkung erfolgte erst später. Mit dieser gesetzlichen Regelung soll verhindert werden, dass die Kinder aus der ehelichen Verbindung keinen Anteil am elterlichen Besitz erhalten. Eine Enterbung istr nicht möglich. Wenn ein Mann seiner Frau seinen Besitz auf Lebzeiten hinterlässt (= Wittum), dann können die Kinder erst nach dem Tod der Mutter erben. Es kommt aber auch vor, dass der Mann seinen Besitz unter seiner Frau und seinen Kinder aufteilt. Das Testament ist lange Zeit die Bestätigung des Heiratskontrakts.
3) Mitgift
Definition:
„Güter, die bei der Heirat von den Verwandten, insbesondere den Eltern der (wegziehenden) Braut entweder ihr selbst oder dem Bräutigam und seiner Gruppe übergeben werden.“
Z.B. in England werden Mitgiftzahlungen von der Arbeiterschicht eingeführt und von der Mittel- und Oberschicht übernommen. Dort hält sich dieser Brauch bis Mitte des 19. Jahrhunderts und tritt sogar heute noch vereinzelt auf. Die Arbeiterschicht dagegen beendet schon früh Mitgiftzahlungen, da es für viele Familien schwierig istr die nötigen Mittel (Bargeld bzw. Güter) aufzubringen.
Mitgiftzahlungen werden v.a. in Europa und Asien geleistet. In Afrika sind solche Transaktionen eher unüblich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Gegensatz zum Brautpreis läuft die Mitgiftzahlung in eine Richtung. Dabei wird auf drei Faktoren geachtet:
1. Herkunft der Mitgift
2. Kontrolle über die Mitgift
3. Inhalt der Mitgift
Die Herkunft der Mitgift kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden. Sie kann einerseits vom Vater bzw. der Verwandtschaft der Braut kommen oder andererseits vom Bräutigam bzw. seiner Gruppe gegeben werden. Der Bräutigam bzw. seine Verwandtschaft überreichen dem Vater oder der Familie der Braut Geschenke, der Vater gibt diese dann als Mitgiftzahlung an seine Tochter (s. indirekte Mitgift). Bekommt die Braut Geschenke von ihrem Vater aus seinem Besitz, so spricht man von direkter Mitgift.
Die Kontrolle über die Mitgift liegt entweder bei einem der Ehepartner oder beide verwalten die Mitgift gemeinsam als Familienvermögen. Die Mitgift kann alles beinhalten, z.B. Vieh, Grundbesitz, Schmuck, Bargeld, Haushaltswaren etc.. In Europa ist Land ein kostbares Gut und wird dort eher als in Asien und Afrika weitergegeben.
Es gibt verschiedene Formen der Mitgift: Mitgift als vorgezogene Erbschaft, direkte und indirekte Mitgift.
3.1) Mitgift als vorgezogene Erbschaft
Mitgift als vorgezogene Erbschaft greift hauptsächlich dann, wenn Frauen von der Erbschaftsregelung ausgeschlossen werden. Dies ist v.a. in Asien und Europa der Fall. Wenn Mitgift als vorgezogene Erbschaft betrachtet wird, dann wird der Besitz der Eltern aufgeteilt. Da dies aber für die Eltern nicht von Vorteil ist, wird diese Form der Mitgift eher selten praktiziert.
3.2) Direkte Mitgift
Direkte Mitgift ist die Summe des Geldes oder Besitzes, den die (Ehe)frau mit in die Ehe bringt. In reichen Familien ist eine große Mitgiftsumme üblich, die Töchter werden dann aber meistens von der Erbschaft ausgeschlossen. Man könnte auch hier von einer vorgezogenen Erbschaft sprechen. Heiraten in gehobenen Gesellschaftsschichten sind oft arrangiert, v.a. aus wirtschaftlichen Gründen. Die von der Braut in die Ehe gebrachte Mitgift kann sie selten für sich selbst verwenden. Bei ärmeren Familien verhält sich die Angelegenheit eher andersherum. Weil die Familie der Braut nicht viel besitzt, kann sie ihr auch nicht viel geben. Erst nach dem Tod der Eltern hat die Frau die Möglichkeit durch die Erbschaft zu Besitz zu kommen. Söhne und Töchter sind meistens gleichgestellt. Es istr üblich nur innerhalb der gleichen Gesellschaftsschicht zu heiraten. Durch die direkte Mitgift wird manchmal der Besitz der Eltern aufgeteilt.
In Indien werden noch heute, obwohl es gesetzlich verboten ist, Mitgiftzahlungen von der Familie der Braut an die des Bräutigams bzw. den Bräutigam selbst geleistet. Leider besteht auch noch die traurige Tatsache, dass der Bräutigam oder seine Familie die Braut verbrennen, wenn ihnen die bereits geleisteten Zahlungen nicht hoch genug sind. Dadurch hat der Mann die Möglichkeit eine weitere Frau zu heiraten und so erneut eine Mitgift zu erhalten. Diese Verbrechen werden oft als häusliche Unfälle behandelt und gesetzlich kaum geahndet. Früher ging es bei diesen sog. Mitgift-Morden um den sozialen Status und materielle Güter wie Kleidung für die Frauen der Familie des Bräutigams und Schmuck sowie Bargeld. Heute werden Fernsehgeräte, Videorecorder, Waschmaschinen, Motorroller etc. verlangt. Auch wenn es laut Tradition nicht rechtens ist, ist es üblich auch nach den vereinbarten Zahlungen noch mehr zu fordern.
3.3) Indirekte Mitgift
Die indirekte Mitgift ist ein Geschenk oder eine Gabe des Gatten an oder für seine Braut. Dabei müssen verschiedene Unterteilungen beachtet werden:
1. Bräutigam → Vater der Braut → Braut
2. Bräutigam → Braut
Im ersten Fall gibt der Bräutigam ein Geschenk an seinen zukünftigen Schwiegervater, der es an seine Tochter weitergibt. Dieses Geschenk kann Bargeld sein, aber auch materielle Dinge werden übergeben. In manchen Ausnahmesituationen behält der Vater die Gabe aber auch und die Tochter erhält sie nach seinem Tod als Erbschaft. Eine abgewandelte Form davon ist der Erhalt einer 'Kompensation' als Anerkennung der Rolle der Eltern oder als Entschädigung für die Unterhaltszahlung für die Tochter.
Der zweite Fall stellt eine Schenkung des Bräutigams an die Braut dar. Dies kann einerseits die Morgengabe nach Vollzug der Ehe sein. Die Braut erhält sie am Morgen nach der Hochzeitsnacht. Es können Geld, bewegliche Güter, aber auch Land sein, je nach Gesellschaftsschicht. Die andere Möglichkeit ist die “propter nuptias“. Dieses Geschenk wird vor der Hochzeit gemacht, es sind hauptsächlich bewegliche Güter oder Geld.
Es gibt noch einen dritten Fall , das “Dos“: die Braut kommt als Gefährtin der Mühen und Gefahren in die Ehe. Braut und Bräutigam tauschen bei der Hochzeit Geschenke aus, z.B. bringt die Frau dem Mann Waffen und er gibt ihr als Grundstock für das gemeinsame Vermögen Rinder.
→ Abb. 2, s. S.11; Abb. 3. s. S.11
Schluss
Der Zusammenhang zwischen den drei Bereichen Brautpreis, Erbschaft und Mitgift ist im folgenden Diagramm ersichtlich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die vorgezogene Erbschaft kann als Mitgift betrachtet werden, sowie die indirekte Mitgift als Brautpreis angesehen werden kann. Die Mitgift ist das Bindeglied zwischen Erbschaft und Brautpreis. Die weibliche Erbschaft und die Mitgift sind vom Inhalt her gleich, aber der Zweck ist verschieden:
Weibliche Erbschaft: Ehefrau, Söhne und Töchter bekommen den gleichen Anteil Mitgift: ist das Resultat eines Handels mit einer besonderen Absicht, nämlich die Tochter mit einem wünschenswerten Schwiegersohn zusammenzubringen.
Der Unterschied besteht in Flexibilität und Zeit. Beide sind jedoch eine Besitzübertragung vom Mann an die Frau:
Wittum ← #65515; Indirekte Mitgift
Der gesellschaftliche Wandel hat die traditionellen Mitgift- und Brautpreiszahlung sehr verändert, v.a. in Europa und Asien. In Europa gibt es eine Verschiebung von Brautpreis und Mitgift zur Erbschaft hin, in Asien haben sich die Mitgiftzahlungen inhaltlich sehr verändert und in Afrika sind im allgemeinen keine Veränderungen festzustellen. Die Folgen dieses Wandels sind:
1. Verlagerung von indirekter zur direkter Mitgift in Asien
2. Verlagerung von Mitgift und Brautpreis zur Erbschaft in Europa
3. Vorzeitige Besitzübertragung an die Braut
- Mitgift ohne Anrecht auf Erbschaft
Selbst wenn der Anteil der Mitgift geringer ist als der der Erbschaft, hat sie keine Möglichkeit auf einen Ausgleich.
- Mitgift als Teilvorauszahlung oder als Erbversprechen
Das Ehepaar muss sich um das Wohlergehen der Eltern sorgen, damit sie später erben. Die Erbschaft besteht in der Differenz zwischen Mitgift und Erbanteil.
In Zukunft ist in Europa und Afrika kein große Veränderung in Sicht, in Asien besteht die Möglichkeit, dass die Mitgiftzahlungen abgeschafft werden.
Abbildungen
Abb. 1: Beispiel aus Ghana: LoWilli und Gonja im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Brautpreis und Mitgift im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: Direkte und indirekte Mitgift im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bibliographie
Goody, Jack; "Entwicklungsgeschichtliche Überlegungen zu Brautpreis und Mitgift", S.88-101 in "Die Braut. Geliebt, verkauft, geraubt, getauscht. Zur Rolle der Frau im Kulturvergleich" von Völger, Gisela v.Welck, Karin; Köln 1985
Goody, Jack und Tambiah, Stanley; "Bridewealth and Dowry"; London (CUP) 1973
Goody, Jack; "Production and Reproduction. A Comperative Study of the Domestic Domain"; Cambridge (CUP) 1976
Hirschberger, Walter (Hrsg.); "Neues Wörterbuch der Völkerkunde", Berlin 1988
[...]
1 Cowrie shells sind kleine Muscheln, die wie Schneckenhäuser aussehen. Man findet sie v.a. an der Ostküste Afrikas im Indischen Ozean. Cowrie shells sind ein gängiges Zahlungsmittel bei Brautpreisen, Blutgeldern etc. Für Nahrungsmittel und sonstige alltägliche Nutzgüter können sie nicht verwendet werden.
2 Erstgeburtsrecht bei der Erbfolge
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit Heiratstransaktionen verschiedener Gesellschaften in Europa, Asien und Afrika vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie betrachtet unterschiedliche Gesellschaftsschichten und -formen.
Welche Gründe gibt es für Heiratstransaktionen?
Die Gründe für Heiratstransaktionen sind vielfältig und hängen von der Perspektive der jeweiligen Familie ab. Die Familie der Braut hat andere Beweggründe als die des Bräutigams, wobei finanzielle Aspekte und das Ansehen der Familie eine Rolle spielen.
Was ist Brautpreis?
Brautpreis ist eine Gegenleistung in einem Tauschgeschäft, keine Kaufsumme für eine Frau. Er dient als Beweis für den Ehevertrag, als Pfand für die gute Behandlung der Frau und als Entgelt für ihre Arbeitskraft und Gebärfähigkeit.
Wie laufen Brautpreiszahlungen ab?
Nach Absprachen über Höhe, Zahlart, Rückgabe bei Tod oder Scheidung, Zahlungszeitpunkt und erworbene Rechte zahlt die Verwandtschaft des Bräutigams den Brautpreis an die Verwandtschaft der Braut und erhält im Gegenzug die Braut.
Was beeinflusst die Höhe des Brautpreises?
Die Höhe des Brautpreises variiert je nach Region. In Ost- und Südafrika ist er oft geringer als in Westafrika, was mit den unterschiedlichen Deszendenzgruppen (matrilinear vs. patrilinear) zusammenhängen kann.
Was sind typische Zahlungsmittel für den Brautpreis?
In Europa werden oft bewegliche Güter wie Schmuck oder Bargeld verwendet. In Asien sind Stoffe beliebt. In Afrika kommen Vieh, Metallobjekte oder Zierrat zum Einsatz. Auch 'cowrie shells' werden verwendet.
Wann wird der Brautpreis zurückgezahlt?
Der Brautpreis kann zurückgefordert werden, wenn die Zahlungen von der Fruchtbarkeit der Frau abhängen oder die Ehe frühzeitig von der Frau aufgelöst wird.
Was passiert mit dem Brautpreis, der für eine Tochter gezahlt wird?
Der Brautpreis wird oft an einen Sohn weitergegeben, damit er seinerseits den Brautpreis zahlen kann. Er wird wie ein Durchlaufposten behandelt.
Was ist Erbschaft im Kontext dieser Arbeit?
In Europa wird bei Erbschaftsangelegenheiten Wert auf den Erhalt des Patrimoniums gelegt. Oft erbt ein Kind Haus und Ländereien, während die anderen abgefunden werden. Töchter werden häufig vom Erbe von Grundbesitz ausgeschlossen.
Was ist divergierende Übereignung?
Divergierende Übereignung bedeutet, dass mehrere Kinder den Besitz erhalten, was zur Aufteilung des Besitzes führt.
Welche Rolle spielte die Kirche bei der Erbschaft von Frauen?
Die Kirche setzte sich für die Rechte von Frauen ein, was ihnen ermöglichte zu erben, wobei ein Teil des Erbes als Spende an die Kirche gedacht war.
Was ist Mitgift?
Mitgift sind Güter, die bei der Heirat von den Verwandten der Braut entweder ihr selbst oder dem Bräutigam übergeben werden.
Wo sind Mitgiftzahlungen üblich?
Mitgiftzahlungen sind vor allem in Europa und Asien üblich. In Afrika sind solche Transaktionen eher unüblich.
Welche Formen der Mitgift gibt es?
Es gibt Mitgift als vorgezogene Erbschaft, direkte Mitgift und indirekte Mitgift.
Was ist Mitgift als vorgezogene Erbschaft?
Mitgift als vorgezogene Erbschaft kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn Frauen von der Erbschaftsregelung ausgeschlossen werden.
Was ist direkte Mitgift?
Direkte Mitgift ist das Geld oder der Besitz, den die (Ehe)frau mit in die Ehe bringt. In reichen Familien ist eine große Mitgift üblich, die Töchter werden dann aber meist von der Erbschaft ausgeschlossen.
Was ist indirekte Mitgift?
Indirekte Mitgift ist ein Geschenk oder eine Gabe des Gatten an oder für seine Braut. Dabei kann es sich um ein Geschenk des Bräutigams an den Vater der Braut handeln, der es an seine Tochter weitergibt, oder um eine Schenkung des Bräutigams an die Braut selbst.
Was ist der Zusammenhang zwischen Brautpreis, Erbschaft und Mitgift?
Die Mitgift ist das Bindeglied zwischen Erbschaft und Brautpreis. Die weibliche Erbschaft und die Mitgift sind vom Inhalt her gleich, aber der Zweck ist verschieden.
Wie hat sich der gesellschaftliche Wandel auf Mitgift- und Brautpreiszahlungen ausgewirkt?
In Europa gibt es eine Verschiebung von Brautpreis und Mitgift zur Erbschaft hin, in Asien haben sich die Mitgiftzahlungen inhaltlich verändert, und in Afrika sind im Allgemeinen keine Veränderungen festzustellen.
- Quote paper
- Mareike Stephan (Author), 2000, Brautpreis, Erbschaft, Mitgift, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98731