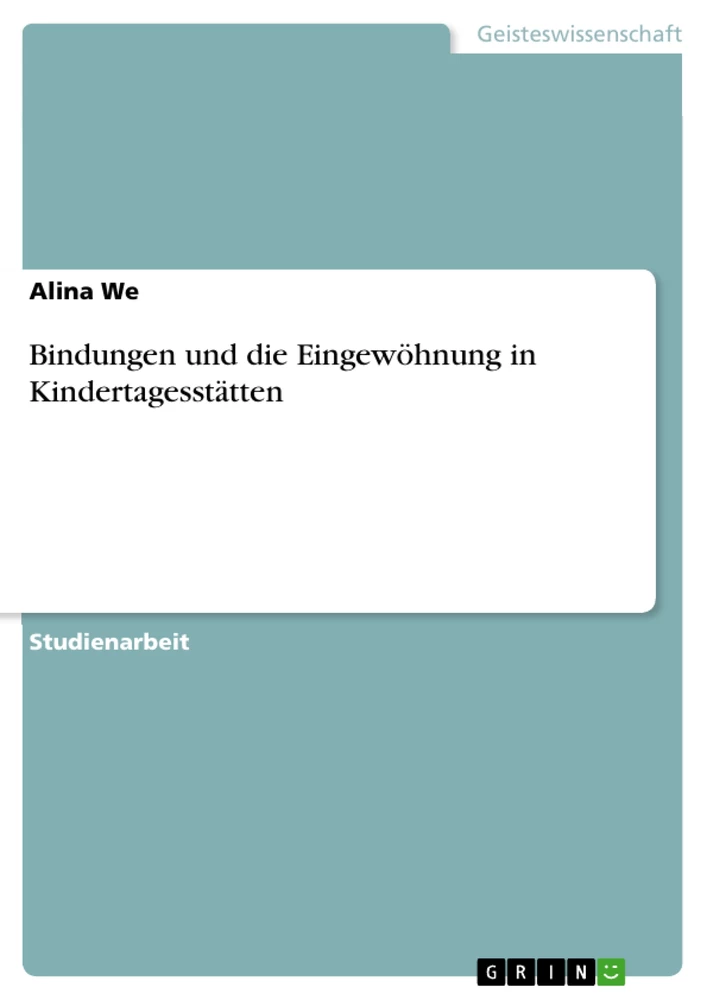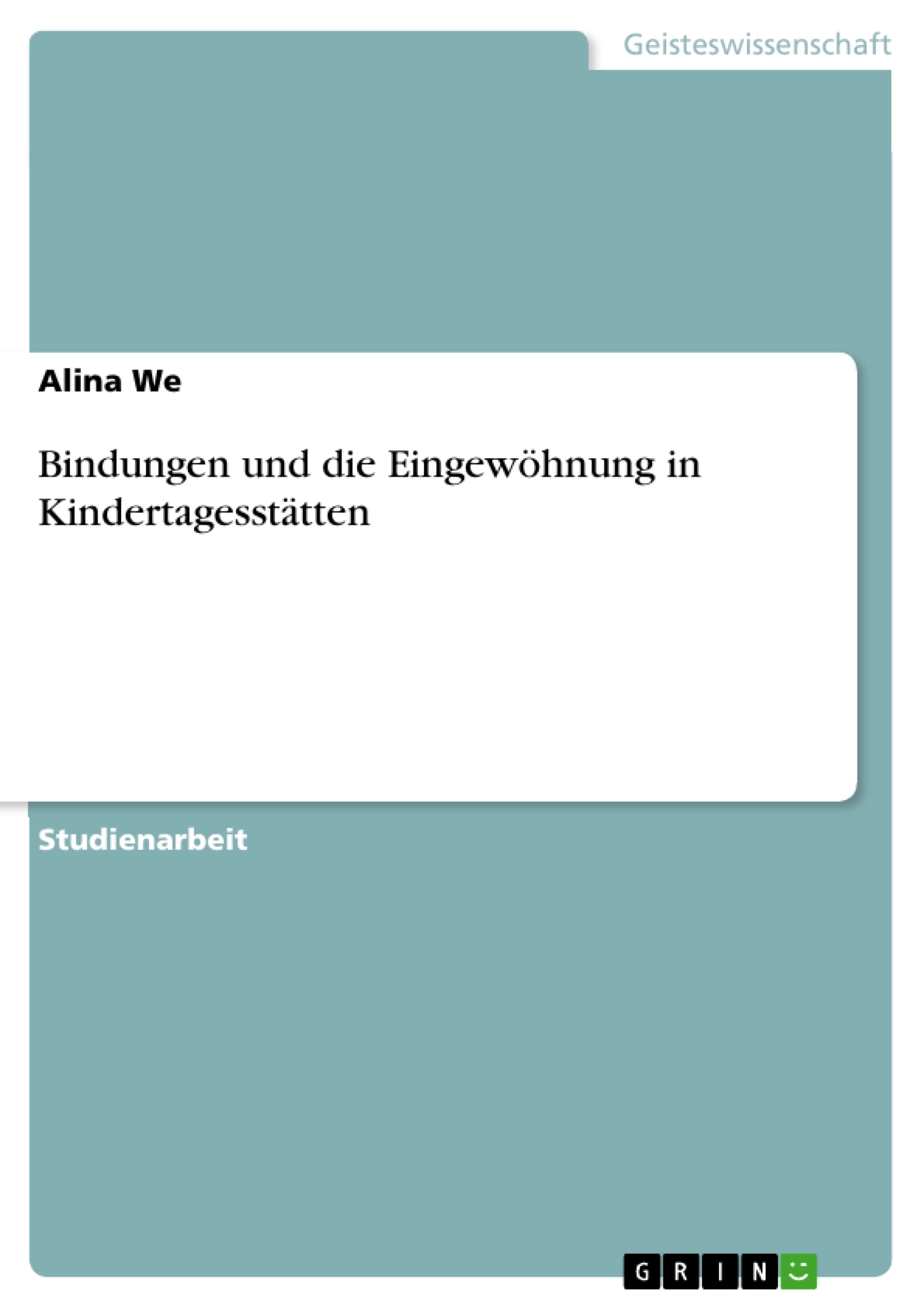Welche Faktoren spielen bei der Eingewöhnung in der Kindertagesbetreuung eine Rolle? In der Arbeit findet zunächst eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Objektpermanenz, dem Bindungsbegriff und den Bindungskonzepten von John Bowlby und Mary Ainsworth statt. Dabei wird die psychische Entwicklung in der frühen Kindheit beleuchtet und welche Verhaltenssysteme bei Kleinkindern vorhanden sind, deren biologische Determination und der von Erwachsenen Kleinkindern gegenüber. Aber auch die Auswirkungen auf die psychische Entwicklung von Kindern bei unterschiedlichem Bindungsverhalten der Bezugspersonen wird betrachtet. Ebenso die verschiedenen Bindungsorganisationen in der frühen Kindheit.
Als nächstes wird die KiTa-Eingewöhnung in den Blick genommen. Diese Transition von der Familie zur Kindertagesbetreuung ist eine herausfordernde Entwicklungsaufgabe für das Kind, aber auch alle anderen Beteiligten. Zudem wird die Qualität der Eingewöhnung betrachtet und die damit eng verbundene Qualität des pädagogischen Fachpersonals.
Zuletzt werden die Ursachen und die Notwendigkeit einer frühen Eingewöhnung im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Individualisierung, Pluralisierung der Lebensformen und Industrialisierung und die Frühfördermöglichkeiten erschlossen. Es werden also im Folgendem eine Vielzahl an Einflussfaktoren betrachtet und zusammengestellt, um die entwicklungspsychologische Basis, also die internalen Abläufe, die Eingewöhnungsstrategie und die Herausforderungen für alle Beteiligten sowie die gesellschaftlichen Gegebenheiten miteinander in Verbindung zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Objektpermanenz Piaget
- Bindungstheorie
- Der Bindungsbegriff
- Das Bindungskonzept von John Bowlby
- Innere Arbeitsmodelle von John Bowlby
- Das Bindungskonzept von Mary Ainsworth
- Die Organisation von Bindungsbeziehungen nach Ainsworth
- Bindungsorganisationen und Qualität der Bindungen
- Sichere Bindungsorganisation
- Unsichere vermeidende Bindungsorganisation
- Unsichere ambivalente Bindungsorganisation
- Desorganisierte/desorientierte Bindungsorganisation
- Bindungsstörungen
- KiTa-Eingewöhnung
- Transition von der Familie zur KiTa
- Qualität bei der Eingewöhnung
- Qualität des Fachpersonals
- Dauer der Eingewöhnung
- Das >>Berliner Eingewöhnungsmodell<<
- Ablauf der Eingewöhnung
- Einflussfaktoren auf die Eingewöhnung
- Kompetenzen der Kinder
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Faktoren, die die Eingewöhnung von Kindern in Kindertagesstätten beeinflussen. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen frühkindlicher Bindung und dem erfolgreichen Übergang vom familiären in das institutionelle Umfeld. Die Arbeit analysiert verschiedene Bindungstheorien und deren Relevanz für die Praxis der Kita-Eingewöhnung.
- Frühkindliche Bindungstheorien (Bowlby, Ainsworth)
- Die Bedeutung der Objektpermanenz für die Eingewöhnung
- Verschiedene Bindungsorganisationen und deren Auswirkungen
- Qualität der Kita-Eingewöhnung und Rolle des pädagogischen Personals
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kontext der Kita-Betreuung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der frühkindlichen Entwicklung und deren Einflussfaktoren ein. Sie betont die Bedeutung der primären Bindungspersonen (meist Eltern) und deren Einfluss auf die psychische Entwicklung des Kindes. Der schnelle Wiedereinstieg der Eltern in die Arbeitswelt und die damit verbundene frühzeitige Unterbringung von Kindern in Kindertagesstätten werden als Kontext für die zentrale Fragestellung der Arbeit – die Faktoren, welche die Kita-Eingewöhnung beeinflussen – hervorgehoben. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit der Objektpermanenz, verschiedenen Bindungstheorien (Bowlby und Ainsworth) und den verschiedenen Bindungsorganisationen an, um die psychosoziale Entwicklung und das Bindungsverhalten von Kleinkindern zu beleuchten. Schließlich wird die Kita-Eingewöhnung als herausfordernder Übergangsprozess für Kinder und ihre Bezugspersonen dargestellt, der im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert analysiert wird.
2. Objektpermanenz Piaget: Dieses Kapitel beschreibt Piagets Konzept der Objektpermanenz – das Wissen, dass Objekte auch dann weiter existieren, wenn sie sich außerhalb des Wahrnehmungsfeldes befinden. Es wird erläutert, dass Kinder unter acht Monaten diese Fähigkeit noch nicht besitzen und erst gegen Ende des ersten Lebensjahres nach versteckten Objekten suchen können, was auf das Entstehen innerer Repräsentationen hinweist. Die Relevanz dieses Konzepts liegt in seinem Bezug zur Bindungstheorie, da die Objektpermanenz es Kleinkindern ermöglicht, die Vorstellung von der anhaltenden Existenz ihrer Bindungspersonen zu entwickeln, auch wenn diese nicht sichtbar sind. Dieses Verständnis ist essentiell für den Umgang mit Trennungssituationen während der Kita-Eingewöhnung.
3. Bindungstheorie: Dieses Kapitel erörtert den Bindungsbegriff als emotionales Band zu einer bestimmten Person und stellt die Bindungskonzepte von John Bowlby und Mary Ainsworth vor. Bowlby beschreibt Bindung als ein „gefühlsmäßiges Band“, das durch Interaktionen in der frühen Kindheit aufgebaut wird und ein Leben lang besteht. Er definiert Signal- und Annäherungsverhalten des Kindes und hebt die Rolle des fürsorglichen Verhaltens der Bezugsperson hervor. Ainsworth, die Mitarbeiterin Bowlbys, fokussiert sich auf die qualitative Beschaffenheit der Bindung und beschreibt die Interaktion zwischen dem Bindungsverhaltenssystem und dem Explorationsverhaltenssystem. Sie beschreibt verschiedene Bindungsorganisationen (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert/desorientiert) und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Das Kapitel liefert somit das theoretische Fundament zum Verständnis von Bindung im Kontext der Kita-Eingewöhnung.
4. KiTa-Eingewöhnung: Dieses Kapitel widmet sich dem Prozess der Kita-Eingewöhnung als herausfordernde Transition von der Familie zur Kindertagesstätte. Es betont die Bedeutung der Anwesenheit der Bindungsperson während der Eingewöhnung, insbesondere für Kinder zwischen dem 7. und 24. Lebensmonat, um ihnen eine sichere Basis zu bieten. Die Qualität der Eingewöhnung wird mit der Qualität des pädagogischen Fachpersonals verknüpft und die Bedeutung von Fortbildungen und Elterngesprächen hervorgehoben. Das Kapitel beschreibt das Berliner Eingewöhnungsmodell als ein wissenschaftlich fundiertes und bedürfnisorientiertes Konzept und erläutert den Ablauf der Eingewöhnung (z.B. die schrittweise Trennung von der Bindungsperson) sowie Einflussfaktoren wie Zeitdruck, Erkrankungen oder gleichzeitige Veränderungen im Alltag des Kindes. Die bereits vorhandenen Kompetenzen des Kindes, wie die Fähigkeit, Bindungen zu mehreren Personen aufzubauen, werden ebenfalls berücksichtigt.
5. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Das Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel (Individualisierung, Pluralisierung der Lebensformen, Industrialisierung, Tertiärisierung) und dessen Einfluss auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es zeigt die Herausforderungen, besonders für Alleinerziehende mit Kindern unter drei Jahren, und betont den Ausbau bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung. Die frühzeitige Kita-Betreuung wird im Kontext der Vereinbarkeit von Beruf und Familie als notwendig dargestellt und als Chance für Frühfördermaßnahmen und Armutsrisikominderung angesehen. Die seit 2013 bestehende Rechtslage zum Betreuungsanspruch wird erwähnt.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bowlby, Ainsworth, Objektpermanenz, Kita-Eingewöhnung, Bindungsorganisationen, sicher/unsicher, pädagogisches Fachpersonal, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, frühkindliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einflussfaktoren auf die Kita-Eingewöhnung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Faktoren, die die Eingewöhnung von Kindern in Kindertagesstätten beeinflussen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen frühkindlicher Bindung und dem erfolgreichen Übergang vom familiären ins institutionelle Umfeld.
Welche Bindungstheorien werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Bindungskonzepte von John Bowlby und Mary Ainsworth, einschließlich der verschiedenen Bindungsorganisationen (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert/desorientiert) und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung.
Welche Rolle spielt die Objektpermanenz?
Das Kapitel zu Piagets Konzept der Objektpermanenz beleuchtet dessen Bedeutung für die Bindungstheorie und den Umgang mit Trennungssituationen während der Kita-Eingewöhnung. Es wird erklärt, wie das Verständnis der Objektpermanenz die Fähigkeit des Kindes beeinflusst, die anhaltende Existenz seiner Bindungspersonen auch bei Abwesenheit zu verinnerlichen.
Wie wird die Kita-Eingewöhnung beschrieben?
Die Kita-Eingewöhnung wird als herausfordernder Übergangsprozess für Kinder und ihre Bezugspersonen dargestellt. Es wird die Bedeutung der Anwesenheit der Bindungsperson während der Eingewöhnung, insbesondere für Kinder zwischen 7 und 24 Monaten, betont. Das Berliner Eingewöhnungsmodell wird als Beispiel für ein wissenschaftlich fundiertes Konzept vorgestellt, inklusive des Ablaufs und Einflussfaktoren wie Zeitdruck oder Erkrankungen.
Welche Aspekte der Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden behandelt?
Der gesellschaftliche Wandel und dessen Einfluss auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden beleuchtet. Die Herausforderungen, besonders für Alleinerziehende mit Kindern unter drei Jahren, und der Ausbau bedarfsgerechter Kindertagesbetreuung werden thematisiert. Die frühzeitige Kita-Betreuung wird als Chance für Frühförderung und Armutsrisikominderung betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bindungstheorie, Bowlby, Ainsworth, Objektpermanenz, Kita-Eingewöhnung, Bindungsorganisationen, sicher/unsicher, pädagogisches Fachpersonal, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, frühkindliche Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Objektpermanenz nach Piaget, zur Bindungstheorie (Bowlby und Ainsworth), zur Kita-Eingewöhnung und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der jeweiligen Thematik und deren Relevanz für den Kontext der Kita-Eingewöhnung.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine umfassende Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse jedes Abschnitts prägnant zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit frühkindlicher Entwicklung, Bindungstheorie und den Herausforderungen der Kita-Eingewöhnung auseinandersetzt. Sie eignet sich für Studierende, Wissenschaftler und Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung.
- Citar trabajo
- Alina We (Autor), 2019, Bindungen und die Eingewöhnung in Kindertagesstätten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/986866