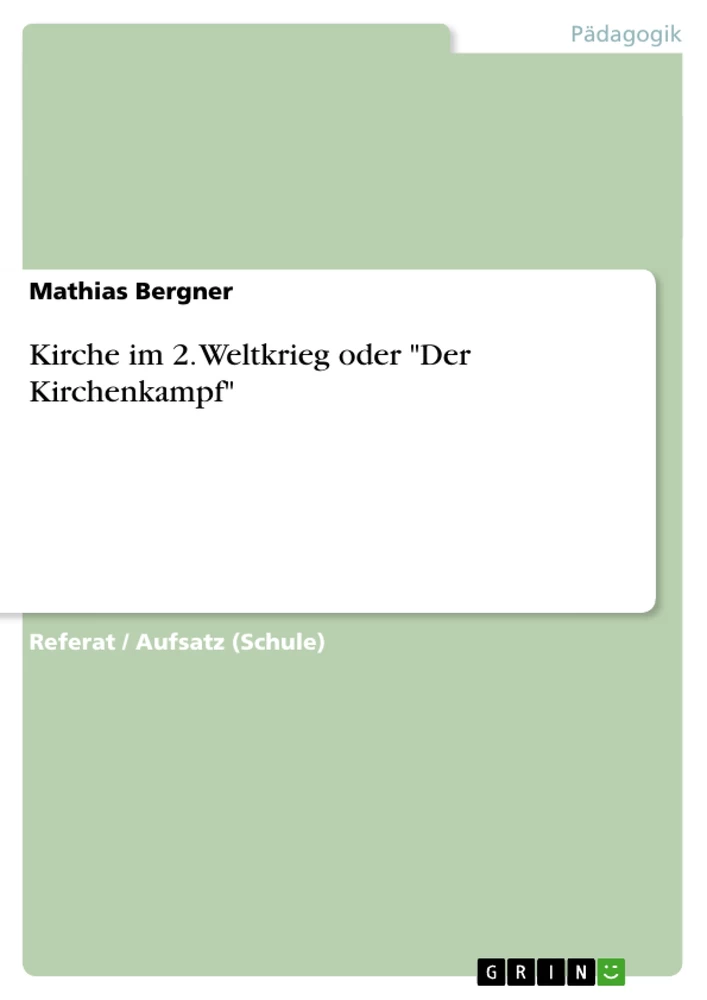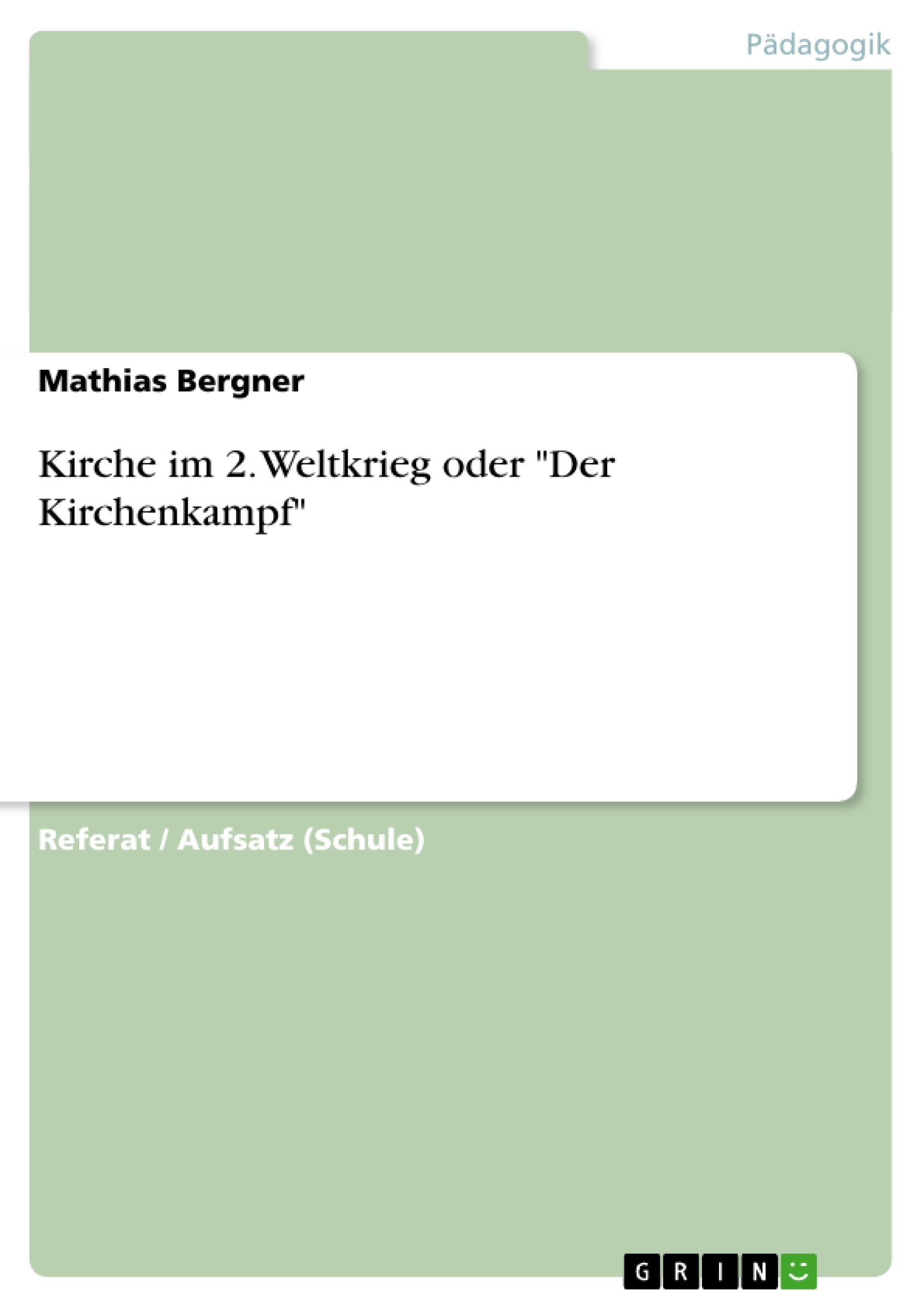Als Hitlers Schatten über Deutschland fiel, standen die Kirchen vor einer Zerreißprobe: Anpassung oder Widerstand? Diese packende Analyse enthüllt, wie der Nationalsozialismus versuchte, die evangelische und katholische Kirche für seine ideologischen Zwecke zu instrumentalisieren. Tauchen Sie ein in die komplexen Verstrickungen zwischen Glaube und Macht, während die "Deutschen Christen" bereitwillig Hitlers Ideologie adaptierten und die "Bekennende Kirche" mutig ihre Stimme gegen die Gleichschaltung erhob. Erfahren Sie, wie das Reichskonkordat der katholischen Kirche Privilegien sicherte, während gleichzeitig der Widerstand einzelner mutiger Geistlicher wie Clemens August Graf von Galen und Max Josef Metzger aufkeimte. War die Kirche ein Bollwerk gegen den Nationalsozialismus oder ein stiller Komplize? Entdecken Sie die inneren Konflikte, die Spaltungen und die mutigen Akte des Widerstands, die das Gesicht des deutschen Christentums in jener dunklen Zeit prägten. Untersuchen Sie die Rolle von Schlüsselfiguren wie Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, deren Engagement für ihren Glauben sie zu Symbolen des Widerstands machte. Diese tiefgründige Untersuchung beleuchtet die schwierige Balance zwischen spiritueller Überzeugung und politischem Druck, während sie die Frage aufwirft, inwieweit die Kirchen ihrer moralischen Verantwortung gerecht wurden. Die Geschichte der evangelischen Kirche, zwischen den "Deutschen Christen" und der "Bekennenden Kirche", zeigt den Kampf um theologische Reinheit und politischen Einfluss. Die Analyse des Verhaltens der katholischen Kirche, vom Reichskonkordat bis zur Unterstützung des Krieges, offenbart die komplexe Beziehung zwischen Vatikan, deutschem Episkopat und dem NS-Regime. Ein fesselndes Porträt einer Zeit, in der Glaube und Ideologie auf dramatische Weise aufeinanderprallten, und die Frage nach Schuld und Versagen, Widerstand und Anpassung bis heute nachwirkt. Die Rolle der Kirche im Dritten Reich ist bis heute Gegenstand hitziger Debatten. Dieses Buch liefert die historischen Hintergründe für eine fundierte Auseinandersetzung.
Gliederung:
1. historischer Hintergrund
2. evangelische Kirche
1.1. Deutsche Christen
1.2. Bekennende Kirche
3. katholische Kirche
4. Fazit
1. Historischer Hintergrund
Nach dem Zusammenbruch der Weimarer Republik begann in Deutschland die Zeit des Nationalsozialismus, und somit das „Dritte Reich“. Doch bevor Hitler die volle Gewalt über Staat und Gesellschaft besitzen konnte, musste er das Reich „gleichschalten“. Hitler musste es gelingen alles Sektoren zu unterwerfen, d.h. politische, wirtschaftliche, kulturelle, aber auch religiöse Macht in Deutschland zu erlangen, damit er gezielt alle seine Gegner ausschalten und seine Diktatur und seine nationalsozialistische Ideologien durchsetzen konnte.
2. Die evangelische Kirche
Die evangelische Kirche bestand aus nicht weniger als 28 Landeskirchen, von der größten, der preußischen Landeskirche mit rund 19 Millionen Mitgliedern, bis zu den kleinsten, den Landeskirchen von Birkenfeld oder Lübeck etwa, die nicht mehr als 50 000 Mitglieder zählten. Um hier Fuß zu fassen, mussten die Nationalsozialisten sich in die innerkirchlichen Hierarchien einklinken. Diese Möglichkeit boten die Wahlen zu den Gemeindevertretungen, bei denen alle Kirchenmitglieder ihre Kandidaten für die verschieden Kirchengremien wählen konnten. Um hier Fuß fassen zu können, bedurfte es einer gewaltigen propagandistischen Anstrengung des nationalsozialistischen Apparats.
Und wie an anderen Stellen war die Beeinflussung auch bei vielen Mitgliedern der evangelischen Kirchen erfolgreich. Im Gegensatz zu den negierenden und kirchenfeindlichen Parolen der Linksextremisten sahen sie hier eine Möglichkeit, ihren Glauben weiter zu ordinieren und nicht an Einfluss zu verlieren. Es gab aber auch begeisterte Nationalsozialisten unter den Pfarrern, wie etwa Wilhelm Beyer, der 1931 zum Anlas eines Feldgautages einen Gottesdienst in SA-Uniform zelebrierte.
Am treffendsten brachte es wohl Walter Künneth in einem Vortrag im April 1931 zum Ausdruck, indem er sagte: ,,Wir antworten als evangelische Christen auf den Ruf des Nationalsozialismus zunächst mit einem `Ja`. Wir antworten aber zugleich auf seinen Ruf mit einer kritischen Frage."
2.1. Die Deutschen Christen
Die Nationalsozialisten bildeten eine eigene Gruppe, die ,,Deutschen Christen", die bei der Kirchenwahl im Herbst 1932 rund ein Drittel der Stimmen erhielten. Diese Gruppe sympathisierte mit den Nationalsozialisten orientierte sich an den Nazi-Ideologien, und übernahm zum Beispiel Teile der Rassenlehre in ihre Glaubensanschauung. Noch größer wurde ihr Einfluss mit dem Zeitpunkt der Machtergreifung im Januar 1933. Hitler setzte nun den bis dahin unbekannten Königsberger Wehrkreispfarrer Ludwig Müller als Reichsbischof ein. Auf dessen rigide Versuche, alle Landeskirchen in einem zentral gesteuerten Apparat unter seine Kontrolle zu bringen, setzten die Landeskirchen den vielgeachteten Friedrich von Bodelschwingh als Reichsbischof ein. Unter dem Druck des Staates musste dieser aber schon nach 4 Wochen wieder zurücktreten.
Bereits Ende Juni besetzte Müller mit Hilfe der SA das Gebäude des Bundeskirchenamtes in Berlin. Bei den auf Betreiben der Reichsregierung kurze Zeit später abgehaltenen Kirchenwahlen erhielten die ,,Deutschen Christen“ eine überwältigende Mehrheit in den Gremien der neugeschaffenen ,,Deutschen Evangelischen Kirche". Die oppositionelle Liste ,,Kirche und Evangelium" stand auf verlorenem Posten, mithin war sie den Schikanen der politischen Polizei ausgesetzt. Nur Württemberg, Bayern und Hannover behielten ihre alten Kirchenleitungen und blieben so intakt. Ein Umschwung erfolgte Ende 1933, als die Deutschen Christen eine Kundgebung im Berliner Sportpalast abhielt, in der der Redner die Abschaffung des Alten Testaments und die Verkündigung eines ,,heldischen Jesu" (nach nationalsozialistisch-ideologischem Vorbild) forderten. Die „Deutschen Christen“ verlor daraufhin einen Großteil ihrer Anhänger. Der Reichsbischof, der immer mehr an Glaubwürdigkeit verlor, versuchte seinen Platz zu sichern, indem er mit der Überführung der 800000 Jungen und Mädchen des Evangelischen Jugendwerks in die HJ und den BDM Eindruck bei Hitler machen wollte.
2.2. Bekennende Kirche
Die Bekennende Kirche verstand sich nicht als Kirchenpartei, wie die Deutschen Christen es tat, sondern als rechtmäßige Kirche. Sie stellte eigene Kirchenleitungen, die sogenannten ,,Bruderräte" und begab sich in offenen Gegensatz zu den restriktiv geführten Kirchenleitungen der Deutschen Christen. Die Bekennende Kirche stellte eigene Pfarrer ein und bildete sie an eigenen theologischen Hochschulen aus. Sie veröffentlichten eine Vielzahl von Handreichungen zur Bibelarbeit und zum Gottesdienst. Finanzieren musste sie sich aus Spenden und Kollekten, da die Deutschen Christen in den meisten Gemeinden die Finanzen kontrollierte. Seit 1936 wurde der Totalitätsanspruch der Nazis jedoch immer größer. Er forderte eine ,,Entkonfessionalisierung" des öffentlichen Lebens. Statt der geplanten Gleichschaltung der Kirche war diese nun in eine Menge von Gruppen zerfasert. Hitler versuchte dem mit der Einsetzung eines Reichskirchenministers zu begegnen. Reichskirchenminister Hans Kerrl war der Überzeugung, dass sich christliches und nationalsozialistisches Gedankengut durchaus vereinbaren ließen. Unter dem Eindruck dieser Gedanken waren einzelne Mitglieder der Bekennenden Kirche als auch der Mittelgruppen zur Zusammenarbeit bereit. Im Laufe dieser Diskrepanzen im Umgang mit Kerrl spaltete sich die Bekennende Kirche in einen radikalen und einen gemäßigten Flügel. Der gemäßigte Flügel hielt eine Zusammenarbeit mit dem Reichskirchenminister für möglich und die ihm angehörenden Bruderräte wurden durch den neugeschaffenen Rat der Evangelisch-Lutherischen Kirche (Lutherrat) vertreten. Der radikale Flügel lehnte jeden Eingriff des Staates in die Kirche ab. Im weiteren Verlauf bis 1945 war die Geschichte der evangelischen Bewegungen geprägt von ihrer Zerfaserung. Immer gelähmter reagierten die verschiedenen kirchlichen Institutionen auf die Geschehnisse. Im Krieg blieb ihnen dann die Aufgabe übrig, die Millionen Witwen und Waisen zu betreuen. Wichtiger Widerstandskämpfer der Bekennenden Kirche waren Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller (Begründer des Pfarrernotbundes, dem „Grundpfeiler“ der Bekennenden Kirche).
3. Die katholische Kirche
Tatsächlich war der katholische Klerus ziemlich geschlossen gegen Hitler; allerdings nur vor dem 30. Januar 1933. Nachdem Hitler Reichskanzler war, vollzog sich hingegen schnell eine Annäherung an das neue Regime. Im Juni bestätigte dem ,,Führer“ denn schon ein Hirtenbrief den ,,Abglanz der göttlichen Herrschaft" und beteuerten die Bischöfe, keinen auch ,,...nur versteckten Vorbehalt dem neuen Staat gegenüber zu hegen." Entscheidend beigetragen zu diesem Sinneswandel des deutschen Episkopats hatte die Politik seiner vorgesetzten Dienststelle, des Vatikan. Denn Papst Pius XI. waren die ideologischen Differenzen mit dem Faschismus weniger wichtig als konkrete politische Interessen. Und die Nazis zerschlugen nicht nur die Organisation der dem Papst verhassten sozialistischen Arbeiterbewegung, sie erfüllten auch seinen Wunsch nach einem Konkordat. Diese ,,feierliche Übereinkunft“ in der Form des „Reichskonkordats“ wurde am 20. Juli 1933 unterzeichnet und sicherte der katholischen Kirche eine Reihe von Privilegien, vor allem im Bildungsbereich. Für das Dritte Reich bedeutete das Abkommen das Ende der außenpolitischen Isolation, ein enormer Prestigegewinn. Über die Ziele der Nationalsozialisten konnte schon damals keine Unklarheit mehr herrschen, die Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Bereiche hatte bereits begonnen, Tausende von Oppositionellen waren bereits verhaftet. Und da absehbar war, dass der Weg der Nationalsozialisten kein friedlicher sein würde, waren in einem geheimen Zusatzprotokoll zum Konkordat Regelungen über den Status der Geistlichen für die Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht und der Mobilmachung angefügt.
Den Solidaritätserklärungen der Bischöfe folgten bald Taten; auf allen Ebenen unterstützen der höhere katholische Klerus und die Mehrzahl der katholischen Verbandsfunktionäre die nationalsozialistische Politik der Gleichschaltung. Der politische Arm der Katholiken, die Zentrumspartei, löste sich Anfang Juli selbst auf. Für die Reichstagswahl am 12. November, die mit der Volksabstimmung über den Austritt aus dem Völkerbund verknüpft war, forderte die katholische Kirche auf, mit ,,Ja" zu stimmen.
Die katholische Kirche war als Einheit tätig, und der einmal erreichte Einfluss der Nationalsozialisten blieb erhalten. Als Hitler und seine Generäle den zweiten Weltkrieg begannen, ermahnten die Bischöfe die katholischen Soldaten, ihre Pflicht zu tun und ,,bereit zu sein, ihre ganze Person zu opfern". Bei jedem Sieg der Truppen wurden die Glocken geläutet, der Überfall auf die Sowjetunion wurde zum ,,Kreuzzug“ stilisiert. Und als das Glockengeläut ab 1942 seltener ertönte, lag das nicht zuletzt daran, dass viele Pfarreien mit der ausdrücklichen Zustimmung Kardinal Faulhabers ihre Glocken ,,für Zwecke der Kriegswirtschaft" abgeliefert hatten.
Wer gegen die Politik der Nationalsozialisten Kontra sprach, konnte - selbst wenn er im Dienst der katholischen Kirche stand - hingegen in den meisten Fällen nicht auf ihre Unterstützung rechnen. ,,Wir lehnen jede staatsfeindliche Handlung oder Haltung von Mitgliedern strengstens ab", hieß es in einer Denkschrift der Bischofskonferenz von 1935; wer ,,regierungsfeindliche Strömungen" in die katholischen Vereine leiten wolle, müsse ,,unnachsichtig" aus diesen entfernt werden. Während des Krieges mahnten die Bischöfe ihre Gläubigen in Predigten und Hirtenbriefen immer wieder zu ,,treuer Pflichterfüllung". Die Teilnahme am Krieg hieß ,,Pflicht vor Gott", der Überfall auf Polen hatte den Zweck, ,,das Vaterland zu schirmen und unter Einsatz des Lebens einen Frieden der Freiheit und Gerechtigkeit für unser Volk zu erkämpfen". Erst spät, als die Niederlage des faschistischen Deutschlands immer wahrscheinlicher wurde, nahmen die Beifallsbekundungen von der Kanzel ab, mischten sich kritische Töne in die Verlautbarungen.
Wichtige Widerstandskämpfer der katholischen Kirche waren Clemens August Graf von Galen und Max Josef Metzger.
4. Fazit
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Hintergrund des Dokuments?
Das Dokument beschreibt die Situation der Kirchen im Deutschland der Zeit des Nationalsozialismus, beginnend mit der Machtergreifung Hitlers und der "Gleichschaltung" aller gesellschaftlichen Bereiche.
Welche Rolle spielte die evangelische Kirche im Nationalsozialismus?
Die evangelische Kirche war in 28 Landeskirchen zersplittert. Die Nationalsozialisten versuchten, Einfluss durch die "Deutschen Christen" zu gewinnen, eine Gruppe, die mit den Nazi-Ideologien sympathisierte. Es gab aber auch Widerstand in Form der "Bekennenden Kirche".
Was waren die "Deutschen Christen"?
Die "Deutschen Christen" waren eine Gruppe innerhalb der evangelischen Kirche, die sich an den Nazi-Ideologien orientierte und beispielsweise Teile der Rassenlehre übernahm. Sie gewannen bei Kirchenwahlen Einfluss und unterstützten die Gleichschaltung.
Was war die "Bekennende Kirche"?
Die "Bekennende Kirche" verstand sich als rechtmäßige Kirche und stellte sich gegen die von den "Deutschen Christen" geführten Kirchenleitungen. Sie bildete eigene Pfarrer aus und finanzierte sich durch Spenden.
Welche Rolle spielte die katholische Kirche im Nationalsozialismus?
Anfangs stand der katholische Klerus Hitler geschlossen gegenüber. Nach der Machtergreifung gab es jedoch eine Annäherung, insbesondere durch das Reichskonkordat von 1933, das der katholischen Kirche Privilegien sicherte. Der politische Arm der Katholiken, die Zentrumspartei, löste sich auf und die Kirche forderte zur Zustimmung bei Wahlen auf. Es gab aber auch Widerstand von Einzelpersonen.
Was war das Reichskonkordat?
Das Reichskonkordat war ein Abkommen zwischen dem Vatikan und dem Deutschen Reich, das der katholischen Kirche Privilegien, insbesondere im Bildungsbereich, sicherte. Für das Dritte Reich bedeutete es das Ende der außenpolitischen Isolation.
Welchen Widerstand gab es gegen den Nationalsozialismus innerhalb der Kirchen?
In der evangelischen Kirche gab es die "Bekennende Kirche", die sich gegen die Gleichschaltung wehrte. In der katholischen Kirche gab es Einzelpersonen, die Widerstand leisteten, obwohl die offizielle Linie der Kirche eher auf Anpassung ausgerichtet war. Beispiele für wichtige Widerstandskämpfer der evangelischen Kirche sind Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller. Wichtige Widerstandskämpfer der katholischen Kirche waren Clemens August Graf von Galen und Max Josef Metzger.
Was ist das Fazit des Dokuments?
Die Gleichschaltung des Reichs gelang Hitler im religiösen Bereich nicht vollständig. Es gab Widerstand beider Konfessionen gegen den Nationalsozialismus. Die Kirche war ein Zufluchtsort für Verfolgte, aber es gibt auch Kritik daran, dass sie nicht mehr gegen die Nazis unternommen hat.
- Quote paper
- Mathias Bergner (Author), 2000, Kirche im 2. Weltkrieg oder "Der Kirchenkampf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98623