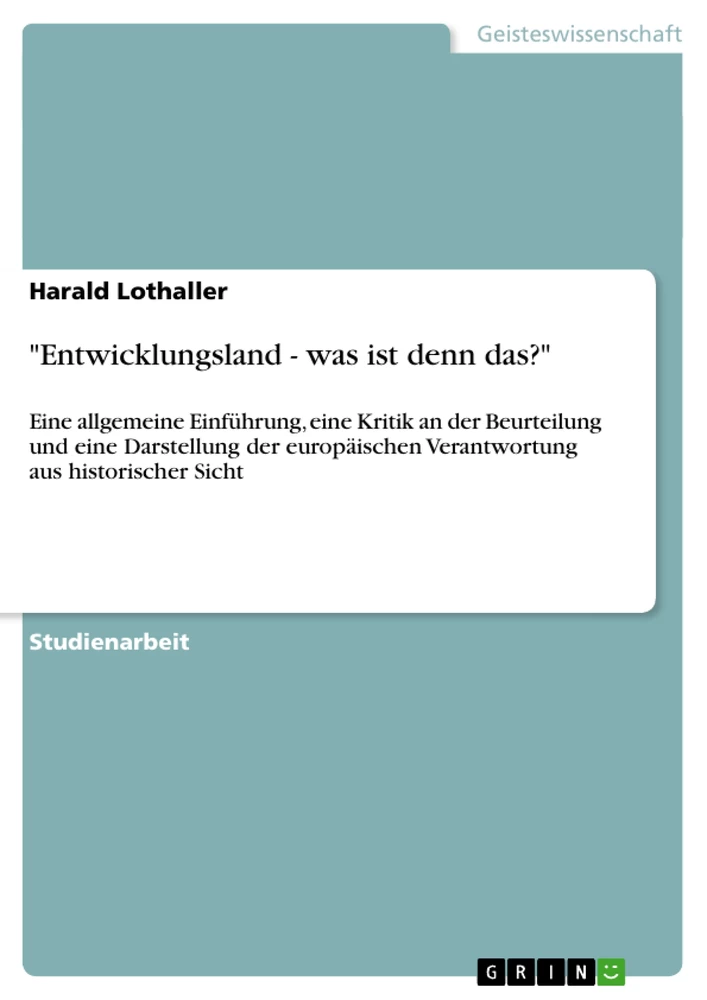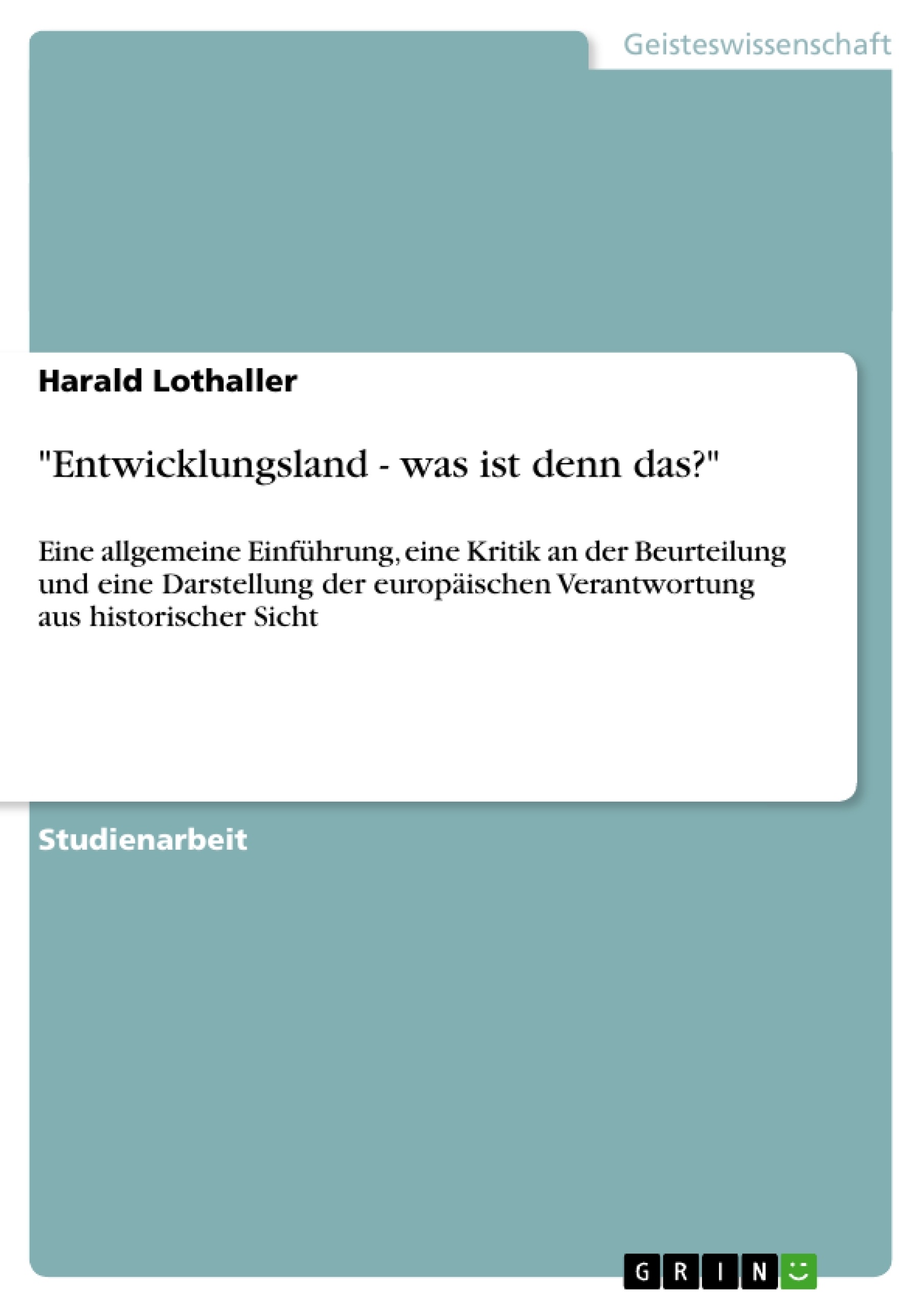"Entwicklungsland", "unterentwickelt", "Dritte Welt" - alltäglich verwendete Begriffe und dennoch oft unpräzise in der Abgrenzung bzw. unscharft definiert.
Die vorliegende Arbeit zeigt im ersten Teil verschiedene Kriterien zur Definition dieser Begriffe auf, beschäftigt sich im zweiten Teil mit Indikatoren zur Identifikation von Entwicklungsstand bzw. Entwicklungsländern und geht im dritten Teil kurz auf historische Verantwortung europäischer Länder für die aktuelle Situation von Entwicklungsländern wie auch für deren Zukunft ein.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
„Entwicklung“, „Dritte Welt“, „Entwicklungsland“ - was ist denn das?
Wer gilt als Entwicklungsland - und wer bestimmt das eigentlich?
Die Einteilung ist falsch! - Darstellung der Indikatoren und Kritik daran
Warum die Europäer Schuld tragen? - Kolonialismus und seine Folgen
Schlusswort
Literaturverzeichnis
Vorwort
Beim Suchen nach allgemeiner einführender Literatur zum Thema „Dritte Welt - Internationale Verschuldung“ beziehungsweise „gustieren“ verschiedener Themen für eine Seminararbeit stieß ich immer wieder auf einige, sehr häufig benutzte, alltagssprachliche und trotzdem in bestimmter Weise unklaren Begriffen wie „Entwicklung“, „unterentwickelt“, „Entwicklungsland“ und „Dritte Welt“. Natürlich war ich mir einigermaßen sicher, was damit gemein war, nichtsdestotrotz gab es immer wieder Ungereimtheiten, fehlten genaue Definitionen. Waren Definitionen versucht, war mir oft nicht klar, warum genau dieser oder jener Indikator entwicklungskennzeichnend sein sollte, waren europäisch-amerikanische Werte entscheidend für Beurteilungen anderer Länder, anderer Kulturen. Ich begab mich daher auf die Suche nach verschiedenen, vor allem nach immer wiederkehrenden Kriterien für die Definition von „Entwicklungsländern“, „Entwicklung“ und „Dritte Welt“ und möchte einige im ersten Teil dieser Arbeit vorstellen.
Der zweite Teil beschäftigt sich danach mit der Frage, wer bestimmt und wer dazu bestimmt wird, ein „Entwicklungsland“ zu sein. Und warum. Genau mit diesen Indikatoren beschäftigt sich der dritte Teil der vorliegenden, zeigt diese auf, geht auf sie näher ein, um sie dann aber im zweiten Schritt zu kritisieren und Probleme und Fehler der einzelnen Kriterien aufzuzeigen.
Abschließend wird dann anhand einiger ausgewählter Beispiele eine kurze Einführung in die Geschichte, die zur Entwicklung der Entwicklungsländer, zur Situation dieser und den Unterschiede zu den Industrieländern geführt hat, angefügt. Daraus soll kurz die Verantwortung der europäischen Staaten für die Gegenwart und Zukunft abgeleitet werden.
„Entwicklung“, „Dritte Welt“, „Entwicklungsland“ - was ist denn das?
In diesem Kapitel werden einige besonders relevante, immer wieder verwendete Begriffe erläutert und definiert, mit dem Versuch, erst verschiedene Ansätze darzustellen und dann kurze Kritiken anzufügen.
Der erste Begriff ist jener der „Entwicklung“. Schon bei diesem ist keine einheitliche, allgemein gültige und akzeptierte Definition zu finden. Grundsätzlich ist Entwicklung als Synonym für Veränderung oder Aufeinanderfolgen von Formen und Zuständen zu sehen, wobei unbedingt spätere auf frühere nach einer inneren Notwendigkeit und mit einer bestimmten Richtung folgen. Wie Entwicklung gesehen wird ist abhängig von räumlichen und zeitlichen Umständen sowie vom Standpunkt des Beobachters.1 Es fließen individuelle und kollektive Wertvorstellungen, vor allem über die gewünschte Richtung der Entwicklung, Theorien zu Ursachen von Ausmaß und Richtung von Entwicklung und historische Gegebenheiten in die Sichtweise von Entwicklung ein. Entwicklung ist folglich ein normativer Begriff.2 Die häufigste Anwendung von „Entwicklung“ ist jene im Sinne von „entwickelt“ und „unterentwickelt“ bezogen auf „entwickelte Industriestaaten“ und „unterentwickelte Staaten der Dritten Welt“. Dies impliziert bereits eine Wertung, die durch nichts zu rechtfertigen und ein eindeutig Hinweis auf die eurozentristische Ausrichtung der bestimmenden Personen und Ideen. Diese Wertung basiert auf der falschen Annahme, alle Völker dieser Erde müssten eine gemeinsame, wenn auch zeitversetzte Entwicklung vollziehen und auf ein universelles Entwicklungsziel zusteuern. Dies sei unsere Zivilisationsform der Industriegesellschaft, die absolut gut und anzustreben ist. Manche Völker, Staaten, Kulturen haben schon diesen höheren, vor allem höher technisierten Status als andere erreicht und sind somit „entwickelt“, während andere diesen Status erst erreichen müssen und noch „unterentwickelt“ sind. Das dieser Zugang ganz einfach falsch sein muss wird schon daraus ersichtlich, dass unsere Industriegesellschaft selbst an ihren Grenzen angelangt ist, insbesondere den ökologischen.3 Die Umweltsituation, die sozialen und gesundheitlichen Folgen in den Staaten der „Ersten Welt“ sowie erste zaghafte Versuche von Rückbesinnung wie zum Beispiel Versuche des „ökologischen Landbaus“ mit Anleihen an traditionellen Methoden, wie sie - angepasst an die jeweiligen regionalen Umstände - auch in den Entwicklungsländern angewandt werden, zeugen davon.
Die Begriffe „Dritte Welt“ und „Entwicklungsländer“ werden häufig synonym verwendet, wobei erster eher wertneutral für eine Gruppe von Ländern im internationalen System, für die sich bislang kein geeigneter Name finden ließ, eingeführt wurde. Die Herkunft des Begriffs geht auf das Jahr 1949 zurück, in Frankreich regierte die Rechte und ein Teil der Opposition versuchte unabhängig von der Kommunistischen Partei einen dritten Weg zu gehen. Der Begriff wurde dann auf die internationale Ebene übertragen, war vorbehaltsfrei, nicht abschätzig und diskriminierend, eher das Gegenteil war der Fall: In den 50-er Jahren wurden unter „Dritte Welt“ all jene Länder zusammengefasst, die positiv verstanden einen Dritten Weg der Blockfreiheit beschreiten wollten. Erst in den 60-er Jahren gewann wirtschaftliche Entwicklung in den internationalen Beziehungen an Bedeutung und der Begriff wurde auf alle Entwicklungsländer in Übersee ausgedehnt.4 Welche Staaten nun zur Dritten Welt gezählt werden, ist je nach Sichtweise und Kriterien unterschiedlich. Da die häufigste Verwendung von „Dritte Welt“ - etwas weniger diskriminierend und daher auch von vielen Wissenschaftlern und Politikern in den betroffenen Ländern bevorzugt5 - die Entwicklungsländer bezeichnet, gelten auch die dementsprechenden Indikatoren zur Einteilung, die im nächsten Punkt diskutiert werden, ebenso wie die dort vorgebrachten Kritiken.
Als dritter und letzter Begriff folgt nun jener des „Entwicklungslandes“, der trotz aller Probleme und Kritikpunkte auch in dieser Arbeit aus Mangel an allgemein verständlichen Alternativen verwendet wird. Um in die Probleme, die der Begriff beinhaltet, einzuführen, werden erst einmal mehrere Definitionen aus verschiedenen Arbeiten zum Thema kommentarlos, aber teilweise gekürzt wiedergegeben. „Es ist schwierig, eine befriedigende Definition zu erhalten, weil die Gestaltung der Welt und damit auch der Entwicklungsländer einer ständigen Veränderung unterworfen ist. Es lässt sich daher der Begriff Entwicklungsländer nur auf bestimmte Gebiete der Gegenwart einengen. Zu Entwicklungsländern in geographischer Hinsicht zählen (1) einzelne periphere Staaten des westlichen Europas, namentlich Portugal und Griechenland (aber auch die südosteuropäischen Staaten kommunistischen Gepräges können hierher gerechnet werden), (2) der größte Teil Iberoamerikas (gewöhnlich ohne Argentinien, Chile, Uruguay und einigen Gebieten Westindiens), (3) der Orient von Nordafrika bis nach Südwestasien (ohne Israel), (4) Südasien oder der indische Raum, (5) Südostasien (ohne Singapur), (6) Ostasien (ohne Japan und Hongkong), (7) die chinesischen Gebiete und die mongolische Volksrepublik in Zentralasien, (8) Ozeanien und (9) Negerafrika (außer der Republik Südafrika). Nach Meinung eines Nationalökonomen ist unter einem Entwicklungsland ein in verschiedener Hinsicht, so im Lebensstandard, in der Allgemeinbildung und im wirtschaftlichen Können seiner Bevölkerung sowie in der Ausnutzung seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten gegenüber anderen Staaten zurückgebliebener Raum zu verstehen. Ein Entwicklungsland kann also kulturell hochstehen, auch wenn es der Hilfe von außen für seine Menschen und seine Wirtschaft bedarf.“6 „Die Definition von Entwicklungsland hängt davon ab, ob das Entwicklungsdefizit dieser Länder, also die Unterentwicklung, als Stadium auf dem Weg zum Zustand der heutigen Industriestaaten oder als Strukturerscheinung, die auf Abhängigkeit zurückzuführen ist, verstanden wird. Sieht man wie ich Unterentwicklung als ein primär von exogenen Ursachen bedingtes Strukturproblem, dann sind Entwicklungsländer Länder, die in asymmetrischer, sie benachteilender Weise in die internationale Arbeitsteilung eingebunden sind, deren Produktionsstruktur auf den Weltmarkt und auf die Befriedigung der Bedürfnisse der Industrieländer ausgerichtet ist. In der entwicklungspolitischen Praxis häufiger anzutreffen ist allerdings die Bestimmung von Entwicklungsländern anhand von Merkmalskatalogen, wie sie beispielsweise von den Vereinten Nationen aufgestellt werden. Dabei werden als Kennzeichen von Entwicklungsländern unter anderen angeführt: ein niedriges Pro- Kopf-Einkommen, ein geringer Anteil der industriellen Produktion am Bruttoinlandsprodukt sowie eine niedrige Alphabetisierungsrate.“7
Ähnlich, nur etwas genauer, aber auch unübersichtlicher, beschreibt auch das „Lexikon Dritte Welt“ von Dieter Nohlen (Herausgeber) den Begriff „Entwicklungsland“, auf das unzählige Arbeiten bei ihren Begriffsbestimmungen zurückgreifen.
„...Die Einwohner dieser Länder sind unterernährt, die Schulbildung ist unvollständig, es besteht Mangel an Ärzten und die durchschnittliche Lebensdauer ist viel kürzer als in den entwickelten Ländern Die Entwicklungsländer führen Rohstoffe und Halbfabrikate, die entwickelten Länder vor allem Fabrikate aus. Nun war die Preisbildung dieser Güter so, dass die entwickelten Länder für ihre Güter relativ besser bezahlt wurden, während sie ihre Einfuhrgüter relativ billig bekamen. Dadurch verschlechterte sich die Lage der Entwicklungsländer noch mehr, denn sie mussten relativ mehr Güter abgeben und erhielten selbst relativ weniger Güter, d.h. das Gleichgewicht im Welthandel verschob sich zu Ungunsten der an sich schon schlechter gestellten Länder “8 Auch diese sehr vereinfachte Erklärung ist eine gültige Definition, wenn auch nicht wissenschaftlich, so dennoch alltagstauglich, und vielen Europäern und US-Amerikanern, die mit ihren Wahlstimmen auch über die Politik ihrer Regierungen gegenüber der Dritten Welt mitbestimmen, mit Sicherheit näher als Theorie über Entwicklung als Zustand versus Struktur. Der größte Fehler dieser letzten Definition ist aber nicht jene Unspezifität in Punkto Beschreibung von beziehungsweise Kategorien für Entwicklungsländer, welche sie unwissenschaftlich macht, sondern die Annahme, es hätte einmal ein Gleichgewicht am Weltmarkt gegeben, welches sich nun verschoben habe. Darauf wird im Kapitel zur Geschichte der Entstehung von Entwicklungsländer nochmals eingegangen.
„Wenn wir davon ausgehen, dass es die Dritte Welt nicht gibt, sondern Länder mit völlig verschiedenen Ressourcen und natürlich auch völlig voneinander abweichenden Interessen, so bedeutet das keineswegs, dass sich nicht doch ein große Gruppe von Ländern ausmachen lässt, in denen es Hunger und Armut gibt, Länder und Bevölkerungsgruppen, die im Weltsystem in großem Maße benachteiligt sind. Dagegen gibt es weiter Staaten, die gemeinhin zur Dritten Welt gezählt werden, in denen wie in Saudi Arabien und Kuwait das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung das in europäischen Industrieländern erreicht. In der Praxis werden beide Gruppen von Ländern jedoch in die gleiche Schublade „Entwicklungsländer“ oder eben Dritte Welt eingeordnet. Dies erfolgt mit Hilfe von bestimmten Kriterien, die in der Fachsprache Indikatoren genannt werden. Dabei wird unterstellt, dass diese Indikatoren nach objektiven Maßstäben beobachtbar oder messbar sind. Es gibt soziale Indikatoren als Anzeiger für die gesellschaftlichen Zustände, politische Indikatoren, die Aussagen zulasen sollen über Fragen der Macht und Machtausübung, und die besonders für die Einstufung von Ländern wichtigen ökonomischen Indikatoren, die zumindest bisher den Ausschlag für die Bewertung geben.“ Ein Land gilt also gemeinhin als Entwicklungsland oder unterentwickelt, wenn es bei diesen Kriterien im Vergleich mit den Industriestaaten schlecht abschneidet.9
Wie diese Indikatoren genau aussehen und worin die Probleme dieser liegen wird im entsprechenden Kapitel dieser Arbeit dargestellt.
Wer gilt als Entwicklungsland - und wer bestimmt das eigentlich?
Wer nun als Entwicklungsland gilt, ist also abhängig von der Definition von Entwicklungsland und, selbst wenn Einigkeit über den Begriff herrscht, von der Art der Indikatoren, den herangezogenen Daten und den Vergleichsdaten. Mehrere verschiedene internationale Organisationen legen fest, wer für sie als Entwicklungsland gilt, auf diese Einteilungen stützen sich dann - je nach Präferenz und Mitgliedschaft - Politiker und Regierungen, Wissenschaftler und Experten. Die wichtigsten derartigen Organisationen sind das United Nations Development Program (UNDP), die Entwicklungsbehörde der Vereinten Nationen, die Weltbank und der Ausschuss für Entwicklungshilfe (Development Assistance Committee, DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Eine einheitliche Liste existiert also nicht, so zählen zum Beispiel für die Vereinten Nationen europäische Staaten nicht zu den Entwicklungsländern, während das DAC einige sehr wohl miteinbezieht und entsprechend behandelt.
Innerhalb der DAC-Liste werden wiederum verschiedene sieben Kategorien von Ländern unterschieden, die Tabellen 1-6 zeigen die Einteilung im Jahr 1995. Tabelle 1 zeigt die „LLDCs“ (Least Developed Countries), die am wenigsten entwickelten Länder. Diese Gruppe wird von der UNO festgelegt nach den Indikatoren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf unter US-$ 473, Industriequote am Bruttoinlandsprodukt unter 10% und Alphabetisierungsquote Altersgruppe über 15 Jahre unter 20 %. Länder, die mindestens zwei der Indikatoren erfüllen und dem dritten nahe kommen, werden von der UNO als LLDCs eingestuft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab 1: „LLDCs“
In Tabelle 2 sind die „Other LICs“ (Other Low Income Countries), also andere Länder mit geringem Bruttosozialprodukt pro Kopf (weniger als $765 in 1995, Grundlage: World Bank Atlas), zu finden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab2: „LMICs“
Tabelle 3 führt die „LMICs“ (Lower Middle Income Countries) mit einem Bruttosozialprodukt pro Kopf zwischen $766 und $3 035 in 1995 auf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab3: „LMICs“
Tabelle 4 enthält den ersten Teil der „UMICs“ (Upper Middle Income Countries), den Staaten mit einem Bruttosozialprodukt pro Kopf zwischen $3 036 und $9 385 in 1995, und zwar jenen unterhalb der Grenze für Weltbankkredite ($4715):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab4: „UMICs - Teil 1“
Tabelle 5 führt die „UMICs“ oberhalb der Grenze für Weltbankkredite ($4715 in 1992) an:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab 5: „UMICs - Teil 2“
Weiters unterscheidet das DAC seit 1996 noch die Länder und Territorien im Übergangsstadium ("Schwellenländer"), dazu gehören zentral- und osteuropäische Staaten und neue unabhängige Staaten der ehemaligen Sowjetunion (Central and Eastern European Countries and New Independent States of the former Soviet Union, CEECs/NIS) und höher entwickelte Entwicklungsländer und Territorien (More Advanced Developing Countries and Territories), die in Tabelle 6 zu finden sind:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab 6: "Schwellenländer"
Alle anderen Länder dieser Erde werden zu den „HICs“ (High Income Countries) mit einem Bruttosozialprodukt pro Kopf höher als $9 385 in 1995 gezählt.10 Die Einteilung nach UNDP und Weltbank sowie eine aktualisierte nach DAC sind jährlich neu zum Beispiel im Internet zu finden:
UNDP: http://www.undp.org bzw. http://www.undp.org/undp/hdro/ für den Human Development Report (HDR)
Weltbank: http://www.worldbank.org DAC: http://www.oecd.org/dac/
Trotz aller Probleme bei der Begriffsbestimmung wird in dieser Arbeit weiterhin allgemein von Entwicklungsländern die Rede sein und im entsprechenden Kapitel werden übergreifende Kriterien dargelegt und nicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Indices und Einteilungen diskutiert. Abschließend sollen hier noch ein paar grundlegende Aspekte zur Diskussion zum Thema „Entwicklungsländer“ angefügt werden:
- „Entwicklungsländer“ sind eine sehr heterogene Gruppe, d.h. sie können sehr unterschiedliche Entwicklungsmerkmale aufweisen.
- Zur Einteilung bietet die wissenschaftliche Literatur eine Reihe von unterschiedlichen - teilweise auch interdisziplinären - Indikatorsystemen, die jedoch in der Realität u.a. wegen einer mangelhaften Datenbasis und schlichtweg falschen Gewichtungen zu umstrittenen, zum Teil auch absurden Einstufungen führen.11
- Die „Entwicklungsländer“ werden heute primär unter ökonomischen Kriterien in Gruppen eingeteilt, was an sich schon problematisch ist, weil soziale Unterschiede mathematisch „geglättet“ werden. Für die Zukunft werden aber insbesondere ökologische Kriterien für einen gemeinsamen Entwicklungsprozess aller Staaten ausschlaggebend sein.
Die Einteilung ist falsch! - Darstellung der Indikatoren und Kritik daran
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert, gibt es keine einheitliche Definition, sehr wohl aber einige immer wiederkehrende Indikatoren für Entwicklungsländer. Anhand dieser wird ein Land mit den Industrieländern, die diese Indikatoren prägen und entsprechend deren Gesellschafts- und Wirtschaftssystem diese formuliert worden sind, verglichen und dementsprechend einem bestimmten Status zugeteilt. Diese Indikatoren lassen sich in drei Gruppen einteilen: Wirtschaftliche, soziale und politische Indikatoren, wobei die wirtschaftlichen immer noch die entscheidenden für die Unterscheidung „Entwicklungsland versus Industrieland“ sind. Zu jedem einzelnen angeführten Punkt werden auch gleich einige Kritikpunkte und Anmerkungen, persönliche Gedanken und Anregungen, angeführt, die die Kuriosität, teilweise die Falschheit, dieser Indikatoren in der praktischen Anwendung aufzeigen sollen. Das immer wiederkehrende Merkmal ist jenes der Orientierung an „höher, besser, größer, schneller“ bei der Bewertung.
1.) Wirtschaftliche Indikatoren:
a.) Die landwirtschaftliche Produktion je Landarbeiter, ausgedrückt in einer kompatiblen ( = auf dem freien Markt tauschbaren) Währungseinheit (US- Dollar), soll etwas über den Gesamtzustand der Landwirtschaft in einem Staat aussagen. Ebenso verwendet werden als Indikatoren die Erträge je Hektar Fläche, der Einsatz von Maschinen, Chemikalien oder Futtermitteln usw.
Die in Europa und den USA üblichen landwirtschaftlichen Betrieben produzieren mit möglichst wenig Aufwand und Arbeitern und mit Einsatz von Chemie und Technik möglichst viele Produkte, die nur selten für die Ernährung der Erzeuger und ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern für in- und ausländische Großhändler bestimmt sind. An dieser Art werden nun Landwirtschaften in aller Welt gemessen. Erzeugt ein Landwirt in einem afrikanischen Staat mit traditionellen Arbeitsmethoden, seit vielen Generationen bewährt und im Einklang mit der ökologischen Situation, jene Produkte, die der Ernährung seiner Familie dienen oder im Tausch an andere Dorfmitglieder weitergegeben werden, trägt er nichts beziehungsweise negativ zur Bewertung seines Staates bei. Dies gilt ebenso wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb in einem solchen Staat auf gleicher Fläche mit der zwanzigfachen Anzahl an Arbeitern die gleiche Menge an Produkten erzeugt. Dass dabei einerseits wiederum weniger Chemikalien und technische Hilfsmittel eingesetzt werden müssen und somit ökologische Verträglichkeit gewährt bleibt, andererseits vielen Menschen Arbeit, Einkommen und Selbstachtung gegeben wird, bleibt unberücksichtigt. Eine ökonomisch optimal angepasste Form der Landwirtschaft, die mit geringstem Aufwand alles notwendige für seine Kunden produziert, gilt somit als unterentwickelt.
b.) Der Verbrauch an Energie, insbesondere Elektrizität oder Stahl je Einwohner gilt als Indikator für das industrielle Niveau eines Landes. Da man Industrie mit „entwickelt“ gleichsetzt, stellt auch die Zahl der in diesem Sektor Beschäftigten einen Indikator dar.
Das Gedankenkonzept hinter diesem Indikator entstammt längst vergangenen Zeiten - als Industrialisierung der „Status optimale“ war, Taylorismus und Fordismus als Theorien zur optimalen Arbeit galten, Umweltverschmutzung kein Thema war. Energieverbrauch zu senken gilt jedoch heute als positive Entwicklung. Außerdem hat der Dienstleistungssektor in der Weltwirtschaft an Bedeutung stark zugenommen, in der sogenannten „Ersten Welt“ ist er vorherrschend. Wenn man also diesen Indikator anwendet, gilt der Ruhrpott in Deutschland mit Industrie, Umweltausbeutung und -verschmutzung, Arbeitslosigkeit und fehlenden Zukunftsperspektiven als höher entwickelt als Frankfurt am Main - ohne Industrie, mit hoher Konzentration an Bankwesen, Forschung und Entwicklung - oder die Computerzentren in Indien - ebenfalls ohne Industrie, künstliche Städte, in denen weltweit inzwischen die höchste Konzentration an Programmierern und Computerexperten zu finden ist.
c.) Die Höhe der Exporte (in US-Dollar) je Einwohner, der Exportanteil am Bruttosozialprodukt sowie die Terms of Trade werden als Indikatoren für den Bereich des Handels verwendet.
Das Problem bei all jenen Indikatoren, die auf Anteil oder Produkt pro Einwohner abzielen, ist das gleiche, nämlich jenes der Verteilung unter den Einwohnern. Keine Statistik, keine Berechnung enthält Angaben über die Anzahl derer, die Gewinn aus etwas ziehen, beziehungsweise der meist viel größeren Zahl jener, die nichts davon haben.
d.) Das Passagieraufkommen je Kilometer auf Eisenbahnen oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, motorangetriebene Fahrzeuge je 1000 Einwohner oder Tonnen/Kilometer Eisenbahn- oder andere Transporte je Einwohner gelten als Indikator für den Stand des Transport- und Verkehrswesens.
Dieser Indikator übersieht völlig erstens verschiedene geographische Gegebenheiten, zweitens verschiedene Traditionen in Bezug auf Mobilität und drittens in Bezug auf Transportmittel. So haben verschiedene Nomadenvölker, zum Beispiel in den afrikanischen Wüstengebieten, eine für diese Gebiete hochentwickelte Logistik entwickelt, die jedoch völlig ohne Eisenbahn oder öffentliche Verkehrsmittel auskommt, auf Umwelt und Geographie des Landes Rücksicht nimmt und angepasst ist und für ganze Völker Überlebensgrundlage ist. Eine Modernisierung, eine Entwicklung bedeutet für diese Menschen ganz einfach den Tod. Ebenso in Asien, dort aber aufgrund eines ökologische Kollapses, denn wenn in China oder Indien eine ähnliche Zahl motorgetriebener Fahrzeuge für Passagier- oder Warentransporte eingesetzt werden würde wie in Mitteleuropa oder den USA, würde der folgende Schadstoffausstoß unweigerlich ganze Gebiete und Millionen Menschen vergiften.
e.) Die Höhe des Bruttosozialproduktes (BSP) wird gleich in mehrfacher Hinsicht als Indikator verwendet, z.B. BSP in US-Dollar je Einwohner eines Landes oder die Anteile der Landwirtschaft, der Industrie oder des Dienstleistungssektors am BSP etc.
„Das Bruttosozialprodukt (BSP) ist eine Geldgröße, die das gesamte Ergebnis des Wirtschaftsprozesses eines Landes in einem bestimmten Zeitraum, meist ein Kalenderjahr, beschreibt. Es setzt sich zusammen aus der Summe der Investitionen (für Maschinen, Gebäude, Infrastruktur), des gesamten Konsums (von der Nahrung bis zum Privat-PKW) sowie der Differenz von Export minus Import. Fragwürdig ist die Auffassung, mit wachsendem BSP steige die allgemeine Wohlfahrt und das persönliche Wohlergehen. Zyniker könnten anführen, jeder schwere Verkehrsunfall steigere das BSP, da ein neues Auto und Geräte in Krankenhäusern benötigt würden.“12
Ein weiteres Problem ist bereits im ersten Punkt der Kritik an den Indikatoren angeführt. Und was statistischen Kennzahlen wie dem BSP ohnehin immer vorzuwerfen ist, ist die Vertuschung des Einzelnen, der Unterschiede, die Vorgaukelung eines einheitlichen Niveaus des Zustands. So ist es möglich, dass für ein Land mit extremen Einkommensunterschieden ein hohes BSP berechnet wird, aber 40 Prozent der Bewohner unter dem Existenzminimum leben und hungern, während in einem anderen Land mit deutlich geringerem BSP jeder wenig, aber alle genug haben. Da stellt sich dann die Frage, was anstrebenswert ist für unsere eine Welt.
f.) An weiteren Indikatoren werden der Prozentsatz der Lohn- und Gehaltsempfänger an der Gesamtbevölkerung genannt, die Anzahl der in den drei Bereichen Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen Beschäftigten usw.
In unserer westlichen Gesellschaft sind Statistiken, Ordnungen, Vorschriften Grundlage des Zusammenlebens. Alles ist erfasst, alles ist geregelt. In vielen anderen Gebieten und Staaten gibt es keine genaue Erfassung von jeder Kleinigkeit, es ist einfach nicht notwendig, nicht sinnvoll, nicht machbar. Oft weiß man nicht einmal, wie viele Menschen in einem bestimmten Gebiet wohnen, was sollen dort also Kennzahlen wie der Prozentsatz der Lohnempfänger? Somit wird meist nur ein geringer Teil der Gesamtbevölkerung, jener, der in den der westlichen Gesellschaft nachempfundenen urbanisierten Gebieten lebt, in die Indikatoren übernommen. Solche Kennwerte sind aber extrem verzehrt und daher nicht brauchbar. Dass das Zusammenleben und die traditionelle „Wirtschaft“ in den nicht erfassten, weil nicht erfassbaren Gebieten, mit Tauschhandel und Nomadenleben, mit Verschmelzung der drei Sektoren und informellem Handel, ohne Verordnungen und formelle Buchhaltung oft besser funktioniert als in den Großstädten, ist für viele Menschen in Europa und den USA nicht vorstellbar.
2.) Soziale Indikatoren
a.) Der Grad der Alphabetisierung soll eine Aussage über das allgemeine Bildungsniveau (hohe formale Bildung = entwickelt) machen, dazu u.a. auch die Einschulungsrate, die Rate der Studenten an Hochschulen, der Prozentsatz von Mädchen an den einzelnen Schulzweigen usw.
Bildung ist nicht gleich Bildung. Das, was wir in der westlichen Gesellschaft als notwendige, als sinnvolle, als wünschenswerte Bildung ansehen, ist ganz und gar nicht jene Ausbildung, die Menschen in anderen Gebieten der Welt benötigen. Vor allem die Schaffung einer universitären Bildungselite in den afrikanischen Staaten entspricht der westlichen Bildungsauffassung. Was das Land, was die Menschen aber benötigen, wäre eine Basisbildung, Grundlagen in Lesen, Schreiben, Rechnen, die in einer drei- bis vierjährigen allgemein verpflichteten Schulform vermittelt werden kann. Danach wäre aber eine handwerkliche, agrarische oder ähnliche Ausbildung auf breiter Basis notwendig. Und zwar so, dass aufgrund der relativ kurzen Dauer die Zahl der Abbrecher möglichst gering gehalten wird. Nicht sinnvoll ist eine Allgemeinbildung ähnlich unseren AHS oder amerikanischen Highschools mit anschließend fast zwangsläufig folgender Universität für alle und schon gar nicht - so wie derzeit und auch in näherer Zukunft - nur für wenige auserwählte, bessersituierte Menschen. Und vor allem die Richtung der Ausbildung sollte überdacht werden: So wählten in den 60-er Jahren von 100 Studierenden in Ghana 96 ein geisteswissenschaftliches Studium! Und auch wenn sich die Zahl inzwischen etwas reduziert hat, das, was dieses Land am ehesten benötigt, sind Spezialisten in der Agrarwissenschaft und Bodenkultur, wenn sich die Situation der Menschen bessern soll. Nur bedarf es dafür wiederum vor allem einer Vielzahl an basisgebildeten Menschen mit agrarischem Grundlagenwissen, die „die Arbeit machen“. Nur Häuptlinge und keine Indianer mehr - das kann nicht die Zukunft der Bildung sein, nicht bei uns und schon gar nicht in den ärmeren Staaten Afrikas und Asiens. Daher ist auch ein Indikator für Entwicklung, der genau diesen Trend fordert und fördert, zu verwerfen!
b.) Die durchschnittliche Lebenserwartung soll eine Aussage über die Ernährungslage und das Gesundheitswesen ermöglichen, ferner werden als Indikatoren verwendet die Kindersterblichkeitsrate, die Zahl der Einwohner je Arzt oder Krankenbett, Todesfälle aufgrund von Seuchen etc.
Der Schluss von durchschnittlicher Lebenserwartung auf Ernährungslage und Gesundheitswesen ist nur begrenzt zulässig, da zusätzlich sehr viele andere Faktoren einwirken wie zum Beispiel unnatürliche Todesursachen (Kindermord, Kriminalität, Unfälle etc.). Außerdem ist ein linearer Zusammenhang zwischen Ernährungslage und Lebenserwartung keineswegs gegeben, wenn man zum Beispiel Krankheiten aufgrund unserer Überflussgesellschaft berücksichtigt. Ebenso sind Indikatoren wie Kindersterblichkeit von anderen Faktoren beeinflusst wie traditioneller Einstellung zu Geschlechtern und daraus folgende Kindesermordung oder auch Abtreibungsrate und Möglichkeiten zur Geburtenkontrolle. Und bei Einwohnern pro Arzt sind weder Stadt-Land-Gefälle berücksichtigt noch traditionelle und alternative Medizinformen, die in den nicht-westlichen Gebieten weit verbreitet und der Schulmedizin oft überlegen sind. Wenn man jedoch diese Kritikpunkt und gegebene Verzerrungen berücksichtigt, sind solche Indikatoren großteils recht brauchbare Grundlagen für Beschreibungen - keinesfalls jedoch für Beurteilungen!
c.) Der Konsum von Proteinen gilt als Beitrag zur Bestimmung der Ernährungssituation.
Auch hier gilt es, traditionelle und regionale Eigenheiten zu berücksichtigen und den nicht-linearen Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit zu beachten, dann ist auch dieser Indikator durchaus tauglich zur weiteren Beschreibung von Ernährungszuständen.
d.) Die Personenzahl je Wohneinheit ist ein oft verwendeter Indikator, der etwas über die allgemeinen Wohnbedingungen aussagen soll. Genannt werden fernen als Indikatoren die Zahl von Wohnungen mit fließendem Wasser und WC, Wohnungen mit Stromversorgung usw.
Auch hier sind die traditionellen Familienformen zu berücksichtigen, denn der bei uns übliche Single- oder Klein- bzw. Kernfamilienhaushalt in einer Wohneinheit ist keineswegs als Maß anzuwenden im Vergleich mit traditionellen Familienverbänden mit sozialem Netz und Alten- und Kinderversorgung. Auch die Zahl der Wohnungen mit Wasser und WC sind ein eurozentristisches Maß, da wiederum traditionelle und regionale Eigen- und Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Außerdem ist zu beachten, ob diese Wohnungen von den Bewohnern auch leistbar sind: Ein neues Wohnhaus nach europäischen Standards zu bauen, ist vermutlich oft nicht das Problem. Aber die Menschen müssen sich das Wohnen darin auch leisten können und es muss den traditionellen Familiensystemen entsprechen. Ansonsten wäre zwar die Zahl der Wohnungen und somit der Indikator hoch, die Nutzung jedoch und somit der effektive Nutzen für die Menschen gering.
3.) Politische Indikatoren
a.) Die Auflagenhöhe von Tageszeitungen, bezogen auf 1000 Einwohner, die Anschlussdichte von Telefonen, die Anzahl von Radiogeräten, Fernsehern etc. soll den Zustand der Kommunikation in einem Land beschreiben.
Auch hier ist wiederum Rücksicht zu nehmen auf traditionelle und regionale Eigenheiten sowie auf das Bedürfnis nach technischen Einrichtungen wie Fernsehapparaten oder Telefonen. All diese Dinge sind global gesehen als Luxusartikel zu betrachten, die einerseits für viele Menschen nicht notwendig, nicht interessant, maximal verlockend sind, andererseits aufgrund von fehlender Basisbildung bedeutungslos sind. Auch hier ist wiederum ein großes Stadt-Land- Gefälle zu beobachten, andererseits die Bedeutung überregionaler Kontakte, Kommunikation und Informationsverbreitung zu beachten. Drei abgelegene Bergdörfer in den Anden werden vermutlich weniger Interesse an einer Tageszeitung aus Lima oder einer Telefonverbindung mit den Städten im Tal haben als an den sozialen und Handelsbeziehungen mit den Nachbarn und es würde ihre traditionellen (Über-)Lebensweisen stark verändern oder gar zerstören, wenn vierundzwanzig Stunden am Tag „Unterhaltung“ und ein ganz anderes Leben per Fernsehapparat in die Dörfer getragen würde. Aufgabe des Bauernlebens und Landflucht - wie ja weltweit zu beobachten - wären die Folge. Also bleibt zu hoffen, dass noch ein paar Jahre einige Gebiete bei diesem Indikator als unterentwickelt gelten!
b.) Der Grad der Freiheit politischer Organisationen und Presse oder des Wettbewerbs zwischen Parteien soll etwas über die politischen Verhältnisse aussagen. Angeführt werden als Indikatoren fernen der Zentralisierungsgrad politischer Macht, die politische Bedeutung der traditionellen Eliten bzw. der Militärs oder der wie auch immer zu definierende Grad administrativer Effizienz (= Erfolg und Wirksamkeit von Verwaltung)
„Es ist ja auch eine vor allem in westlichen Demokratien verbreitete Denkweise, demokratische Freiheiten, wie sie bei uns definiert werden, anderen Freiheiten etwa vor Hunger und Arbeitslosigkeit voranzustellen. Es nützt einem armen Inder recht wenig, einmal alle paar Jahre wählen zu dürfen und das Recht zu genießen, seine Meinung in Wort und Schrift zu verbreiten. Garantierte man ihm einem mittelmäßig bezahlten Arbeitsplatz, so wäre für ihn gerade diese Garantie das höchste Recht als Mensch in seinem Land. Gar eurozentristisch ist die Haltung, alles, was unserem Verständnis von Demokratie entspricht, als allgemeingültig anzusehen und zugleich alle anderen Interpretationen abzulehnen. Die in Ländern der Dritten Welt vielfach vorkommende Verhandlungsdemokratie mit absolutem Minderheitenschutz ist etwas, das bei uns nicht einmal in politischen Utopien vorkommt, geschweige denn kurzfristig als realisierbar angesehen wird: Auch wenn es lange dauert, vielleicht sogar tagelang, so diskutieren die Bewohner eines Dorfes, ob sie einem Brunnen bauen wollen und wo dieser Brunnen hinkommen soll. Erst wenn alle einem Vorschlag zugestimmt haben, ist der Beschluss gültig.“13
Es sollte also weniger die Übereinstimmung des beurteilten politischen Systems mit dem eigenen und den eigenen Präferenzen als die Folgen des Systems für die Menschen in einem Staat und die Bedeutung für Leben und Überleben berücksichtigt werden. Weniger Eurozentrismus und mehr soziales Hinterfragen würden diesen Indikator objektiver, anwendbar und gültig machen, aber vermutlich für so manches Industrieland ein trauriges Ergebnis bringen.
Eine weitere Gruppe von Indikatoren hat rein komparative Bedeutung und soll eher beschreiben als werten, auch wenn dies häufig nicht beachtet wird. Hierzu zählen Religion, die Umwelt, ethnischer Pluralismus und letztendlich auch der Grad der Verstädterung.14
Auch bei diesen sollte die ego- beziehungsweise eurozentristische Maßsetzung zugunsten einer Folgendiskussion fallengelassen werden und der Vorsatz der Beschreibung unter möglichst objektiven Kriterien wieder in den Vordergrund rücken, so wie es eben auch für die anderen angeführten Indikatoren sinnvoll wäre. Es bleibt aber auch bei neuen, überdachten Kriterien die Frage offen, ob diese überhaupt benötigt werden, ob nicht etwa soziale beziehungsweise soziologische Analysen wirtschaftlichen Daten vorzuziehen sind und ob eine Einteilung der Welt in verschiedene Welten aufrecht erhalten werden soll und kann.
Warum die Europäer Schuld tragen? - Kolonialismus und seine Folgen „Warum sollen wir denen helfen?“, „Wir habe uns das auch selbst erarbeiten müssen!“ und „Die sind doch eh selbst schuld!“ - Aussagen und Gedanken, die in Europa und den USA immer wieder auftauchen, wenn es um die Situation ärmerer Staaten und um eventuelle Hilfe für Entwicklungsländer geht. Was dabei oft vergessen wird, ist die „europäische“ Vergangenheit der meisten dieser Länder und die Verantwortung, die Europa für die Entwicklung im Rest der Welt übernehmen muss, oft aber noch nicht bereit und gewillt ist zu übernehmen. An Beispielen aus dem in dieser Arbeit schon mehrfach zitierten Buch „Entwicklung und Abhängigkeit“ von Bliss, Ehrenberg und Schmied soll diese Verantwortung aus der Geschichte für die gegenwärtige Situation dargestellt werden.
Zum Beispiel Indien: Die wirtschaftliche Seite
Indien war zu Beginn der britische Herrschaft ein wohlhabendes Land (mit allerdings bereits damals ungerechter Wohlstandsverteilung), in dem Industrien, Landwirtschaft und Handwerk auf die Umwelt und das soziale Leben abgestimmt waren. Neben dem Abzug von Reichtümern jeder Art, vor allem von Rohstoffen, wurde das Land in britischer Zeit vor allem Absatzgebiet für teure englische Industriewaren. Um diese aber absetzen zu können, musste zunächst einmal die einheimische indische Konkurrenz ausgeschaltet werden, durch Zerstörung der Produktionsstätten und durch Verbote an die Bevölkerung, indische Waren zu kaufen. Das gelang unter Anwendung von Polizeiterror so vollständig, dass bis zum Ersten Weltkrieg so gut wie keine Industrie mehr vorhanden war und der traditionelle Binnenhandel vollständig in britischer Hand oder in der weniger, von Engländern privilegierter Fürsten blieb. Die Folgen für das unabhängige Indien waren vor allem das Fehlen von Grundlagen für einen Aufbau moderner Gewerbezweige und von technischem Know-How. Hinzu kam auch die heute noch vom heutigen indischen Staat kaum bekämpfte Landflucht jener Massen, die auf dem Land keine Einkommensmöglichkeit außerhalb der Landwirtschaft fanden und die Städte füllten.
Zum Beispiel Algerien: Ein Land wird zur Steppe
Wenn heute das algerische Grünland am Mittelmeer oft kaum mehr als 50-100 Kilometer tief ins Landesinnere reicht, so ist das kein gottgewollter natürlicher Zustand. Die Franzosen, zum Großteil als Siedler ins Land gekommen, drängten die algerischen Bauern in wenig produktive und ökologisch sensible Gebiete zurück und errichteten auf dem erbeuteten Land die heute noch - in Hand des Staates - bestehenden Großfarmen mit ihren Monokulturen, vor allem Wein und Weizen. Unter anderem im Gebiet zwischen den beiden Zügen des Atlasgebirges, früher eine der Natur angepasste einträgliche und viele Zehntausende Nomaden ernährende Weideregion, wurde der Boden aufgerissen und bepflanzt. Das restliche Land, auf das die Einheimischen zusammengedrängt wurden, musste von diesen völlig übernutzt werden, wenn sie überleben wollten. Die heute noch zu beobachtenden Folgen sind eine weit verbreitete Bodenerosion, entweder durch Überweidung verursacht oder durch die in diesem Naturraum einfach nicht zu verkraftende Zerstörung der bodenschützenden Schicht. Wo früher eine feste, graswurzelnde Oberfläche war, rissen im Winter die Wassermassen den umgepflügten, freiliegenden Boden zwischen den Weinstöcken auf. Es entstanden tiefe Erosionsrinnen, du der Humus von ganzen Flächen wurde abgespült. Der Wind im Frühjahr fegte das restliche lose Material davon. Heute können wir Hunderte von Kilometern durch das Hochland fahren, wo nichts als Halbwüste ist. Im letzten Jahrhundert begann also aus der kolonialen Situation heraus das, was wir heute erstaunt als das „Vordringen der Sahara“ nach Süden oder in diesem Fall nach Norden feststellen.
Im Süden der Sahara war es übrigens ganz ähnlich. In Ländern wie Mali oder dem Niger vertrieb die Kolonialmacht die Menschen von guten Böden und zwang sie dazu, in sensiblen Savannengebieten das Land übermäßig auszubeuten, so dass es auch hier zu Desertifikation, zu menschengemachter Wüstenbildung kann. Auf den guten Flächen aber wurde mit Maschinen für den Export ins „Mutterland“ produziert, mit wenigen Arbeitskräften, aber höchst profitabel. Die unabhängigen Staaten fanden als Ergebnis der Kolonialzeit entweder vergrößerte Wüsten vor oder landwirtschaftliche Flächen, die mit dem Mitteln der betroffenen Länder kaum zu bewirtschaften waren.
Zum Beispiel Senegal: Ausbildung und Studium in Frankreich
Der Senegal ist ein Land mit 12 größeren ethnischen Gruppen. Als die Franzosen Mitte des 19. Jahrhunderts eindrangen, stellte man deren kulturellen Einflüssen vom Islam geprägte Erneuerungsbewegungen in Religion und Politik entgegen. Die kulturpolitische und verwaltungstechnische Antwort der Kolonialherren war die Spaltung der Gesellschaft, indem man einen Teil der Einwohner neu gegründeter und damit stark kontrollierter Städte die französische Staatsbürgerschaft „schenkte“. Das senegalesische Volk wurde damit erfolgreich aufgespalten in solche, die sich als Franzosen fühlen durften, in Paris studierten und fortan zumeist auch unbewusst die „weiße Seele in schwarzer Haut“ in ihrem Land umhertrugen, und die große Bevölkerungsmehrheit, die vom Einfluss her aber zur afrikanischen Minderheit wurde. So kann es nicht verwundern, dass mit Persönlichkeiten wie dem zweifelsohne bedeutenden früheren Staatschef L.S.Senghor Senegalesen kulturell wie politisch dominierten, die selbst dann, wenn sie den afrikanischen Nationalismus und die Bedeutung der afrikanischen kulturellen Tradition betonen, dieses aus Sicht und mit dem Mitteln der europäischen Geisteswissenschaftler betrieben. Eine senegalesische Nationalkultur, eine wesentliche Voraussetzung für eine unabhängige und selbstbewusste Entwicklungspolitik, ist damit auf Generationen unmöglich gemacht worden.
Zum Beispiel Tunesien: Arabischunterricht in französischer Sprache
Tunesien wurde von 1881 bis 1956 von Frankreich mehr oder weniger als Kolonie beherrscht, wenngleich man dem Dey von Tunis einige Restbefugnisse beließ. Als die Franzosen in das Land eindrangen, gab es kein alle Kinder des Landes erreichendes Bildungssystem nach europäischem Vorbild, wohl aber eine Reihe von Einrichtungen, in denen neben der Religion des Islam andere Dinge gelehrt wurden, die wie Lesen, Schreiben oder islamische Tradition auch heute noch wesentliche Bestandteile des Unterrichts sind - wieder sind, müsste man besser sagen. Denn die Franzosen schafften in dem arabischen Land Arabisch als Sprache im Bildungssektor fast völlig ab. Französische Sprache, Geschichte und Geographie sind nur einige Fächer, die tunesischen Kindern beigebracht wurden, sofern sie zu den wenigen gehörten, die überhaupt einen Platz in den Schulen erhielten. Dies paradoxe Situation ging so weit, dass an der Universität von Tunis in den 50er Jahren arabische Literatur und Sprache auf Französisch gelehrt wurde. Als das Land 1956 seine Unabhängigkeit wiederbekam, konnte kaum jemand mit Schul„bildung“ noch richtig Arabisch. Sämtliche Lehrinhalte und Lehrpläne an den Hochschulen mussten in mühevoller Kleinarbeit umgeschrieben und praktisch das gesamte Schulwesen musste in einem mühsamen Prozess auf Tunesien selbst zugeschnitten werden. Begonnnen wurde an den Grundschulen, wo ein Fach nach dem anderen auf Arabisch umgestellt wurde, und es dauerte fast eine Generation, bis genügend Lehrer zur Verfügung standen, die in einem arabischen Land in der Lage waren, den Unterricht auch an höheren Schulen in der Landessprache zu gestalten.
Zum Beispiel Marokko: Der eine beherrscht den anderen
Obwohl weder die Franzosen die herausragenden Kolonialherrscher noch die nordafrikanischen Staaten die allein Geschädigten des Kolonialismus sind, sei anhand von Marokko auf eine weitere aus der Kolonialzeit resultierende Ursache für schlechte Startbedingungen nach der Unabhängigkeit verwiesen, das Prinzip „Teile und herrsche“. Spannungen zwischen dem kulturell zumeist arabisch beeinflussten Herrschaftsgebiet des Sultans von Marokko und den mehr oder weniger unabhängigen Berberstämmen der Atlasregion und des Rif wurden von den Franzosen ausgenutzt, indem man zuerst die Araber gegenüber den Berbern, später die letzteren zu Lasten der Araber bevorzugte, teilweise sogar zur Unterdrückung der anderen benutzte. Während das gesamte Sultansland strengen französischen Gesetzen unterworfen wurde, gewährte man den Berbern, oder besser gesagt ihren Führern, weitgehende Autonomie, ließ sie sogar bei Spannungen Frankreichs mit dem Sultan gegen diesen militärisch ausrücken. Nach dem Prinzip „Teile und herrsche“ ging man sogar so konsequent vor, dass der Lohn, den der gerade „Begünstigte für sein Wohlverhalten erhielt, wider alle Menschlichkeit sein durfte. So konnte der Fürst von Marrakech (der „Glaoui“) ein Imperium mit mittelalterlichen Methoden aufbauen, bei denen Sklaverei, Vergewaltigung, Folter und Beraubung der Untertanen - und das bis in die fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts! - an der Tagesordnung waren. Als Gegenleistung stellte der Glaoui den Franzosen mehr als einmal seine Macht zum Kampf gegen den (arabischen) Sultan zur Verfügung. Auch wenn viele Marokkaner dieses Spiel mit den ethnischen Gruppen des Landes durchschauten, ist es bis heute nicht gelungen, die damals fremdgesteuerten Spannungen zwischen arabisch- und berbersprachigen Ethnien völlig aufzuheben.
Die angeführten Beispiele ließen sich beliebig fortführen, teilweise noch krasser darstellen. Wesentlich ist, dass erkannt wird, mit welchen unterschiedlichen Auswirkungen der Kolonialzeit die Länder im Süden heute zu kämpfen haben, welche Behinderungen ihrer Bewegungsfreiheit berücksichtigt werden müssen, wenn man das wirtschaftliche, kulturpolitische oder auch umweltorientierte Handeln der Regierungen beurteilen oder gar bewerten will. Aus Platzgründen konnte dabei nicht einmal näher auf die oft willkürlichen kolonialen Grenzziehungen eingegangen werden, mit denen vor allem Afrika noch heute leben muss. Ganze Völker wurden auf zwei oder mehrere Staaten verteilt (z.B. im Sahel), wirtschaftliche Großräume wurden zerschnitten und unzählige weitere Probleme für die zukünftige Nationwerdung geschaffen. Politikern, Bauern oder Arbeitern in ehemaligen Kolonie ihre fehlende Erfahrung, schlechte Wirtschaftsführung oder gar den katastrophalen ökologischen Zustand ihrer Länder vorzuwerfen, sind in vielen Fällen (weitaus nicht allen Fälle!) mit die peinlichsten Ausrutscher, die den Nachfahren der alten Kolonialherren heute möglich sind.
Abschließend sollen hier noch eine modernere Form des Kolonialismus genannt werden, nämlich einige Arten der „Internationalen Entwicklungszusammenarbeit“. Während die Entwicklungszusammenarbeit“ in der Öffentlichkeit ohne jede Differenzierung als großmütige Hilfe für arme Länder in der „Dritten Welt“ dargestellt wird, ist sie doch in zahlreichen Fällen nichts anderes als die direkte Fortsetzung des alten Kolonialismus ohne militärische Mittel. Als eines der schlimmsten Beispiele kann dabei die Weizenpolitik der USA im Hinblick auf Länder wie Ägypten oder die Elfenbeinküste angesehen werden. Erst schenkt man einem keinesfalls bedürftigen Land Getreide im Überfluss, bis dort selbst kaum noch etwas angebaut werden kann (preislich kann kein Bauer der Welt die Konkurrenz mit kostenlosem Weizen bestehen) und das Land im wahren Sinne des Wortes hilfebedürftig wird. Dann werden die Geschenke auf einmal zu teurer Importware, die ein land hoch verschuldet und damit verarmen lassen. Oder das Land hoch verschulden und damit verarmen lassen. Oder das Land wird politisch auf Gedeih und Verderb an den Weizen„spender“ ausgeliefert und muss sich so verhalten, wie der Spender es für richtig hält. Eine derartige Politik wird auch als Neo-Kolonialismus bezeichnet.15
Schlusswort
Wie der Ausweg aussieht, um einen Verbesserung der Situation für alle Menschen dieser Welt, unabhängig von ihrer Rasse, Herkunft, Ort, an dem sie leben, nur abhängig von ihren individuelle Bedürfnissen, zu erreichen, dass weiß leider niemand. Aber eine Verbesserung der Situation jener Menschen, die in den armen Ländern, vor allem auf der südlichen Erdhalbkugel, leben, kann nur in den Köpfen beginnen, jedoch gefolgt von praktischer Anwendung und Umsetzung. Das Umdenken betrifft einerseits die Menschen in Europa und den USA, und zwar in der Änderung der Sichtweise der Verantwortung für die Lage anderer Menschen, in der Art, wie man sich diesen Ländern gegenüber verhält, und im Verhalten, vor allem Konsumverhalten, mit dem man den verdeckten Kolonialismus am Leben erhält. Vor allem die Sichtweise, die Bewertung, die Einstellung gegenüber den „Entwicklungsländern“ muss sich ändern, solange diese als unterentwickelt, weniger zivilisiert und wert, nicht als gleichberechtigte Partner mit anderen Voraussetzungen, solange die Menschen in diesen Ländern Bittsteller und die in Europa und den USA als großherzige Spender gesehen werden, wird es auch zu keiner relevanten Änderung kommen. Ebenso muss sich die Einstellung bei den Regierungen, aber auch den „kleinen Menschen“ in den verarmten Staaten ändern. Denn solange man sich als abhängig von fremder Hilfe sieht, für diese Hilfe alles gibt, sich eher mit fremden, zum Beispiel den Hilfegebern, als den eigenen Leuten solidarisiert, bleibt man abhängig und biegsam für Einflüsse von außen. Eine Besinnung auf das Gemeinsame nach Innen, eine Stärkung des „Wir“s, eine gewisse Abgrenzung nach außen, vor allem gegen eine unreflektierte Übernahme jeglicher Vorgaben und Gedanken, wird ein erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung, Gleichstellung und internationale Partnerschaft sein. Dann muss es auch möglich sein, selbständig zu entscheiden, freie Entscheidungen zu treffen, dazu gehört dann auch die Freiheit, Hilfe anzunehmen oder auch abzulehnen. Erst dann können praktische Maßnahmen beginnen, die nicht nur eine kurzfristige Notlinderung im Katastrophenfall oder eine Steigerung der Abhängigkeit und Fortsetzung des Kolonialismus bedeuten, die nicht an Bedingungen gebunden sind, sondern langfristig stabile Verbesserungen für die Menschen bringen.
Literaturverzeichnis
Bücher:
Abdelnasser Hassan Mohammed: „Entwicklungsländer (Allgemeine Kennzeichen - Entwicklungshilfe)“ Inaugural-Disseration zur Erlangung der Doktorwürde an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens- Universität Graz, Graz, April 1967
Bliss, Frank, Ehrenberg, Eckehart, Schmied, Ernst A.:
„Entwicklung und Abhängigkeit - Eine Einführung zur entwicklungspolitischen Bildung“ 2.Auflage, herausgegeben von Polit. Arbeitskreis Schulen e.V.; Bad Honnef: Horlemann, 1993
Brusatti Doz. Dr. Alois, Karpstein Dkfm. Herta und Wintersberger Dkfm. Dieter:
„Österreichische Entwicklungshilfe - Leistungen und Möglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der Vermittlung von Wissen und technischem Können“ - Österreichische Schriften zur Entwicklungshilfe, Band 2, herausgegeben von Prof. Dr. Leopold Scheidl, Vorstand der
Forschungsinstitutes des Österreichischen Auslandsstudentendienstes, Wien 1963, Verlag Ferdinand Berger, Horn
Wirth Heinz: „Aspekte des Zusammenhangs von Entwicklungshilfe und
Entwicklungsplanung in Tansania“ Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich- Wilhelms-Universität zu Bonn, Bonn 1985
Internet: http://www.payer.de/entwicklung/entw01.htm (Mai 2000)
[...]
1 Vgl. Wirth, Heinz, S.20
2 Vgl. Nohlen, Dieter (Hg.), S.216
3 Vgl. Bliss, Frank et al., S.28/29
4 Vgl. Nohlen, Dieter (Hg.), S. 184/185
5 Bliss, Frank et al., S. 31
6 Brusatti, Alois et al., S. 7
7 Vgl. Wirth, Heinz, S. 21
8 Vgl. Abdelnasser, Hassan Mohammed, S. 1/2
9 Vgl. Bliss, Frank et al, S. 36
10 Vgl. http://www.payer.de/entwicklung/entw01.htm
11 Vgl. Bliss, Frank et al, S. 106
12 Bliss et al., S.38
13 Bliss et al., S. 41
14 Bliss, Frank et al., S. 36-38 für die Indikatoren
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieser Arbeit über "Dritte Welt - Internationale Verschuldung"?
Die Arbeit behandelt die Definitionen von Begriffen wie "Entwicklung", "Dritte Welt" und "Entwicklungsland", untersucht, wer als Entwicklungsland gilt und wer diese Einstufung vornimmt, kritisiert die verwendeten Indikatoren und beleuchtet die historischen Ursachen und die Verantwortung Europas für die Situation der Entwicklungsländer.
Welche Definitionen von "Entwicklung" werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit betont, dass es keine einheitliche Definition von "Entwicklung" gibt. Sie wird oft als Synonym für Veränderung gesehen, aber die Sichtweise ist stark von räumlichen, zeitlichen und individuellen Wertvorstellungen geprägt. Die Arbeit kritisiert die eurozentristische Wertung, die "entwickelte Industriestaaten" als Ideal sieht.
Was bedeutet der Begriff "Dritte Welt" laut dieser Arbeit?
Der Begriff "Dritte Welt" wurde ursprünglich neutral für eine Gruppe von Ländern ohne passende Bezeichnung eingeführt. In den 50er Jahren umfasste er Länder, die einen dritten Weg der Blockfreiheit beschreiten wollten. Später wurde er auf alle Entwicklungsländer in Übersee ausgeweitet, wobei die genaue Zuordnung je nach Sichtweise und Kriterien variiert.
Welche Kritik wird an der Definition von "Entwicklungsland" geübt?
Die Arbeit kritisiert, dass die Definition von "Entwicklungsland" oft auf Merkmalen basiert, die von den Vereinten Nationen oder anderen Organisationen festgelegt werden, wie z.B. niedriges Pro-Kopf-Einkommen, geringer Industrieanteil und niedrige Alphabetisierungsrate. Sie bemängelt, dass diese Kriterien oft eurozentristisch sind und die Vielfalt der Entwicklungsländer nicht berücksichtigen.
Wer bestimmt, welche Länder als Entwicklungsländer gelten?
Verschiedene internationale Organisationen wie das United Nations Development Program (UNDP), die Weltbank und der Ausschuss für Entwicklungshilfe (DAC) der OECD legen fest, wer für sie als Entwicklungsland gilt. Es gibt keine einheitliche Liste, was zu unterschiedlichen Einstufungen führen kann.
Welche Indikatoren werden zur Einteilung in Entwicklungs- und Industrieländer verwendet, und welche Kritik wird daran geübt?
Die Arbeit nennt wirtschaftliche, soziale und politische Indikatoren. Zu den wirtschaftlichen gehören landwirtschaftliche Produktion, Energieverbrauch, Exporte und Bruttosozialprodukt (BSP). Zu den sozialen gehören Alphabetisierung, Lebenserwartung und Wohnbedingungen. Zu den politischen gehören Pressefreiheit und der Grad der Wettbewerbsfähigkeit politischer Organisationen. Kritisiert wird, dass diese Indikatoren oft eurozentristisch sind, soziale Unterschiede verdecken und die ökologischen Aspekte vernachlässigen.
Welche Beispiele für die Auswirkungen des Kolonialismus werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit nennt Beispiele aus Indien (Zerstörung der einheimischen Industrie), Algerien (Umwandlung von Grünland in Steppe durch Monokulturen), Senegal (Spaltung der Gesellschaft durch Vergabe der französischen Staatsbürgerschaft an eine Elite), Tunesien (Unterdrückung der arabischen Sprache im Bildungssystem) und Marokko (Ausnutzung ethnischer Spannungen). Diese Beispiele sollen zeigen, wie der Kolonialismus die Entwicklung der betroffenen Länder langfristig beeinträchtigt hat.
Was ist die Hauptaussage zum Thema "Europäische Schuld"?
Die Arbeit argumentiert, dass Europa eine historische Verantwortung für die Situation der Entwicklungsländer trägt, die aus der Kolonialzeit resultiert. Sie kritisiert, dass diese Verantwortung oft vergessen wird und dass moderne Formen des Kolonialismus, wie z.B. bestimmte Arten der "Internationalen Entwicklungszusammenarbeit", weiterhin bestehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit betont, dass eine Verbesserung der Situation in den Entwicklungsländern in den Köpfen beginnen muss, sowohl in Europa und den USA als auch in den Entwicklungsländern selbst. Es bedarf einer Änderung der Sichtweise, der Einstellung gegenüber den "Entwicklungsländern" und einer Besinnung auf das Gemeinsame nach Innen, um eine gleichberechtigte Partnerschaft zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Harald Lothaller (Autor:in), 2000, "Entwicklungsland - was ist denn das?", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98606