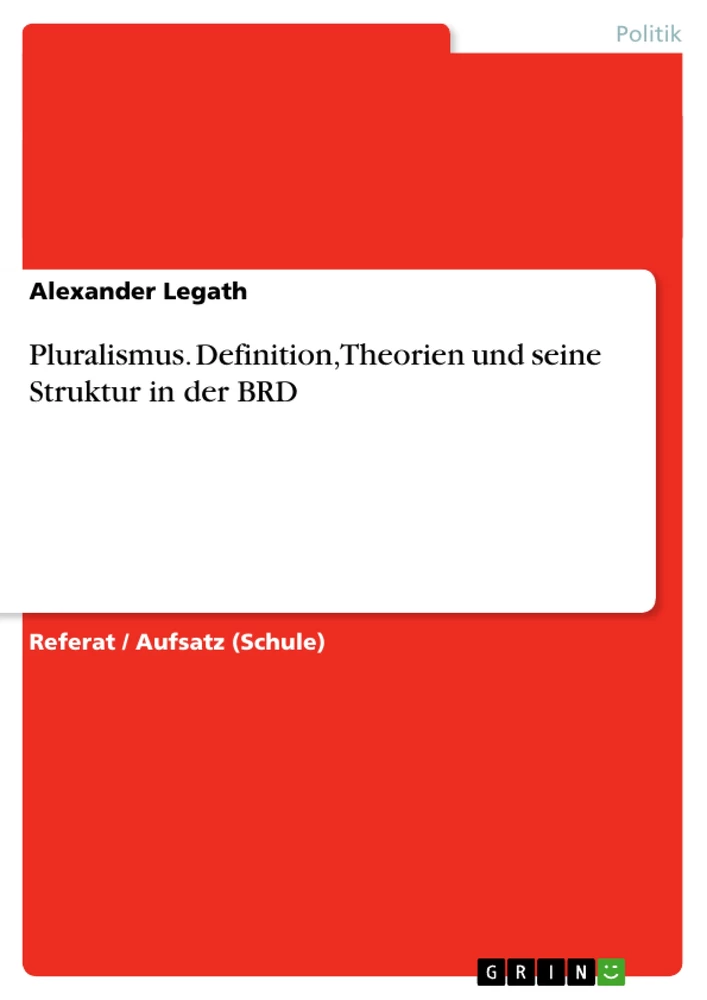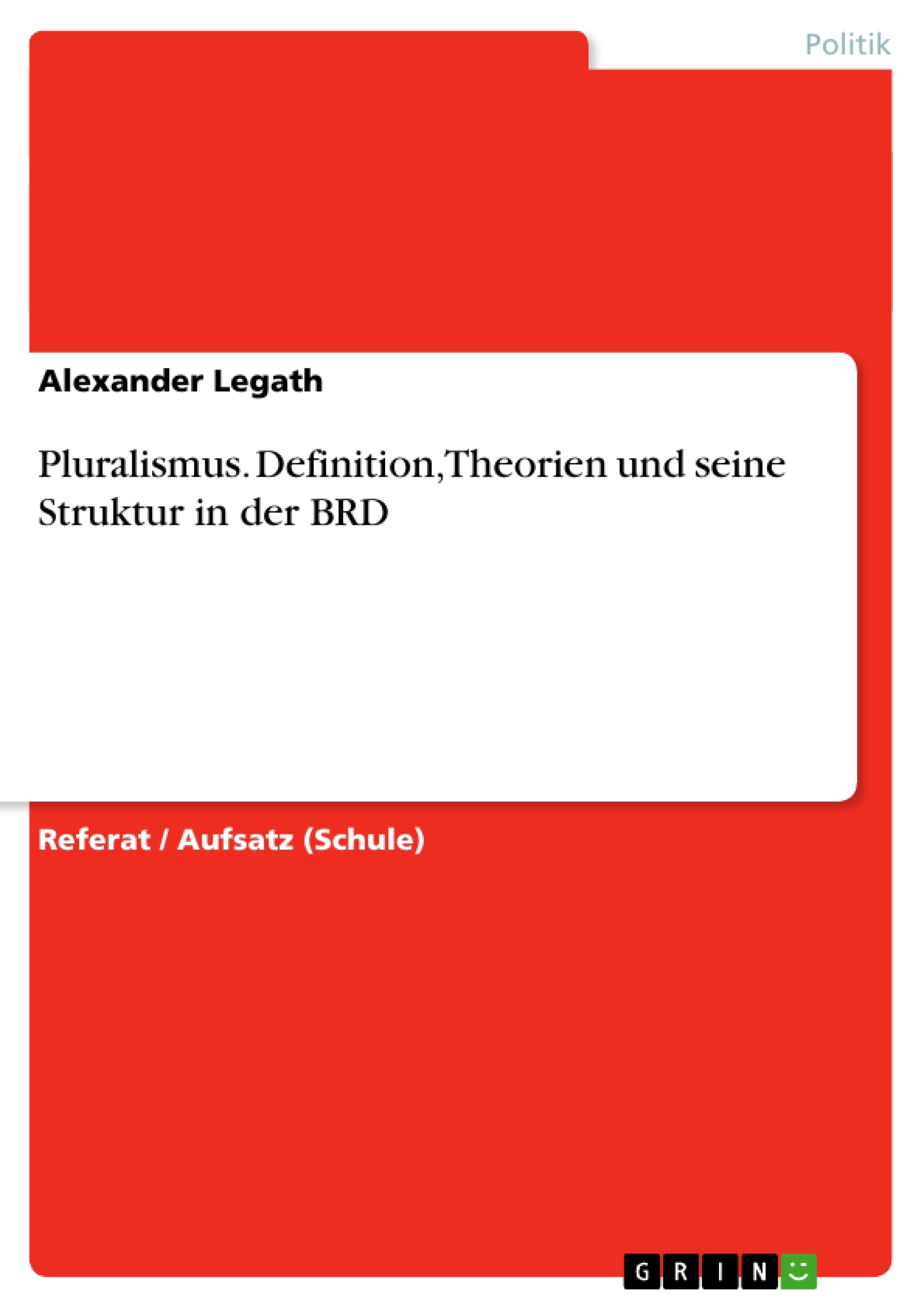In einer Welt, die von konkurrierenden Ideologien und Interessen geprägt ist, stellt sich die Frage: Wie kann ein stabiles und gerechtes politisches System entstehen? Dieses Buch analysiert das Konzept des Pluralismus, die vielschichtige Konkurrenz gesellschaftlicher Gruppen um Macht und Einfluss, und untersucht dessen Voraussetzungen, Kennzeichen und unterschiedlichen Ausprägungen. Von den ideologischen Wurzeln in den USA bis hin zum Neopluralismus in der BRD werden verschiedene Theorien beleuchtet und kritisch hinterfragt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Frage gelegt, wie unterschiedliche Interessen, insbesondere die von Minderheiten und schwächeren gesellschaftlichen Gruppen, im politischen Prozess Berücksichtigung finden können. Die Analyse der pluralistischen Strukturen in der BRD, unter Berücksichtigung der Verfassungsgrundlagen, der Rolle von Verbänden, Medien und Parteien, zeigt die Chancen und Herausforderungen einer offenen und konkurrenzorientierten Willensbildung. Das Buch beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz und bietet so einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise und die normativen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft. Es wird untersucht, wie sich ein Gemeinwesen entwickelt, wenn es nicht von einem einheitlichen Volkswillen, sondern von der Auseinandersetzung unterschiedlicher Standpunkte ausgeht. Das Buch stellt die Frage, inwiefern ein solches System tatsächlich die Interessen aller Bürger vertreten kann oder ob es zu einer Verzerrung der Machtverhältnisse kommt. Es wird die Bedeutung von Konsens und Dissens im politischen Prozess erörtert und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Basis für einen funktionierenden Pluralismus herausgearbeitet. Abschließend werden die Grenzen des Pluralismus aufgezeigt und die Frage aufgeworfen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit er zu einer gerechten und inklusiven Gesellschaft führen kann. Die Leser erwartet eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und den praktischen Herausforderungen des Pluralismus in modernen Demokratien, sowie eine kritische Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen politischer Teilhabe und Interessensvertretung.
1. Grundlagen
1.1 Definition
Im Pluralismus konkurrieren eine Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen mit- und gegeneinander um gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Macht. Sie versuchen ihren Einflußin den politischen Prozeßeinzubringen und auf die staatliche Gewalt durchzusetzen. Handwörterbuch des politischen Systems
1.2 Entstehung
Herausbildung des Pluralismus, vor allem im 20. Jahrhundert, durch:
- Ablösung des einheitlichen, christlich geprägten Weltbildes durch eine Vielfalt von weltanschaulichen Positionen
- Auflösung der Ständegesellschaft und Entstehung vieler neuer Interessensgruppen, die versuchen auf die staatliche Gewalt einzuwirken
- zunehmend sozialstaatliche Tendenz, die zur Folge hat, daß der Staat mehr und mehr auch über gesellschaftliche Konflikte entscheidet
1.3 Voraussetzungen für funktionierenden Pluralismus:
- Möglichkeit der Organisation von Interessen durch Bildung von Parteien und Verbänden
- Möglichkeit für gesellschaftliche Gruppen und Organisationen Einfluß auf die Staatsgewalt zu nehmen
- gegenseitige Machtbegrenzung und Kontrolle zwischen den einzelnen Gruppen; einer Organisation soll immer eine gleich machtvolle gegenüberstehen
- allgemeine Akzeptanz des vom Staat vorgegebenen Ordnungskonzepts, daß die Regeln für die Konfliktaustragung vorgibt
- rechtlicher Schutz und Gleichbehandlung der Opposition
1.4 Kennzeichen
- kein einheitliches Weltbild, sondern Legitimität einer Vielzahl verschiedener Auffassungen
- Spannungsfeld zwischen Konflikt und Konsens è das Ideal ist nicht der einheitliche Volkswille, sondern die Konkurrenz um Einfluß
- das Gemeinwohl wird nicht als feste Größe begriffen, sondern kann durch unterschiedliche Gruppen unterschiedlich gefüllt werden è Pluralismus als Gegenentwurf zum Totalitarismus, der von einer homogenen Interessenlandschaft ausgeht
2. Verschiedene Pluralismustheorien
2.1 Pluralismus in den USA
- Demokratievorstellung der Gründungsväter auf größtmögliche Konkurrenz ausgerichtet
- Geordnete Entfaltung der Konflikte in einem Netz sich gegenseitig kontrollierender Organe è ständiger Wettstreit der sozialen Gruppen mit dem Ziel eines Kräftegleichgewichts
Kritik:
- Interessen von Randgruppen werden nur mangelhaft vertreten oder bleiben völlig außen vor
- Gleichgewicht liegt weit auf Seiten privilegierter Schichten
- System neigt zur Stagnation; Beibehaltung des status quo einfacher als Veränderung
2.2 Pluralismus in der BRD; Neopluralismus
Entstehung:
- Entstehungszeit: 50er und 60er Jahre; Wortführer: Ernst Fraenkel
- Fraenkel: Sozialist und Politikwissenschaftler; mußte 1938 Deutschland verlassen und lebte in den USA è Verknüpfung der amerikanischen Idee des Pluralismus mit seiner sozialistischen Überzeugung unter Berücksichtigung der Kritik am amerikanischen System
Theorie:
- Unterscheidung einer notwendigen und unstreitigen Basis(Konsens) und dem streitigem Bereich(Dissens)
- Konsensbasis: Grund- und Menschenrechte; rechtsstaatlich gesicherte Verfahrensregeln
- Dissens: bestehende Gegensätze sollen aufgedeckt werden und sich frei entfalten können; dadurch erfolgt die Bildung des Staatswillens
- aber: Minimum an Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Gruppen muß vorhanden sein, um einen Kompromiß zu erreichen
Fazit:
- je stabiler die Konsensbasis ist, desto offener kann die Konfliktaustragung stattfinden
- das Gemeinwohl ergibt sich erst durch den politischen Prozeß, vorausgesetzt, daß die rechtlichen Grundlagen von allen Seiten akzeptiert werden
2.3 Kritik an diesen Theorien
- schwache Interessen kaum vertretbar, weil schlecht zu organisieren (Kinder, geistig Behinderte)
- langfristige Interessen finden gegenüber kurzfristigen kaum Gehör (Umweltschutz - Arbeitsmarkt)
- neue Interessen gewinnen nur sehr schwer an Einfluß
- allgemeine Interessen, die jeder hat, lassen sich nur schwer vertreten (Verbraucherinteresse)
➔ nicht alle Interessen werden vertreten, weil:
- nicht alle Interessen organisierbar sind
- nicht alle organisierbaren Interessen konfliktfähig sind
- nicht alle konfliktfähigen Interessen gleich einflußreich und mächtig sind
2.4 Gruppen- und Klassenverständnis aus Sicht der ehemaligen DDR
- keine eigentlichen Interessensgruppen, sondern Unterscheidung in verschiedene Klassen
- Klassen: führende Arbeiterklasse, Genossenschaftsbauern, Genossenschaftshandwerker, sozialistische Intelligenz
- jede Klasse ist geprägt durch ein bestimmtes Gruppeninteresse, Einzelinteressen sind nicht existent
- alle Klassen kooperieren zur Schaffung des Sozialismus
- Ziel: Kommunismus mit Nivellierung aller Klassenunterschiede
3. pluralistische Struktur in der BRD
3.1 Aktivrechte in der Verfassung
- Pluralismus ist im Grundgesetz nicht wörtlich erwähnt, kann aber aus verschiedenen
Artikeln abgeleitet werden:
Möglichkeit der Organisation von Interessen:
- Art. 9 GG: Vereinigungsfreiheit
- Art. 21 GG: Bildung von Parteien
Ermöglichung der Meinungsbildung und Mitwirkung:
- Art. 5 GG: Recht der freien Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
- Art. 8 GG: Versammlungsfreiheit
- Art. 17 GG: Petitionsrecht
- Art. 38 GG: Wahlrecht
3.2 offene und konkurrenzorientierte Willensbildung
Verbände:
- Vielzahl von Verbänden mit verschiedenen Ausrichtungen und Interessen
- in erster Linie nicht politischer Natur, sondern Regelung der Angelegenheiten der Mitglieder untereinander
- Vermittlung der Mitgliederinteressen gegenüber anderen Vereinigungen è Konkurrenz und Diskussion zwischen verschiedenen Vereinigungen
- Mittel zur Durchsetzung:
- Weg über die Massenmedien; Ausübung von Druck auf verschiedene Institutionen è pressure groups
- Unterstützung von Parteien durch Stellen von Fachleuten und finanzielle Unterstützung
Medien:
- wichtig: unabhängige, nicht vom Staat gelenkte und regelmäßig erscheinende politische Presse
- Medien, vor allem Presse, halten die ständige Diskussion in Gang è umfassende Information; Orientierung für die Bürger
- Organisation nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen führt zu geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz è Gewährleistung einer Vielzahl unterschiedlicher Standpunkte und Anschauungen
- Gefahr: zunehmend konzernartige Zusammenballung von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften kann zur Verengung der Interessenslandschaft und zur Manipulation der Konsumenten führen
Parteien:
- Parteien haben Vorrangstellung bei der Willensbildung
- Aufgabe: Heranführung des Bürgers an die politische Gesellschaft; Bekämpfung politischer Unwissenheit
- in Deutschland konkurrieren eine Vielzahl von Parteien um politischen Einfluß (vor der Bundestagswahl 1994: über 70 registrierte Parteien)
- alle Parteien haben ihr eigenes Programm, das sie in die Gesetzgebung einzubringen versuchen
3.3 Mehrheitsprinzip
- freie politische Willensbildung beruht in erster Linie auf Einigung
- aber: Einigung enthält immer nur das Minimum, das von beiden Konfliktparteien akzeptiert wird; Gefahr zu keiner problemlösenden Sachentscheidung zu gelangen è Entscheidung der Mehrheit
- Begründung: zur Gewinnung der Mehrheit muß bereits eine Einigung und Zusammenfassung von verschiedenen Einzelinteressen zu einem gemeinsamen Konzept stattgefunden haben
- im modernen Staat: politische Führung soll dem Volk nicht aufgezwungen sein è Notwendigkeit ständiger und regelmäßiger Legitimation der Führung durch Wahlen
3.4 Minderheitenschutz
- Legitimation der Regierung durch die Mehrheit bedeutet aber nicht, daß für die Minderheiten kein Platz ist oder das diese schutzlos der Mehrheit ausgeliefert sind
- das Grundgesetz betrachtet Minderheiten nicht als einen Irrtum über das Richtige è Sicherung der Konfliktaustragung durch Sicherung der Position von Minderheiten
- Maßnahmen:
- rechtliche Gleichstellung; Möglichkeit für die Opposition selbst einmal an die Macht zu kommen
- besonderer Schutz solcher Minderheiten, die keine Aussicht darauf haben, jemals zur Mehrheit zu werden oder keine Mehrheit anstreben
Literaturverzeichnis:
Gahlmann: Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland;
Bayrischer Schulbuchverlag; München 1980: S. 90/91
Andersen, Woyke: Handwörterbuch des politischen Systems der BRD; 3. Auflage
Handwerger, Kappl, Schneider:Der politische Prozeß
C.C. Buchners Verlag; Bamberg 1981: S.16/17
Sutor: Grundfragen politischer Ordnung
Blutenberg-Verlag; München 1985: S. 83-87
Blumöhr, Handwerger,
Hümmrich-Welt, Kappl, Wölfl: Staatsformen der Gegenwart
C.C. Buchners Verlag; Bamberg 1997: S. 113/114
Hartwich, Grasser, Horn,
Scheffler: Politik im 20. Jahrhundert
Häufig gestellte Fragen
Was ist Pluralismus laut dieser Quelle?
Pluralismus bedeutet, dass eine Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen miteinander und gegeneinander um gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Macht konkurrieren. Sie versuchen, ihren Einfluss in den politischen Prozess einzubringen und auf die staatliche Gewalt durchzusetzen.
Wie ist Pluralismus entstanden?
Die Herausbildung des Pluralismus erfolgte vor allem im 20. Jahrhundert durch die Ablösung des einheitlichen, christlich geprägten Weltbildes durch eine Vielfalt von weltanschaulichen Positionen, die Auflösung der Ständegesellschaft und die Entstehung vieler neuer Interessensgruppen sowie die zunehmend sozialstaatliche Tendenz.
Welche Voraussetzungen gibt es für einen funktionierenden Pluralismus?
Zu den Voraussetzungen gehören die Möglichkeit der Organisation von Interessen durch Bildung von Parteien und Verbänden, die Möglichkeit für gesellschaftliche Gruppen und Organisationen, Einfluss auf die Staatsgewalt zu nehmen, gegenseitige Machtbegrenzung und Kontrolle zwischen den einzelnen Gruppen, die allgemeine Akzeptanz des vom Staat vorgegebenen Ordnungskonzepts und der rechtliche Schutz und die Gleichbehandlung der Opposition.
Welche Kennzeichen hat Pluralismus?
Pluralismus zeichnet sich durch kein einheitliches Weltbild, sondern die Legitimität einer Vielzahl verschiedener Auffassungen aus. Es besteht ein Spannungsfeld zwischen Konflikt und Konsens. Das Gemeinwohl wird nicht als feste Größe begriffen, sondern kann durch unterschiedliche Gruppen unterschiedlich gefüllt werden.
Wie wird Pluralismus in den USA gesehen?
Die Demokratievorstellung der Gründungsväter ist auf größtmögliche Konkurrenz ausgerichtet. Es gibt eine geordnete Entfaltung der Konflikte in einem Netz sich gegenseitig kontrollierender Organe, was zu einem ständigen Wettstreit der sozialen Gruppen mit dem Ziel eines Kräftegleichgewichts führt.
Was ist Neopluralismus in der BRD?
Der Neopluralismus entstand in den 50er und 60er Jahren unter der Führung von Ernst Fraenkel, der die amerikanische Idee des Pluralismus mit seiner sozialistischen Überzeugung verknüpfte. Er unterscheidet eine notwendige und unstreitige Basis (Konsens) von einem streitigen Bereich (Dissens).
Was ist die Konsensbasis im Neopluralismus?
Die Konsensbasis umfasst Grund- und Menschenrechte sowie rechtsstaatlich gesicherte Verfahrensregeln.
Was ist der Dissens im Neopluralismus?
Der Dissens bezieht sich auf bestehende Gegensätze, die aufgedeckt werden und sich frei entfalten sollen. Dadurch erfolgt die Bildung des Staatswillens. Ein Minimum an Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Gruppen muss vorhanden sein, um einen Kompromiss zu erreichen.
Welche Kritik gibt es an Pluralismustheorien?
Schwache Interessen sind kaum vertretbar, weil sie schlecht zu organisieren sind (Kinder, geistig Behinderte). Langfristige Interessen finden gegenüber kurzfristigen kaum Gehör (Umweltschutz - Arbeitsmarkt). Neue Interessen gewinnen nur sehr schwer an Einfluss. Allgemeine Interessen, die jeder hat, lassen sich nur schwer vertreten (Verbraucherinteresse).
Wie sah das Gruppen- und Klassenverständnis in der ehemaligen DDR aus?
Es gab keine eigentlichen Interessensgruppen, sondern eine Unterscheidung in verschiedene Klassen (führende Arbeiterklasse, Genossenschaftsbauern, Genossenschaftshandwerker, sozialistische Intelligenz). Jede Klasse ist durch ein bestimmtes Gruppeninteresse geprägt. Alle Klassen kooperieren zur Schaffung des Sozialismus, mit dem Ziel eines Kommunismus mit Nivellierung aller Klassenunterschiede.
Welche Aktivrechte in der Verfassung unterstützen Pluralismus in der BRD?
Art. 9 GG (Vereinigungsfreiheit), Art. 21 GG (Bildung von Parteien), Art. 5 GG (Recht der freien Meinungsäußerung und Informationsfreiheit), Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit), Art. 17 GG (Petitionsrecht), Art. 38 GG (Wahlrecht).
Wie funktioniert die offene und konkurrenzorientierte Willensbildung in der BRD?
Durch eine Vielzahl von Verbänden mit verschiedenen Ausrichtungen und Interessen, unabhängige Medien (vor allem Presse) und eine Vielzahl konkurrierender Parteien.
Welche Rolle spielen Verbände?
Verbände regeln in erster Linie die Angelegenheiten der Mitglieder untereinander und vermitteln die Mitgliederinteressen gegenüber anderen Vereinigungen. Sie üben Druck auf verschiedene Institutionen aus und unterstützen Parteien durch Fachleute und finanzielle Unterstützung.
Welche Rolle spielen Medien?
Unabhängige Medien halten die ständige Diskussion in Gang, informieren umfassend und bieten Orientierung für die Bürger. Die Organisation nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen führt zu geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz.
Welche Rolle spielen Parteien?
Parteien haben eine Vorrangstellung bei der Willensbildung und führen den Bürger an die politische Gesellschaft heran. Sie konkurrieren um politischen Einfluss und versuchen, ihr eigenes Programm in die Gesetzgebung einzubringen.
Was bedeutet Mehrheitsprinzip?
Die freie politische Willensbildung beruht auf Einigung, die aber oft nur das Minimum enthält. Daher entscheidet die Mehrheit. Die Gewinnung der Mehrheit erfordert die Zusammenfassung von verschiedenen Einzelinteressen zu einem gemeinsamen Konzept.
Was bedeutet Minderheitenschutz?
Das Grundgesetz betrachtet Minderheiten nicht als Irrtum und sichert die Konfliktaustragung durch Sicherung der Position von Minderheiten. Es gibt rechtliche Gleichstellung und die Möglichkeit für die Opposition, selbst einmal an die Macht zu kommen. Besonderer Schutz gilt solchen Minderheiten, die keine Aussicht darauf haben, jemals zur Mehrheit zu werden oder keine Mehrheit anstreben.
- Quote paper
- Alexander Legath (Author), 2000, Pluralismus. Definition, Theorien und seine Struktur in der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98588