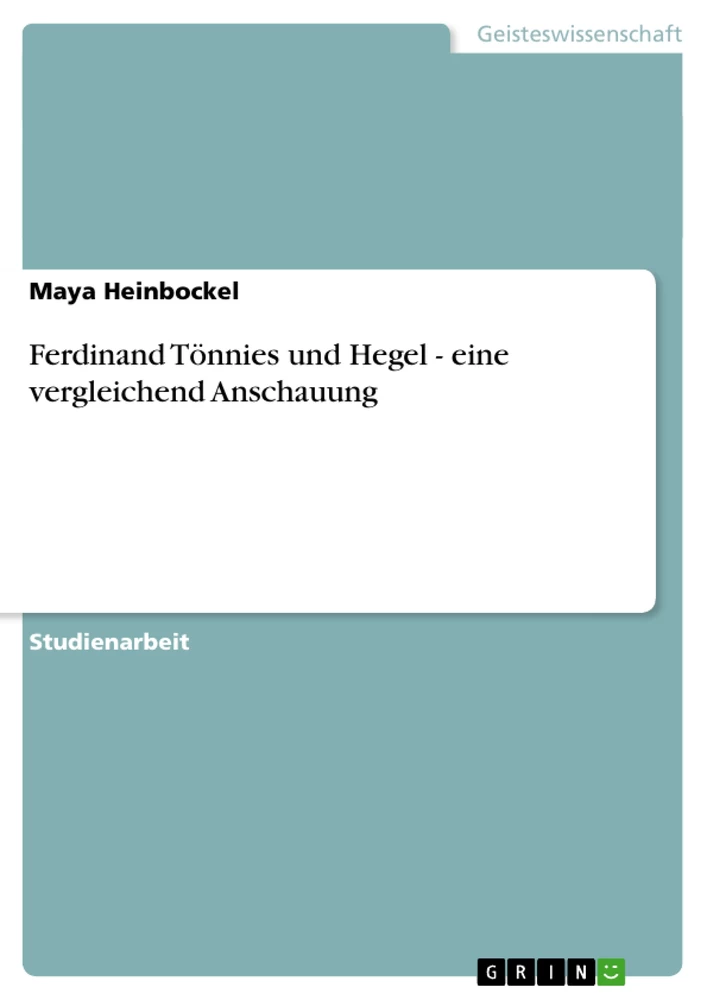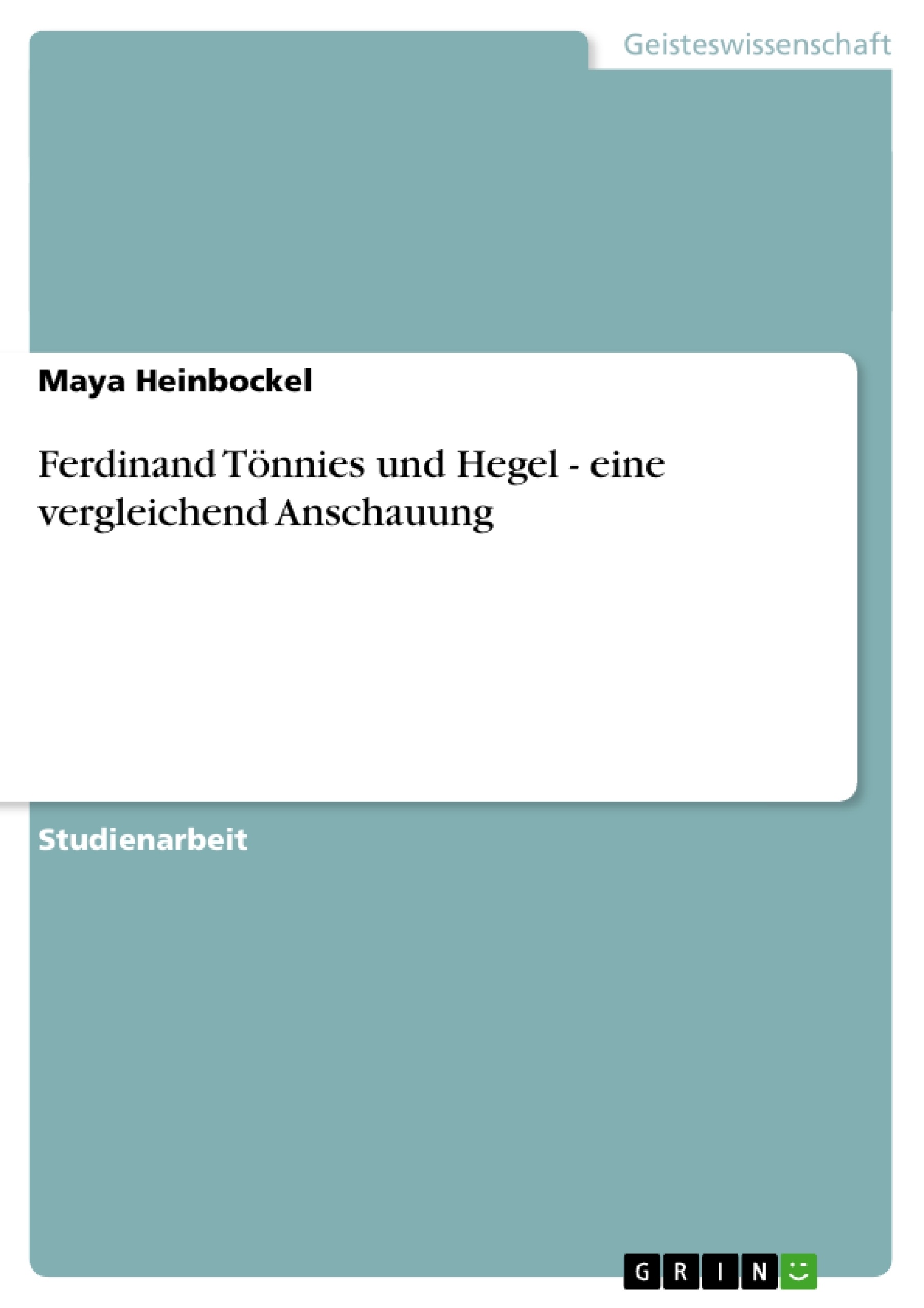Was hält unsere Gesellschaft im Innersten zusammen? Diese Frage durchzieht die Analyse der Werke von Ferdinand Tönnies und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, zwei Denkern, die auf unterschiedliche Weise die Fundamente menschlicher Beziehungen zu ergründen suchten. Diese vergleichende Studie enthüllt faszinierende Parallelen und entscheidende Differenzen in ihren Konzeptionen von Gemeinschaft, Gesellschaft, Sittlichkeit und sozialem Handeln. Während Tönnies mit seinen idealtypischen Begriffen von "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" die Dichotomie zwischen traditionellen, organisch gewachsenen Sozialstrukturen und modernen, zweckrationalen Verhältnissen betont, entwirft Hegel eineDialektik von Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staat, in der sich der Geist zur Freiheit entfaltet. Der Leser wird auf eine spannende Reise durch die sozialphilosophischen Überlegungen beider Geister mitgenommen, wobei besonders auf die Begriffe "sozial" und "sittlich" eingegangen wird, um die subtilen Nuancen ihrer jeweiligen Gesellschaftsanalysen herauszuarbeiten. Dabei werden die unterschiedlichen Bewertungen von Staat und Individuum ebenso beleuchtet wie die Rolle vonWillen, Gewohnheit und Vernunft in der Gestaltung sozialer Beziehungen. Diese Untersuchung bietet einen tiefgreifenden Einblick in die Grundlagen der Soziologie und Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts und regt dazu an, über die gegenwärtigen Herausforderungen des Zusammenlebens in einer zunehmend komplexen Welt nachzudenken. Entdecken Sie, wie Tönnies' nüchterne Analyse der modernen Gesellschaft und Hegels idealistischer Staatsbegriff bis heute unser Verständnis von sozialer Ordnung und individuellem Handeln prägen. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Sozialphilosophie,Soziologie, politische Theorie und die Geschichte des sozialen Denkens interessieren. Lassen Sie sich von den brillanten Einsichten von Tönnies und Hegel inspirieren und gewinnen Sie neue Perspektiven auf die wesentlichen Fragen unserer Zeit.
INHALT
1 Einleitung
2 Ferdinand Tönnies
2.1 Werdegang
2.2 Der Begriff des Sozialen
2.3 Gemeinschaft und Gesellschaft
3 Hegel
3.1 Werdegang
3.2 Hegels Sittlichkeit
3.3 Die drei Begriffe Hegels
4 Vergleich ausgewählter Aspekte von Tönnies und hegel
4.1 Sittliches Verhältnis und soziales Verhältnis
4.2 Vergleich der Gesellschafts/ Gemeinschaftsbegriffe
5 Resümee
6 Literatur
1 EINLEITUNG
Die historische Bearbeitung der Philosophie war für Ferdinand Tönnies zeit seines Lebens eine ernsthafte wissenschaftliche Aufgabe. Besonders die anerkannten philosophischen Auslegungen zu Hobbes machten ihn bekannt. Auch Nietzsche unterzog er kritischen Studien und über Karl Marx verfasste er eine Monographie und mehrere Abhandlungen - bedeutend auch in dem Vergleich von Spinoza und Marx.
Auch mit Hegel hat Tönnies sich wiederholt auseinandergesetzt. In seinen Werken finden sich mehrere Äußerungen zu Hegels Philosophie und besonders in 2 Werken beschäftigt er sich ausschließlich kritisch mit Hegels Theorien. So veröffentlichet er 1894 den Aufsatz „Neuere Philosophie der Geschichte: Hegel, Marx, Comte“ und zum 100jährigen Todestag Hegels schrieb er 1932 „Hegels Naturrecht“. Tönnies wollte daß „wir Hegel richtig verstehen und aus seinen Bedingungen erklären“1
Ausgehend von diesen Studien habe ich mich in Anlehnung an das Seminar „Tönnies - Gemeinschaft und Gesellschaft“ näher mit dem Vergleich des Philosophen Hegel und des Soziologen Tönnies beschäftigt.
In meinem Aufsatz möchte ich nun die Parallelen zwischen Tönnies´ und Hegels Anschauungen darstellen und gehe dabei bewußt besonders auf die Begriffe „sozial“ und „sittlich“ ein, da sich hier die deutlichsten Ähnlichkeiten zeigen.
2 FERDINAND TÖNNIES
2.1 Werdegang
Ferdinand Tönnies wurde am 26.7. 1855 in Riep (Kirchspiel Oldenswort bei Eiderstedt) geboren. Bereits mit 16 Jahren kam Tönnies auf die Universität. Nach dem Studium der Philologie, Archäologie, Geschichte und Philosophie in Jena, Leipzig, Bonn, Berlin und Tübingen, habilitierte er sich 1881 mit Studien über Hobbes und einem Entwurf von »Gemeinschaft und Gesellschaft. Theorien der Kulturphilosophie« bei Benno Erdmann in Kiel. Nach 1883 reiste Tönnies u.a. in die USA und hielt Vorträge.
Seit 1909 lehrte er in Kiel zunächst als außerordentlicher Professor, ab 1913 als Ordinarius wirtschaftliche Staatswissenschaften (Nationalökonomie und Statistik). Auf eigenen Wunsch hin wurde er 1916 von diesen Verpflichtungen entbunden. 1920 nahm er einen Lehrauftrag für Soziologie an. Ein Jahr später erhielt er die juristische Ehrendoktorwürde der Universität Hamburg; Bonn verlieh ihm 1927 den Dr. rer. pol. h.c. Als Mitglied zahlreicher internationa- ler soziologischer Gesellschaften und Institute erfuhr T. große Wertschätzung. 1933 entließen ihn die Nationalsozialisten und er mußte nach 22 Jahren den Vorsitz der von ihm mitbegrün- deten »Deutschen Gesellschaft für Soziologie« niederlegen. Ohne Pension verbrachte T., der seit 1930 Mitglied der SPD war, die letzten Lebensjahre. Er starb im Alter von 81 Jahren am 11.4. 1936 in Kiel.
Tönnies war der Begründer einer eigenständigen Soziologie in Deutschland. In verschiedenen Werken, aber insbesondere durch seinen Erstling »Gemeinschaft und Gesellschaft«, formu- lierte Tönnies Grundlagen einer einzel-wissenschaftlichen Soziologie. So trennte er etwa die allgemeine von der speziellen Soziologie, letztere unterteilte er nochmals in eine reine, ange- wandte und empirische Soziologie. Zunächst wenig beachtet wurde ab der zweiten Auflage 1912 »Gemeinschaft und Gesellschaft« zum Standardwerk der neuen Disziplin. F. Tönnies entwickelt die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft als Grundkategorien der reinen Sozio- logie, die im Folgenden näher erklärt werden. Mit Hilfe dieser idealtypischen Unterscheidung lassen sich Strukturen analysieren. Tönnies untersuchte - entsprechend dem Untertitel der zweiten Auflage - Kommunismus und Sozialismus als empirische Kulturformen. Bedeutend bleiben auch T.' Ansätze zur Untersuchung der »öffentlichen Meinung«. In der Gesellschaft übernimmt sie die Funktion, die die Religion für die Gemeinschaft besitzt. Ebenso wie andere Elemente der Tönnies´schen Denkweise wurde diese Auffassung von nachfolgenden Soziolo- gen kritisch weiterentwickelt.
2.2 Der Begriff des Sozialen
Tönnies sagt, die Soziologie sei die Lehre vom Sozialen.
Bei einer Begegnung zwischen Personen treffen die einzelnen Willen aufeinender. Wenn sie sich zusammentun bildet sich ein hyperorganischer Körper / eine Sozialität in der ein gemein- schaftlicher Wille herrscht; der Einzelwille ist eingebettet in einen sozialen Willenskörper. Der Wille ist in hohem Maße am Entstehen so einer Figur beteiliget; man muß eine Verbin- dung wollen. So will in einer Ehe -der eine Partner beim anderen bleiben, obwohl ihn einiges stört, weil er sich dazugehörig fühlt zu der Familie und die Zusammengehörigkeit nicht auf- lösen will.
Eine Beziehung zwischen Personen fängt an die Beteiligten „in die Pflicht zu nehmen“ und die Menschen werden „entpersonalisiert“ weil sie sich dem Ganzen unterworfen fühlen. Bei Simmel würde dies „Vergesellschaftung“ heißen.
Eine Verbindung in der sich Individuen gegenüber stehen wird in Tönnies´ Sinne als soziale Verbindung empfunden, wenn diese Individuen förderlich miteinander in Beziehung treten. „wir wollen das Soziale immer dann, wenn wir uns gegenseitig bejahen, wenn wir uns för- dern...“2 „Soziales Wollen heißt also, sich wechselseitig helfen, fördern, erleichtern...“3 Der Begriff „sozial“ wird bei Tönnies weit gefaßt. Selbst der Aufseher in einem Konzentrationsla- ger kann als sozial bezeichnet werden, da die förderliche Energie nicht zwingend auf etwas „Gutes“ bezogen sein muß4. Auch zeitlich ist eine soziale Beziehung nicht eingeschränkt; wenn zwei Menschen einen One-night-Stand haben, ist trotzdem ein Sozialverhältnis vorhan- den. Sozial ist eine Beziehung, wenn beide sie als förderlich empfinden, egal, ob es für eine Nacht besteht oder über Jahrhunderte wie bei Völkern. Wie sozial eine Beziehung ist wird meßbar durch den Grad an förderlichem Willen, den sie in sich hat.
Das Soziale teilt Tönnies wiederum in die Begrifft gesellschaftlich und gemeinschaftlich. In einer gesellschaftlichen Sozialität herrscht der vom Denken geführte Kürwille vor, die Verbindung kommt oft durch Vertrag zustande. In einer gemeinschaftlichen Sozialität beruht die Verbindung meißt auf Blut und wird vom Wesenwillen bestimmt. Eine gemeinschaftliche Verbindung entsteht automatisch oder schicksalhaft, wie durch Geburt. Im Leben besteht meist eine Mischung aus beidem.
Im Folgenden werde ich beide von Tönnies geprägten Begriffe näher erläutern.
2.3 Gemeinschaft und Gesellschaft
Tönnies prägte in seinem Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ zwei neue Begriffe die unterschiedlich stark soziale Energien enthalten.
In der Gemeinschaft bündeln sich menschliche Beziehungen um ihrer selbst willen (Familie, Nachbarschaft, Freundschaftsbeziehungen). Sie sind geprägt durch Zusammengehörigkeit und Solidarität, gegründet auf den sog. Wesenswillen.
Tönnies drückt dieses positive einender-fördern-wollen aus indem er sagt: „Wo immer Men- schen in organischer Weise durch ihre Willen miteinander verbunden sind und einander beja- hen, da ist Gemeinschaft von der einen oder der anderen Art vorhanden...“5. In der Gemein- schaft sind zwar alle Individuen mit eigenen Willen, jedoch verbindet sie trotz der empiri- schen Trennung eine vollkommene Einheit der Willen6. In der Gemeinschaft wird der indivi- duelle Wille zu Gunsten des gemeinsamen Willens zurückgesetzt. So kümmert sich die Mut- ter Tag und Nacht um ihr Kind, Mann und Frau bringen einander Opfer und Geschwister lie- ben und beschützen einander. Ein Faktor in der Gemeinschaft ist die Gewohnheit - das „Wohnzimmer der Seelen“. Identitätsmerkmale in der Gemeinschaft sind vor allem gemein- same Bräuche und die Gemeinsame Sprache. Tönnies benennt: die Gemeinsamkeit des Blutes (Geschwister, Mutter+Kind), des Ortes (Hamburg, Deutschland) und die des Geistes (Religi- on, Verein). In allen diesen Soziologien wird eine substanzielle Einheit dadurch gebildet, daß Individuen sich zusammenschließen und sich als Einheit präsentieren. So ist Jesus allein noch keine Religionsgemeinschaft; erst wenn einer ihm folgt und sagt „Du bist der Messias“ ent- steht eine Sozialität/ ein soziales System.
Diesen vitalen Prozessen der Gemeinschaft steht die Gesellschaft gegenüber, geprägt durch die Trennung von Zweck und Mittel, beruhend auf Kalkül und Rationalität und letztlich bezo- gen auf Interesse wie Nutzen des Individuums. Ihr liegt der sog. Kürwille zugrunde. Der Kürwille ist vom Denken geleitet, hier ist der Wille Ergebnis eines Beschlusses; dagegen ist der Wesenwille vom Denken begleitet indem man z.B. denkte, daß etwas oder jemand „schön ist“. „Der Wesenwille ist das Prinzip der Einheit des Lebens, das das Denken mitumfaßt; der Kürwille ist ein Gebilde des Denkens selbst, ist eigentlich Denken, in dem der Wille enthalten ist“7. So beruht der Wesenwille auf Vergangenheit im Keime und der Kürwille ist auf die Zu- kunft gerichtet - man hat erst das Zeil und ordnet die Mittel dann unter.
„Die Theorie der Gesellschaft konstruiert einen Kreis von Menschen, welche, wie in der Gemeinschaft, auf friedliche Art nebeneinander leben und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden, sondern wesentlich getrennt sind, und während dort verbunden bleibend trotz aller Trennungen, hier getrennt bleiben trotz aller Verbundenheit.“8 Dieses Zitat von Tönnies umschreibt gut den Grundgedanken der Gesellschaft. In der Gesellschaft ist jeder für sich und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Im Gegensatz zur Gemeinschaft wird der Mensch hier nur etwas tun, wenn er eine mindestens genauso gute Gegenleistung erwartet.
3 HEGEL
3.1 Werdegang
Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27.8.1770 in Stuttgart geboren und stammt aus einer alten Thoelogen- und Beamtenfamilie. Er besuchte die Deutsche und Lateinische Schule in Stuttgart bevor er auf das Gymnasium illustre wechselte, das er 1788 nach der Matura mit hervorragenden Leistungen verleiß. Danach studierte er Theologie im Tübinger Stift als her- zoglicher Stipendiat. Nach seinem Studium arbeitete erst in Bern, dann in Frankfurt als Haus- lehrer und Habilitierte 1801 dank der Freundschaft zu Schelling an der Universität Jena. 1805 wurde Hegel in Jena zum a.o. Professor für Philosophie ernannt, mußte Jena aber schon 1807 aufgrund der Kriegsereignisse wieder verlassen. Hegel arbeitete als Redakteur der „Bamber- ger Zeitung“ und wurde 1808 Rektor des Nürnberger Egidien-Gymnasiums. Als Fichtes Nachfolger lehrte er schließlich ab 1818 Philosophie am Lehrstuhl der Berliner Universität. Hegel starb in Berlin am 14.11.1831.
Hegel vollendete den deutschen Idealismus und schuf das umfassensteund einheitlichste Lehrgebäude der deutschen Philosophie. Für Hegel ist das Wesen der Welt die absolute Ver- nunft. Diese entfaltet sichin einem dialektischen Stufengang in der gesamten Welt. Die Ent- wicklungsgesetzeder Begriffe sind nach Hegel auch die der Wirklichkeit. Die Lehre der Ent- faltungdes absoluten Geistes in den geistigen Schöpfungen des Menschen führteHegel zu ei- ner tiefsinnigen Natur-, Religions-, Kunst-, Rechts- und Geschichtsphilosophie.Die Religion wurde von Hegel als vernünftig begründet und derPhilosophie untergeordnet.
3.2 Hegels Sittlichkeit
Hegel beschreibt die Sittlichkeit als „positive Verbundenheit von Personen“. Er meint „die Substantialität, das rein Sittliche, ist die Grundlage..., das Dasein, das anerkannt sein soll und in welchem die Individuen ihr Dasein haben, insofern sie die Wirklichkeit der allgemeinen Substanz sind.“9. Hegel sagt, die Sittlichkeit „selbst ist die Wahrheit, die Idee als der zur All- gemeinheit gereinigte freie Wille, welcher in der Gesinnung des subjektiven Willens seine Wirklichkeit...“10 hat. Allgemeinheit meint bei Hegel nicht den einzelnen subjektiven Willen, sondern den gemeinsamen Willen, der zum Guten für alle ist. Doch dieses „Gute muß durch das sittliche Subjekt verwirklicht werden“11, das meint, daß jeder die Gemeinschaft selbst wollen und fördern muß. Die höchste Sittlichkeit, die Angestrebt wird ergibt sich in einer Synthese von Recht und Moral. Die Trennung von Recht und Pflicht wird >>in dieser Identi- tät des allgemeinen und besonderen Willens<< aufgehoben, da sich das Individuum voll- kommen mit der Sitte, d.h. dem Geist seiner Familie und seines Volkes identifiziert (§§ 155, 156).
3.3 Die drei Begriffe Hegels
Hegel greift als erster in das soziale Leben und baut 3 Typen von Verbundenheit auf, strukturiert sie und setzt sie miteinander in Beziehung.
Die erste Form von sittlichem Zusammenleben ist bei Hegel die Familie. Dort hat „die Moral- theorie ihren natürlichen Ort“12 In der Familie ist die Sittlichkeit „schlafend“ vorhanden, oh- ne, daß sich die Individuen darüber bewußt sind. Hier gibt es keine kürwillige Entscheidung, man ist nur Ergebnis, nicht Entscheider. Die Familie ist eine empfindende Einheit, keine den- kende. Die in der Familie vorhandene unmittelbare Substanzialität macht deutlich, daß die Familie nicht über den Geist zustande kam sondern einfach existiert. In der Familie ist bei Hegel alles nur Empfindung ohne Entscheidung/ Verstand - der Staat ist für Hegel das Ziel: hier ist alles freie Entscheidung. Die Familie bedeutet bei Hegel das „an sich sein“.
Geht einer hinaus aus der Familie so geht er in die nächste Stufe, in die Bürgerliche Gesell- schaft (für sich sein).Sie folgt Vorstellungen des „rationalistischen Naturrechts“10. Der Mensch selbst ist das Ziel, alles andere ist Mittel zum Zweck. Diese Gesellschaft ist ein „Sys- tem der Willkür und des Egoismus“10, ein System allseitiger Abhängigkeit, in dem selbstsüchtige Zwecke verfolgt werden und doch das Allgemeine gefördert wir.
Hegel schließt die Grundlinien der Philosophie des Rechts mit seinen Betrachtungen über den Staat ab. Dies entspricht seiner Konzeption, vom Abstraktesten zum Konkretesten hin fortzu- schreiten. Für Hegel führt „das an und für sich seiende Allgemeine als absolute Pflicht in den Staat“13. Der Staat ist für Hegel „die Wirklichkeit der sittlichen Idee“14., hier kommt der Mensch zu Gehalt und Wahrheit. In der Familie unterwirft man sich unbewußt dem gemein- schaftlichen Willen, in der Bürgerlichen Gesellschaft ist jedem der eigene Wille das wichtigs- te, in Hegels Idealform des Staates unterwirft sich jeder freiwillig der Staatsgemeinschaft und stellt den Gemeinschaftswillen über seien individuellen und sogar über den Familienwillen. .„Ist so die Freiheit in der Allgemeinheit des Staates wirklich geworden, so kann die Freiheit des Individuums nur darin bestehen, seine „willkürliche“ Selbständigkeit in dieser Allge- meinheit aufzuheben; nur im Staate ist „die Selbständigkeit der Individuen vorhanden“15. So würde in Hegels Staat seine Mutter freiwillig ihr Kind anzeigen und ausliefern, weil es für den Staat/ für die Allgemeinheit das Beste ist, denn „das Individuum gehorcht den Gesetzen und weiss, dass es in diesem Gehorsam die Freiheit hat“16.
4 VERGLEICH AUSGEWÄHLTER ASPEKTE VON TÖNNIES UND HEGEL
4.1 Sittliches Verhältnis und soziales Verhältnis
Beide Tönnies wie Hegel, sehen das soziale Verhältnis von Personen in der gleichen positiven Art - genau wie Comte. Bei beiden ist das „sich förderlich aufeinander beziehen“ das Maß für Sozialität/ Sittlichkeit und der Grad wird an der Intensität der förderlichen Willen in der Be- ziehung gemessen. So wie man Tönnies entnehmen kann, daß das Soziale gewollt werden muß, sagt Hegel „Gute muß durch das sittliche Subjekt verwirklicht werden“17 Beide sehen also den (freien) Willen als Grundlage und Maß für das Soziale bzw. das Sittliche an.
Hegel sagt, „wir haben die Völker nicht als Aggregat von Einzelnen zu betrachten, sondern nur das Ganze“ - sinngleich meint Tönnies „es bildet sich ein Ganzes“ wenn er von Sozialität spricht.
4.2 Vergleich der Gesellschafts/ Gemeinschaftsbegriffe
Die Aufteilungen von Hegel und Tönnies ähneln sich sehr. Die Familie bei Hegel wird be- schrieben wie Tönnies Begriff der Gemeinschaft und Hegels „Bürgerliche Gesellschaft“ weist große Parallelen zu Tönnies Gesellschaft auf. Nur der Staat ist ein rein Hegelscher Begriff. Hegel sieht den Staat als das höchste Maß an Sittlichkeit an, bei Tönnies aber kann dieser Staat nicht existieren. Tönnies würde sagen, daß es diese dritte Form nicht gibt oder den Staat bestenfalls unter Gemeinschaft einordnen. Dazu V. Hösle: „Mit der bekannten Unterschei- dung von Tönnies läßt sich sagen, daß zumindest Familie und Staat - aber nicht die bürgerli- che Gesellschaft - als Gemeinschaft, nicht als Gesellschaft zu fassen sind“18. So betont Hegel, daß die Ehe (erste Stufe der Familie) nicht auf Vertrag beruht, genausowenig, wie der Staat. Der Vertrag ist bei Tönnies ein Kriterium für die Gesellschaft, wie das Blut für die Gemein- schaft. Tönnies Gemeinschaft setzt einen gemeinsamen Willen voraus, der stärker ist als der eigene Wille; so sieht Hegel in der Familie eine „sich empfindende Einheit“19 - „in ihr ist der einzelne nicht Person und nicht Subjekt, sondern Mitglied“20. In Hegels bürgerlicher Gesell- schaft sind alle Individuen „für sich“ und nur auf den eigenen Vorteil bedacht - so wie Tön- nies die Gesellschaft mit „Sondern hier ist ein jeder für sich allein , und im Zustande der Spannung gegen alle übrigen“21. In Tönnies Gemeinschaft herrscht der Wesenwille, ein na- turhafter, unterbewußter Wille, wie Hegels Familie eine empfindende Einheit, keine denkende ist. Genauso verhält es sich mit Tönnies Kürwillen, der „ein Gebilde des Denkens selber ist“22 und der Gesellschaft zu Grunde liegt. Dieser Wille tritt auch in Hegels bürgerlicher Gesell- schaft auf, Hegel nennt ihn „Willkür“ wie auch Tönnies in der ersten Auflage von „Gemein- schaft und Gesellschaft“.
Tönnies meint im Gegensatz zu Hegel: „den Staat geht die Sittlichkeit unmittelbar kaum et- was an. Er hat nur die feindseeligen, gemeinschädigenden, oder ihm und der Gesellschaft ge- fährlich erscheinenden Handlungen zu unterdrücken, zu bestrafen“23. Er sieht nur einen Weg, um einen ähnlichen Staat zu schaffen, wie Hegel ihn als Ideal sieht. Tönnies meint „der Staat als Vernunft der Gesellschaft, müßte sich entschließen, die Gesellschaft zu vernichten oder doch umgestaltend zu erneuern“, er schränkt aber gleich ein und stellt fest, daß „das Gelingen solcher Versuche“ „außerordentlich unwahrscheinlich“24 ist. Tönnies würde es nicht als real ansehen, daß in einem Staat der Mensch das Wohl des Staates über das wohl der Gemein- schaft / der Familie setzen würde.
Hegel sagt „das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit“25, da er davon aus- geht, daß der Mensch von Geburt an in soziale Umstände eingebunden ist und die Freiheit daraus im Recht findet. Tönnies aber glaubt nicht daran, daß ein Individuum seinen gemein- schaftlichen Regeln entkommen kann, die „durch Gewohnheit gefestigt und durch Einsicht bekräftigt sind“26
5 RESÜMEE
Die Begriffe „sittlich“ und „sozial“ sind bei Hegel und Tönnies in ähnlicher Weise definiert, in der Unterteilung nach Grad der Sitlichkeit ergeben sich jedoch einige Unterschiede. Tön- nies meint „Hegel will das alte Naturrecht vollends auflösen, aber zugleich ein neues herstel- len, das den Staat als sociale Vernunft schlechthin, als vollendete Idee der Sittlichkeit, als Einheit und Wahrheit abstracten Rechtes und subjectiver Moralität darstellen soll“27. Dies- will Tönnies nicht, für ihn ist der Staat eine kürwillige Gesellschaft und die Gemeinschaft (ähnlich Hegels Familie) das höchste Maß an Sozialität. Tönnies erkennt in Hegels Rechtsphi- losophie einen Versuch und einen Beginn...“ den er „ein gemeinschaftliches Naturrecht nennt„28 Trotz vieler Gemeinsamkeiten ist Tönnies somit überzeugt, daß Hegel „in wesentli- cher Unklarheit über die wirklichen Prozesse des socialen Lebens“29 geblieben ist.
6 LITERATUR
Alwast, Jendris „Die begriffliche Wirklichkeit und die Wirklichkeit des Begriffs.
Zur Kritik und Aneignung Hegels bei Ferdinand Tönnies“, Aufsatz in „Hundert Jahre Gemeinschaft und Gesellschaft“ von Lars Clausen und Carsten Schlüter, Obladen, 1991
Deichsel, Alexander Das Soziale in der Wechselwirkung, Aufsatz in „Simmel und die frühen Soziologen“ von Otthein Rammstedt, 1988 Seite 65-77
Hegel, G. W. F. Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, Heidelberg 1817/18
Hegel, G. W. F. Werke in 20 Bänden, Register von Helmut Reinicke
Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes
Hösle, Vittorio Hegels System, Band 2: Philosophie der Natur und des Geistes, 1. Auflage 1988
Mikl-Horke Soziologie, Seite 83-87
Otthein Rammstedt Simmel und die frühen Soziologen, 1988, Seite 64-77 und 104-
Spurk, Jan Gemeinschaft und Modernisierung, 1990, Seiten 1-33
Tönnies, Ferdinand Gemeinschaft und Gesellschaft : Grundbegriffe der reinen Sozio- logie, 8. Auflage, 1935 Darmstadt
Tönnies, Ferdinand Kritik der öffentlichen Meinung
Tönnies, Ferdinand Einführung in die Soziologie, 2.Auflage 1981, Seiten 54-89 und Seiten 264-269
Tönnies, Ferdinand Neuere Philosophie der Geschichte: Hegel, Marx, Comte. In: Ar- chiv für Geschichte der Philosophie, Band 7, S. 486-515
Weitere Quellen:
http://gutenberg.aol.de/autoren/hegel.htm
[...]
1 Ferdinand Tönnies, 1894b, S. 489
2 Deichsel, Alexander „das Soziale in der Wechselwirkung“, 1988, Seite 66, Zeile 19-20
3 Deichsel, Alexander „das Soziale in der Wechselwirkung“, 1988, Seite 66, Zeile 26
4 Aufzeichnungen Vorlesung 2.11.99
5 Tönnies, Ferdinand „Gemeinschaft und Gesellschaft“, 3.Auflage 1991, Seite 12, Zeile 25
6 Aufzeichnungen Vorlesung vom 26.10.99
7 Mikl-Horke, „Soziologie“, Seite 86
8 Tönnies, Ferdinand „Gemeinschaft und Gesellschaft“, 3.Auflage 1991, Seite 34, Zeile 1-5
9 Hegel, G.W.F. „Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft“, Heidelberg 1817, Seite 84, Zeile 7-9
10 Hegel, G.W.F., Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, Heidelberg 1817, Seite 82
11 Hegel, G.W.F., Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, Heidelberg 1817, Seite 83
12 Alwast, Jendris, Zur Kritik und Aneigung Hegels bei Ferdinand Tönnies, Seite 258
13 Hegel, G.W.F. „Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft“, Heidelberg 1817, Seite 170
14 Hegel, G.W.F. 1996ff., Band 7, § 257
15 Horkheimer, Max „Schriften des Instituts für Sozialforschung“, 5. Band Studien über Autorität und Familie, 2. Auflage 1987, Reprint der Ausgabe Paris 1936, Seite 182, Zeile 25-29
16 Philosophie der Weltgeschichte, Seite 99
17 a.a.O.
18 Hösle, Vittorio „Hegels System“, Hamburg 1988, Seite 467, Zeile 3-6
19 Hegel, G.W.F. „Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft“, Heidelberg, 1817/18, Seite 90, Zeile 7
20 Hösle, Vittorio „Hegels System“, Hamburg 1988, Seite 530, Zeile 4-5
21 Tönnies, Ferdinand „Gemeinschaft und Gesellschaft“, Neudr. der 8. Auflage 1935, Seite 34, Zeile 9-10
22 Tönnies, Ferdinand „Gemeinschaft und Gesellschaft“, Neudr. der 8. Auflage 1935, Seite 73, Zeile17-18
23 Tönnies, Ferdinand „Gemeinschaft und Gesellschaft“, Neudr. der 8. Auflage 1935, Seite 214, Zeile 9-12
24 Tönnies, Ferdinand „Gemeinschaft und Gesellschaft“, Neudr. der 8. Auflage 1935, Seite 214, Zeile 23
25 Tönnies, Ferdinand, Hegels Naturrecht, 1932, §4
26 Tönnies, Ferdinand, Hegels Naturrecht, S. 288
27 Tönnies, Ferdinand, Neuere Philosophie der Geschichte..., S.491
28 Alwast, Jendris, Zur Kritik und Aneigung Hegels bei Ferdinand Tönnies, Seite 258
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über Tönnies und Hegel?
Der Text ist ein Vergleich der philosophischen und soziologischen Anschauungen von Ferdinand Tönnies und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, insbesondere in Bezug auf die Begriffe "sozial" und "sittlich". Er behandelt Tönnies' Konzept von Gemeinschaft und Gesellschaft sowie Hegels Philosophie der Sittlichkeit.
Wer war Ferdinand Tönnies?
Ferdinand Tönnies (1855-1936) war ein deutscher Soziologe, bekannt für seine Unterscheidung zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" als Grundkategorien der Soziologie.
Was sind "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" nach Tönnies?
"Gemeinschaft" bezeichnet menschliche Beziehungen, die um ihrer selbst willen bestehen (z.B. Familie, Nachbarschaft), geprägt von Zusammengehörigkeit und Solidarität. "Gesellschaft" hingegen ist durch Trennung von Zweck und Mittel, Kalkül und Rationalität gekennzeichnet, bezogen auf den Nutzen des Individuums.
Wer war Georg Wilhelm Friedrich Hegel?
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) war ein deutscher Philosoph, der den deutschen Idealismus vollendete und ein umfassendes Lehrgebäude der Philosophie schuf, in dem die Vernunft das Wesen der Welt bildet.
Was versteht Hegel unter Sittlichkeit?
Hegel beschreibt Sittlichkeit als positive Verbundenheit von Personen, eine Synthese von Recht und Moral, in der sich das Individuum mit dem Geist seiner Familie und seines Volkes identifiziert.
Welche drei Begriffe der Verbundenheit unterscheidet Hegel?
Hegel unterscheidet drei Formen sittlichen Zusammenlebens: Familie, Bürgerliche Gesellschaft und Staat. Die Familie ist die erste Form, in der Sittlichkeit "schlafend" vorhanden ist. Die Bürgerliche Gesellschaft ist ein System der Willkür und des Egoismus. Der Staat ist die höchste Form, in der sich der Einzelne freiwillig dem Gemeinschaftswillen unterwirft.
Wie werden die Konzepte von Tönnies und Hegel verglichen?
Der Text vergleicht die Konzepte von Tönnies' "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" mit Hegels "Familie" und "Bürgerlicher Gesellschaft". Der Staat als Konzept wird im Verglich hervorgehoben, da Tönnies und Hegel unterschiedliche Ansichten über diesen vertreten.
Welche Rolle spielt der Staat in den Theorien von Tönnies und Hegel?
Hegel sieht den Staat als die höchste Form der Sittlichkeit, in der sich der Einzelne freiwillig dem Gemeinschaftswillen unterwirft. Tönnies hingegen glaubt nicht, dass ein Staat in diesem idealen Sinne existieren kann und ordnet ihn bestenfalls unter Gemeinschaft ein.
Wie definieren Tönnies und Hegel "sozial" bzw. "sittlich"?
Sowohl Tönnies als auch Hegel sehen das soziale bzw. sittliche Verhältnis von Personen in einer positiven Art und Weise, wobei das "sich förderlich aufeinander beziehen" das Maß für Sozialität/Sittlichkeit ist. Der Grad wird an der Intensität der förderlichen Willen in der Beziehung gemessen.
Gibt es eine Literaturliste im Text?
Ja, am Ende des Textes befindet sich eine Literaturliste mit Werken von und über Tönnies und Hegel.
- Quote paper
- Maya Heinbockel (Author), 1999, Ferdinand Tönnies und Hegel - eine vergleichend Anschauung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98577