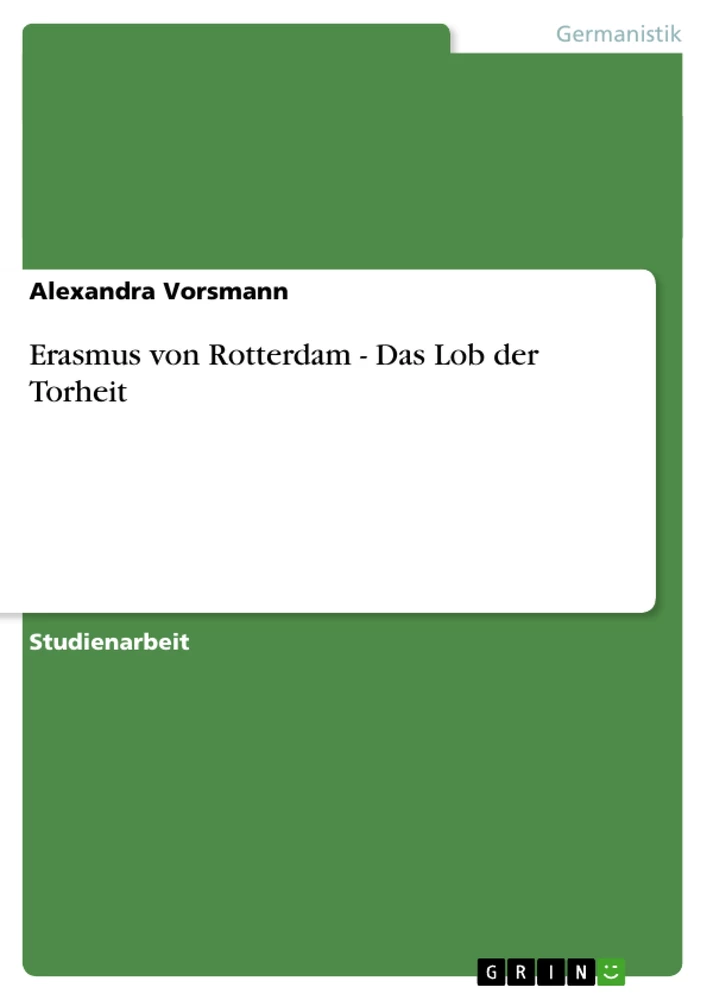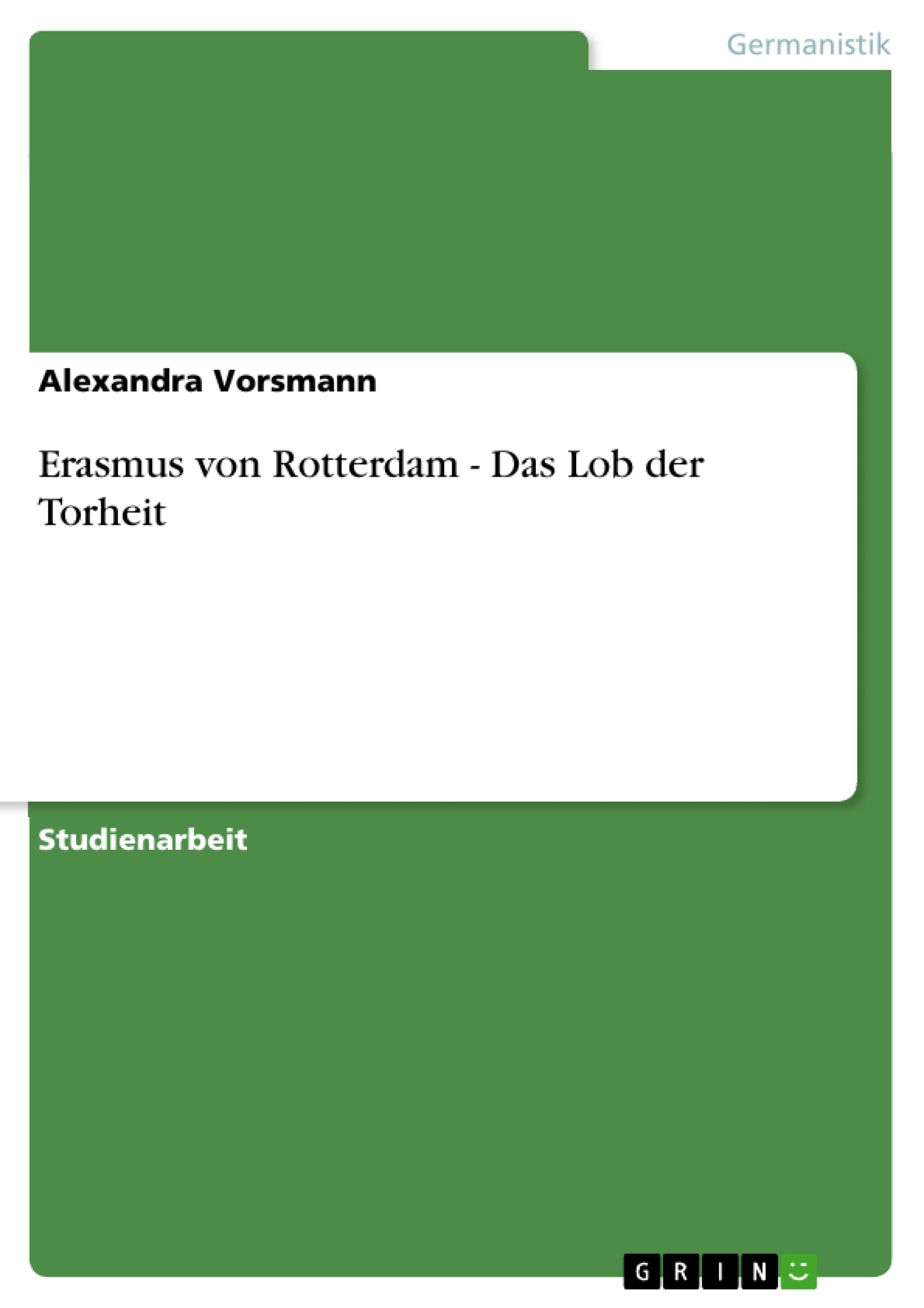Was wäre, wenn die Dummheit selbst das Wort ergreift, um die Welt auf den Kopf zu stellen? In Erasmus von Rotterdams brillanter Satire "Das Lob der Torheit" (Moriae Enkomium), erleben wir genau das: Die Göttin Stultitia, die personifizierte Torheit, entfesselt eine fulminante Rede, die unsere tiefsten Überzeugungen über Weisheit, Glück und Tugend in Frage stellt. Mit scharfer Ironie und geistreicher Eloquenz preist sie die Narrheit als Quelle aller Lebensfreude, gesellschaftlichen Zusammenhalts und sogar religiöser Erfüllung. Stultitia enthüllt die Torheiten der Gelehrten, die Scheinheiligkeit der Mächtigen und die Absurdität menschlicher Bestrebungen, indem sie die Welt aus einer völlig ungewohnten Perspektive betrachtet. Sie nimmt die Leser mit auf eine Reise durch die menschliche Gesellschaft, von den Höfen der Könige bis in die Kathedralen der Kirche, und entlarvt überall die Masken der Selbsttäuschung und des Eigennutzes. Doch hinter dem satirischen Schleier verbirgt sich eine tiefere Weisheit: Erasmus fordert uns auf, die Grenzen unseres Verstandes zu erkennen und die befreiende Kraft des Unkonventionellen zu schätzen. Entdecken Sie, wie die Torheit zur wahren Weisheit wird, während Stultitia die Leser mitnimmt auf eine Reise durch Bildungsparodie, Religionskritik und Gelehrtensatire. Dieses Werk ist mehr als nur eine Lobrede, es ist eine Spiegel, der uns unsere eigenen Torheiten vorhält und uns gleichzeitig ein Lächeln ins Gesicht zaubert. "Das Lob der Torheit" ist nicht nur ein Meisterwerk der Renaissance-Literatur, sondern auch eine zeitlose Mahnung, die uns dazu auffordert, die Welt mit den Augen der Narren zu sehen – und dabei vielleicht die Wahrheit zu entdecken. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Logik auf den Kopf gestellt wird und die Dummheit zur höchsten Form der Intelligenz avanciert. Lassen Sie sich von Erasmus' Sprachwitz verzaubern und von Stultitias provokativen Thesen herausfordern. Dieses Buch ist eine Einladung, über den Tellerrand zu blicken, Konventionen zu hinterfragen und die subversive Kraft des Lachens zu entdecken. Eine unvergessliche Lektüre für alle, die den Mut haben, die Welt mit neuen Augen zu sehen und die Weisheit in der Torheit zu erkennen – ein Klassiker der Weltliteratur, der bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und Leser aller Generationen begeistert und zum Nachdenken anregt, eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den großen Fragen der Menschheit, verpackt in ein Feuerwerk an Ironie und Sprachwitz, ein Muss für alle Liebhaber der Satire und der geistreichen Unterhaltung, die auf der Suche nach Erkenntnis und Vergnügen sind, ein unvergessliches Lesevergnügen, das lange nachwirkt und die Perspektive auf die Welt nachhaltig verändert, ein zeitloser Klassiker, der immer wieder neu entdeckt werden will.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Die heilsame Torheit
III. Die erasmische Ironie
3.1 Das Sprecherparadoxon
3.2 "Subjektive" und "objektive" Ironie
3.3 Die Widmung
IV. Die Figur der Stultitia
4.1 Der olympische Standpunkt
4.2 Stultitia als schelmische Hochstaplerin
4.2.1 Herkunft und Geburt
4.2.2 Geburtsort und Jugendgenossen
4.3 Die Masken der Torheit
4.4 Die sympathische Torheit
V. Die Stoßrichtung des Enkomiums
5.1 Bildungsparodie
5.2 Religionskritik und Gelehrtensatire
VI. Episodik
VII. Schlußbemerkungen
Literatur
I. Einleitung
Nach seiner Rückkehr aus Italien im Jahr 1509 verfaßte Erasmus von Rotterdam das Moriae Enkomium, das zwei Jahre später in Paris erstmals gedruckt wurde1. Die Schrift, in der die Torheit personifiziert als antike Göttin Stultitia (griech.: Moria) auftritt2, um eine schwungvolle Preisrede auf ihr Wesen und ihr Wirken in der Welt zu halten, erfuhr eine ungeheure Resonanz, sichtbar allein schon in den zahlreichen Auflagen und Übersetzungen3. Allein das 16. Jahrhundert erlebte etwa 60 weitere Ausgaben, innerhalb der nächsten 40 Jahre nach Erscheinen wurde das Enkomium in fast alle europäischen Sprachen übersetzt4. Nicht zuletzt die karikierenden Randzeichnungen Hans Holbeins d.J., welche erstmals dem Baseler Froben-Druck Ende 1515 beigefügt wurden, trugen viel zur Beliebtheit des Enkomiums bei.
Neu war nicht das Thema der Schrift, neu war der Umgang mit demselben. In der Tradition antiker Enkomien, d.h. dem Preis des Lächerlichen, bzw. Schlechten, wendet Erasmus die Narrenthematik, wenn auch auf ironische Weise, erstmals ins Positive. Galt in der bisherigen Narrenliteratur der Narr als triebgebundener Sünder, befreit ihn Erasmus aus diesen religiös-ethischen Zwängen und betrachtet die Narrheit als Äußerung der Unvernunft, als Gegensatz zur intellektuellen Weisheit5.
Die Lobrede weist mehrerer Hinsicht Entsprechungen zu den im Seminar untersuchten Schelmenromanen auf, die es in dieser Arbeit zu untersuchen gilt, wenn auch Jensma diesem Anliegen zu Recht entgegenhält:
"Das >Lob< ist nicht als Objekt der Forschung gedacht, es soll augenblicklich überzeugen."6
II. Die heilsame Torheit
Der Leitgedanke, der sich durch das gesamte Enkomium zieht, und eine erste und grundlegende Verbindung zum Schelmen darstellt, ist die Maskenhaftigkeit des menschlichen Daseins, der Unterschied zwischen Sein und Schein: das Leben als Theater und Spiel der Torheit. Diejenigen, die sich anschicken, hinter die Kulissen zu schauen, werden von Stultitia als unheilverursachende Spielverderber gescholten:
"Wenn einer versuchen wollte, Schauspielern auf der Bühne die Masken herunterzureißen und den Zuschauern die wirklichen Gesichter zu zeigen, würde er nicht das ganze Stück verderben und verdienen, wie ein Besessener von allen mit Steinen aus dem Theater gejagt zu werden? Es könnte so allzu plötzlich ein neues Bild der Verhältnisse erscheinen: wer eben noch Frau war, ist jetzt ein Mann, wer eben noch Jüngling war, gleich Greis, wer kurz vorher ein König war, entpuppt sich nun als der namenlose Dama des Horaz, wer eben noch Gott war, erscheint plötzlich als Menschlein. Diesen Irrtum beseitigen heißt das ganze Stück verwirren. Dieser Trug und Schein ist es doch, der die Augen der Zuschauer gebannt hält.
Was ist den das menschliche Leben schon anderes als ein Schauspiel, in dem die einen vor den anderen in Masken auftreten und ihre Rolle spielen, bis der Regisseur sie von den Brettern abruft? [...] Schein ist zwar alles, aber dieses Stück wird nicht anders gegeben." (34)7
Die Torheit macht gar nicht erst den Versuch, ihr Wesen zu verleugnen. Im Gegenteil, sie bejaht die Täuschung. Stultitia demonstriert in ihrer Rede, daß allein der Tor glücklich sein kann; entweder, weil er zu dumm ist, das Spiel zu durchschauen, oder weil er sich entscheidet, mitzuspielen, d.h. zu täuschen und sich täuschen zu lassen8. So ist auch das Motiv der dem Schelmen zugeneigten Fortuna bereits im Enkomium angelegt. Nachdem Stultitia zum wiederholten Mal auch explizit geäußert hat, daß kein Mensch ohne die Gunst der Torheit ein glückliches Leben führen kann (92), nennt sie erklärend die Schicksalsgöttin sogar beim Namen:
"Wie sollte das auch anders sein, da doch selbst Fortuna, die Mehrerin menschlicher Wohlfahrt, mit mir eines Sinnes ist und gerade den Weisen immer denkbar mißgünstig bleibt, den Toren dagegen noch im Schlaf Annehmlichkeiten in Fülle gönnt (92)."
Diese Ansicht untermauert sie mit einer Reihe Spruchweisheiten. Aus den folgenden Passagen (93) spricht dann aber boshafte Ironie. Denn Fortuna ist den Toren nicht etwa deshalb gewogen, weil sie unter einem günstigen Stern geboren sind, oder sich zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort befinden. Sie ist auf Seiten derjenigen, die, indem sie moralische Werte außer Acht lassen, Reichtümer und einträgliche Ämter gewinnen. Die Gunst der Fortuna offenbart sich also als materieller Segen. Dem moralisch handelnden Weisen dagegen bleibt dieses Glück verwehrt (93). Indem er sich dem Theater verweigert, weil er auf Moral und Wahrheit besteht, muß, ent-täuscht, verzweifeln. In den Augen der Stultitia führt Weisheit gar zu Selbstzerstörung, da der Weise, der das Elend der Welt erkennt, den Freitod vorzieht:
"Ihr seht wohl, was eintreten würde, wenn alle Menschen weise wären: ein neuer Lehm und eine neue prometheische Töpferhand wäre dann bald nötig." (37)
Die Intention der Stultitia besteht darin, die landläufige Bewertung der Begriffe Torheit und Weisheit in ihr Gegenteil zu verkehren, Torheit als positiv, weil lebenspendend, Weisheit als negativ, weil lebenzerstörend, zu offenbaren.
"Durch das ganze Werk klingen ständig zwei Themen durcheinander: das von der heilsamen Torheit, die wahre Weisheit ist, und das von der eingebildeten Weisheit, die lauter Torheit ist."9
Die Ständesatire im Mittelteil hat das zweite Thema zum Gegenstand, hier demonstriert Stultitia, wie es um die Weisheit der gelehrten Stände wirklich bestellt ist. Das Hauptthema des Enkomiums jedoch ist das Motiv der heilsamen Torheit, die wahre Weisheit bedeutet. Es beherrscht den ersten und den dritten Teil der Rede, bildet somit den Eingang und, als Torheit des Kreuzes, den abschließenden Höhepunkt der Ausführungen10.
III. Die erasmische Ironie
3.1 Das Sprecherparadoxon
Die Sprecherfiktion in der Lobrede stellt ein grundlegendes Paradoxon mit weitreichenden Folgen für das Verständnis dar. Die personifizierte Torheit spricht über sich selbst, mit all ihren Eigenschaften, die sich unter den Begriffen Dummheit und Irreführung summieren lassen.
Den Kunstgriff, die Lobrede der Stultitia selbst in den Mund zu legen, bezeichnet Kaiser gar als "the most important single fact about Erasmus' book."11 Die Sekundärliteratur verweist immer wieder auf das rhetorische Paradoxon des Epimenides, der, selbst Kreter, behauptet, alle Kreter seien Lügner12. Eine übersichtliche Aufschlüsselung dieser Problematik liefert Hudson, der die verschiedenen möglichen Verständnisebenen der Lobrede durchleuchtet und die jeweiligen Folgen für die Interpretation darstellt13.
Der Leser könnte beispielsweise mit Blick auf die Sprecherin Torheit, ihre Aussagen über die heilsame Torheit und die törichte Weisheit nicht ernst nehmen:
"Da ja beide von der Torheit gesungen werden, müßte man sie beide umkehren, um die Wahrheit zu bekommen, wenn nicht Torheit... Weisheit wäre."14
Angesichts der vielen provokanten Äußerungen in der Lobrede könnte die Sprecherfiktion auch lediglich dazu dienen, Erasmus gegen kritische Angriffe in Schutz zu nehmen; Stultitia spräche dann, als Närrin ungestraft, die Wahrheit. Die Rednerin selbst kommt auf dieses Phänomen zu sprechen, wenn sie über die Anwesenheit ihres Narrenvölkchens auch und gerade an den Höfen der Mächtigen sinniert:
"Das ist nun der wunderliche Vorzug meiner blöden Gefolgschaft, daß man von ihnen nicht nur die Wahrheit, sondern sogar offenbare Beschimpfungen mit Vergnügen annimmt. Es geht soweit, daß das gleiche Wort, das im Munde eines Weisen zu einem todwürdigen Verbrechen würde, im Munde eines Narren unglaubliches Vergnügen hervorruft."(45)
Tatsächlich benötigte Erasmus durchaus den Vorwand des Scherzes. Die heftigen Angriffe der Stultitia gegen Gelehrte und Geistlichkeit, die auch den Papst nicht ausschließen, und besonders die Ausführungen über die Torheit des Kreuzes waren nicht gerade dazu angetan, ihm in seiner Zeit Freunde zu schaffen. Das Lob der Torheit erschien nur wenige Jahre vor Luthers Thesenanschlag zu Wittenberg und dem Beginn der Reformation. Vor diesem Hintergrund muß man den Widerwillen, den die Theologen der alten Kirche gegen diese Schrift hegten, sehen15.
In späteren Jahren entging der Reformtheologe nur knapp einer Verurteilung als Ketzer16. Die Brisanz des Enkomiums wird deutlich, wenn man bedenkt, daß Erasmus im Jahr 1559 auf dem ersten offiziellen Index Librorum Prohibitorum in die erste Klasse der Hauptirrlehrer eingereiht wurde, was ein Verbot sämtlicher Schriften beinhaltete. Fünf Jahre später wurde das Verbot auf einige Schriften eingeschränkt, darunter bezeichnenderweise das Lob der Torheit17.
Legt aber Erasmus die Lobrede der Torheit lediglich aus dem Grund in den Mund, seine möglichen Gegner und Kritiker in die Irre zu führen? Dann muß Stultitia allein deshalb bisweilen töricht reden, um die Sprecherfiktion aufrechtzuerhalten:
"Yet he [Erasmus] cannot speak th[e] truth all of the time, or no one will believe it is Folly who is before him."18
3.2 "Subjektive" und "objektive" Ironie
Eine sinnvolle Hilfestellung zur Interpretation liefert Jensma, indem er zwischen subjektiver, d.h. formaler, werkgebundener Ironie und objektiver, d.h. Ironie des erasmischen Denkens, im Enkomium unterscheidet19.
Unter subjektiver Ironie versteht er jene rhetorischen Figuren, welche die Aussagen der Stultitia zum Schein abschwächen und so tatsächlich dazu dienen, Erasmus Schutz vor den Angriffen der Machthaber zu bieten. Das ist z.B. die ge- spielte Zurückhaltung mit dem wiederholten Gebrauch von "mir scheint, daß...", das Verschweigen in der Form: "Ich will nicht sagen, daß...", das Übergehen eines unwichtigen, jedoch auf diese Art doch erwähnten Zustandes, das Zurücknehmen eines sogenannten unpassenden Ausdrucks, der dann durch einen angemesseneren ersetzt wird ("Ich habe selbst einen Dummkopf - Verzeihung! Gelehrten, wollte ich sagen - gehört,..." (80f)), und schließlich der wortreiche Protest gegen die möglichen Einwendungen, Vorwürfe und Mißverständnisse.
Darüber hinaus ist das Enkomium geprägt von einer nicht bloß formalen, sondern immanenten und in diesem Sinne objektiven Ironie des erasmischen Denkens:
"Diese Ironie hat nicht die Funktion, sich gegen die Mächtigen zur Wehr zu setzen, sondern richtet sich über die Köpfe der Fürsten und Prälaten hinweg an das Publikum. Nicht um sich als Person des öffentlichen Lebens von der öffentlichen Meinung in Schutz nehmen zu lassen, sondern um das Publikum von einer anderen Ansicht zu überzeugen."20
Diese besondere Ironie meint eben nicht nur ihr genaues Gegenteil, so daß der Leser bloß die Vorzeichen zu ändern braucht, um zur Wahrheit hinter der Aussage zu gelangen.
Stultitia spielt immer wieder den Weisen gegen den Toren aus, wobei beide als verzerrte Extreme dargestellt werden. Es bleibt dem Leser überlassen, die Wahrheit in, zwischen oder über diesen Extremen zu entdecken:
"The irony is composed of the simultaneous expression of several points of view, just as a play is composed of speeches by many different characters; and the meaning of the irony and of the play is not that of any point of view or of any one character, but all of them interacting upon each other. The result is not paralysis or abject relativism, but a larger truth than that presented by any one of the elements alone."21
Eine letztgültige Wahrheit wird hier als solche erkennbar nicht verkündet, der Leser wird konfrontiert mit den zahlreichen Erscheinungsformen der Wahrheit, die gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Stultitia wird somit
"zur Verkünderin einer Weisheit, die statt eines rigorosen "Entweder-Oder" ein "Sowohl-Als auch" proklamiert, das allzu verfestigte überkommene Denkgewohnheiten auflöst und bisher für selbstverständlich gehaltene Normen ins Wanken bringt."22
Dabei kommt es Erasmus nicht auf die Aufhebung bestehender Wertkategorien an, sondern auf deren Relativierung23. Das Lob der Torheit ist eine Auseinandersetzung mit Begriff und Wesen der Wahrheit:
"In der überraschenden Entdeckung, daß mit Hilfe sprachlicher Mittel und logischer Beweisführung ihre Umkehr möglich ist, wurde [ ] nichts Geringeres als die Wahrheit selbst zum Problem; wenn auch nicht ihre Existenz überhaupt, so doch ihre eindeutige Fixierbarkeit."24
Dies wirkte umso provokanter in Zeiten, als Theologie und Philosophie noch unverbrüchlich von der Existenz der "einen Wahrheit" überzeugt, auf der Suche nach ihr waren, bzw. für sich in Anspruch nahmen, sie zu verkörpern.
3.3 Die Widmung
Die der Lobrede vorangestellte Widmung an Thomas Morus (3-6) rechtfertigt die Schrift gegenüber erwarteter Kritik. Da der Autor das Enkomium tatsächlich im Haus Morus' abgefaßt hat und er somit den Freund hätte persönlich aufklären können, sind die eigentlichen Adressaten dieser Widmung natürlich die Leser, unter ihnen die potentiellen Gegner25. Die Frage, die sich dem Leser insbesondere nach der Lektüre des Enkomiums aufdrängt, lautet: Ist diese Widmung aufrichtig gemeint, oder enthält sie nicht ihrerseits bereits Ironie?
Schon die Strategie der Argumentation weist auf den tatsächlich ironischen Gehalt dieser Widmung. Erasmus sichert sich nach allen Seiten ab und bietet dem Leser gleich mehrere Rechtfertigungsmöglichkeiten, aus denen dieser sich, gemäß seiner Geisteshaltung, quasi die ihn überzeugende aussuchen kann.
Wenn er die möglichen Kritiker zunächst als "gehässig"(4) bezeichnet, so bestreitet Erasmus ihnen damit eine unvoreingenommene Urteilskraft. Dies hält ihn nicht davon ab, sein Werk dennoch zu verteidigen. Der Autor reiht das Enkomium zunächst als "ironische Spielerei"(3) in eine seit langem bestehende literarische Tradition (4)26 und degradiert es folgend als Scherz des begeisterten Verehrers, der, um des rein intellektuellen Vergnügens willen, seine rühmlichen Vorbilder nachzuahmen versucht.
Wer ihm dies nicht abnimmt, den verweist er sogleich auf das Vorrecht des Schriftstellers, spielerisch und kurzweilig ernsthafte Einsichten zu vermitteln (4) und sich straflos über das menschliche Leben lustig machen zu dürfen (5). Er geht noch weiter, indem er behauptet, wer sich getroffen fühle, bekenne eben damit, schuldig zu sein (5). Seine Kritik an der höchsten christlichen Autorität auf Erden, dem Papst, entschwächt Erasmus, indem er wiederum die Kritiker verächtlich macht:
"Da gibt es unter anderem Leute von reichlich merkwürdigen religiösen Auffassungen, die eher bereit sind, Christus aufs heftigste anzugreifen, als auch nur den harmlosesten Scherz gegen den Papst oder einen Fürsten zuzulassen,..." (5)
Als "harmlos" lassen sich seine Angriffe auf weltlich orientierte, gar kriegführende Päpste (87f) wahrhaftig nicht bezeichnen. Anschließend verweist der Autor darauf, daß er nicht die Menschen, sondern ihre Fehler aufs Korn nimmt (5). Und:
"Ich habe [...] meinen Ausdruck so gemäßigt, daß ein verständiger Leser sofort merkt, es gehe mir mehr um Vergnügen als um Satire." (5f)
Gerade diese Behauptung ist pure Ironie und wird durch die Lektüre der Schrift als solche entlarvt. Sollte nach all diesen Argumenten nun jemand noch nicht zufrieden sein, so beschwichtigt Erasmus abschließend mit einem Verweis auf die Rednerin: der Leser mag daran denken, wie gut es ist, von der Torheit getadelt zu werden (6). Erasmus markiert zudem entschieden die Zweiheit von Autor und Sprecherin: "Wir legen ihr ja alle Worte in den Mund und durften doch nicht aus der Rolle fallen" (6). Tatsächlich sind Erasmus und Stultitia aber nicht gänzlich voneinander zu trennen, und Stultitia fällt im Verlauf der Rede durchaus aus der Rolle.
"Schelmenhaft" wirbt Erasmus um die Gunst des Lesers. Wenn er sagt: "Ich stelle mich mit meiner Arbeit dem Urteil der Öffentlichkeit" (5), so ist dies, in Zeiten der Zensur, ebenso provokant, wie die Aufforderung des Schelmes Lazaril von Tormes an seine Leser, selbst über sein Leben zu urteilen27.
IV. Die Figur der Stultitia
4.1 Der olympische Standpunkt
Die Tatsache, daß Erasmus die Torheit als antike Göttin auftreten läßt, ist kein bloßer Zufall:
"Es ist vielmehr ein sorgfältig gewähltes Mittel der Verfremdung, das Verblüffung und Überraschung auslösen und den Blick, von Vorurteilen und Voreingenommenheit unverstellt, auf neue Möglichkeiten der Sinndeutung lenken soll."28
Bereits durch die Darstellung der Stultitia als griechische Göttin wird hier eine Positivierung vorgenommen, wobei ihr die Affinität des Humanismus zur griechischen Antike zugute kommt. Das Ganze ist allerdings ein Scheinmanöver, "und hinter der Maske der Frau Stultitia [schaut] immer wieder der Brantsche Narr hervor"29. Stultitia spielt eine Doppelrolle,
"..., indem sie, im Schellengewand, mit Kolben und Narrenkappe ausgerüstet, sich durchaus zeitgemäß gibt und damit den Geist der Narrheit repräsentiert, wie er sich allenthalben im Spätmittelalter kundtat, gleichzeitig aber als antike Göttin [...] in geheimnisvolle Ferne entrückt und mit dem Schimmer der Verklärung umgeben wird, der aus einer schöneren Vergangenheit erhellend in die düstere Gegenwart hinüberreicht."30
Die Darstellung der Torheit als Göttin ermöglicht erst ihren überlegenen Standpunkt der Himmelsschau, der insbesondere im zweiten Teil der Lobrede, der Ständesatire, zum Tragen kommt. Dort nimmt sie ihren Platz unter den olympischen Göttern ein, um das Gewimmel der Menschen auf Erden zu beobachten. Dies markiert einen weiteren Unterschied zur bisherigen Narrenliteratur:
"Der Kunstgriff erweist sich als sehr glücklich. Die Stände ziehen nicht mehr prozessionsartig am Auge des Betrachters vorbei, die Torheit selbst ist es, die die Blicke der Schauenden lenkt, die die Hörenden auf neue Themen aufmerken läßt."31
Auf diese Weise teilt sie zudem mit dem Schelm die Rolle des unbeobachteten Beobachters, wenngleich von einem unterschiedlichen Standpunkt aus. Der Schelm nimmt häufig als "einfältiger" Diener, "unschuldiges" Kind oder in Gestalt des apulejischen Esels einen niederen sozialen Standpunkt ein als die Menschen in seiner Umgebung. Auf diese Weise bleibt er unbeobachtet, weil er nicht ernstgenommen wird. Er erlebt Abenteuer inmitten der Menschen und stellt deren Narrheit durch ihre konkreten Handlungen oder Reaktionen auf seine Person bloß. Stultitia wird ebensowenig von den Menschen wahr- bzw. ernstgenommen, auch wenn sie tatsächlich einmal in Persona unter den Menschen weilt, etwa als Beiwohnerin einer theologischen Disputation (101). Sie offenbart die Narrheit der Menschen durch die Schilderung dessen, was sie als vom Olymp herabschauende bzw. ausnahmsweise unter den Menschen wandelnde Göttin sieht. Stultitia durchwandert die Welt mit ihren Augen und Ohren, der Schelm mit seinen Beinen. Stultitia schildert die einzelnen Stände zumeist typenhaft und nennt keine Namen32. Der Schelm hat es dagegen mit konkreten Einzelpersonen zu tun, die aber wiederum Stellvertreter der einzelnen Stände darstellen.
4.2 Stultitia als schelmische Hochstaplerin
4.2.1 Herkunft und Geburt
Da Stultitia beide Elternteile bekannt sind, stellt sich für sie, im Gegensatz zu vielen Schelmen, zumindest die Frage nach ihrer biologischen Abstammung nicht. Bezeichnend und schelmenhaft ist allerdings, wie sie ihre Herkunft darstellt. Als Grund für ihre Ausführungen gibt die Torheit an, daß kaum jemand ihre Ahnen kennt (10). Schon diese Aussage rückt die Rednerin in ein zweifelhaftes Licht, behauptet sie doch, Herrscherin über die Welt zu sein. Sie selbst spottet an späterer Stelle über den ausgeprägten Ahnenkult der Menschen (54), der insbesondere bei Machthabern praktiziert wird und schließlich deren Legitimation dient. Stultitia beschreibt fortfahrend ihre Eltern:
"Mein Vater war weder das Chaos noch der Orkus, Saturn oder Japetus, noch sonst einer von den altersgrauen, abgestandenen Göttern. Plutos, der Reichtum, war es. Ob nun Hesiod und Homer, ja selbst Jupiter wollen oder nicht, er allein ist der Vater der Götter und Menschen. Nach seinem Willen regt und bewegt sich heute wie einst alles Geistliche und Weltliche. [...] Wer [ ] unter seinem Schutz steht, darf getrost dem blitzeschwingenden Götterhaupte Jupiter den Strick empfehlen. Seiner Vaterschaft rühme ich mich. Er zeugte mich nicht aus seinem Haupte wie Jupiter das finstere Mannweib Pallas, sondern mit der Nymphe Jugend, der hübschesten und ansehnlichsten von allen." (10f)
In diesen und den folgenden Passagen offenbart sich Stultitia als schelmische Hochstaplerin, die ihre Abkunft positiviert und überhöht. Dabei spielt sie zum Einen die Autorität der antiken Mythenschreiber und selbst des höchsten olympischen Gottes gegen die "Realität" aus. Jupiter gesteht sie allenfalls noch die Rolle des formalen Herrschers zu, als den wahren Machthaber stellt sie ihren Vater Plutos, den Reichtum, dar. Neben dem Attribut Reichtum ist es insbesondere die Kraft, welche die Herrschergewalt ihres Vaters ausmacht. Plutos ist der jugendlich-vitale Gegenpart zu den "altersgrauen, abgestandenen Göttern":
"Täuscht euch nicht, der altersschwache und blinde Plutos des Aristophanes war nicht mein Erzeuger, sondern es war der einst frische und noch jugendwarme Plutos,..." (11).
Ihre Affinität zur Jugend erläutert Stultitia im Verlauf ihrer Lobrede ausführlich (15ff).
Durch die Darstellung Plutos als den eigentlichen Weltbeherrscher weckt Stultitia die Vorstellung, ihre Regentschaft sei bereits durch ihre Geburt, gleichsam als "legitime Erbin", gerechtfertigt. Die folgenden Worte rücken die Geburt der Stultitia jedoch in ein zweifelhafteres Licht: ihr Vater
"[glühte] nicht nur von Jugend, sondern ebenso vom Nektar [...], den er damals gerade reichlich und ungemischt beim Göttermahl getrunken hatte."(11)
Der Gott, dessen Vaterschaft sie sich rühmt, hat sie also auf recht unrühmliche Weise, nämlich betrunken gezeugt. Die Geburt der Stultitia ist so wenig rühmlich wie ihre Zeugung. Es ist keine göttliche Geburt aus Meeresschaum, Schenkel, Kopf oder Erde, sondern eine menschliche, "aus der Scham".
"Therefore, the unusual thing about her birth is that it was not unusual. It was indeed so natural that [...] it was not even legitimate."33
Stultitia teilt also mit dem Schelm das Schicksal der - nach göttlichen Maßstäben - ungewöhnlichen, und darüberhinaus illegitimen Geburt. Denn Stultitias Eltern führen nicht etwa eine - "unnatürliche" - "freudlose Ehe"(11), sondern sie entstammt einem "viel schwungvollere[n] Liebesbund"(11).
Durch die Auswahl der Adjektive wird aber der eigentliche Makel auch hier wieder in einen Vorteil gewendet. Ihre gewöhnliche Geburt bejaht Stultitia, indem sie die aus Jupiters Haupt geborene Athene als "finsteres Mannweib"(11) bezeichnet und so deren besondere Geburt in Bezug setzt zu ihrem negativen Charakter.
In der Darstellung ihrer Geburt und Zeugung als den anderen Göttern eben in ihrer Gewöhnlichkeit doch überlegen, in der rühmenden Berufung auf ihren Vater, der eigentlich nur betrunken einen Bastard gezeugt hat, manifestiert sich eine schelmische Eigenschaft der Stultitia. Es ist die hochstaplerische Intention der Illegitim- und Niedriggeborenen zur Assimilation an die höhere - hier an die göttliche - Gesellschaft. Ihre Ausführungen erinnern beispielsweise an das Ein- gangskapitel des "Simplicissimus", in dem dieser seine gewöhnlich-bäurische Herkunft, den heimatlichen Bauernhof und seinen vermeintlichen Vater buchstäblich adelt34.
Mit Assimilation begnügt sich Stultitia allerdings nicht, sie stellt sich gleich über alle Götter (und Menschen). Immer wieder im Verlauf der Rede vergleicht Stultitia ihr Wirken mit dem anderer Götter (z.B. 59f) und erweist sich selbst als die erstrangige unter ihnen. Bezeichnend für ihr hochstaplerisches Wesen ist auch ihre Auseinandersetzung mit dem Götterkult der Menschen. Die Tatsache, daß ihr im Gegensatz zu anderen Göttern nirgendwo auf Erden in Tempeln geopfert wird, daß es also mit ihrem Ansehen unter den Menschen recht schlecht bestellt ist, stört sie nicht im Geringsten. Im Gegenteil:
"Warum sollte ich mir also einen Tempel wünschen, wo die ganze Erde mir doch der eindrucksvollste Tempel ist? [...] Mir sind ebensoviele Standbilder errichtet, wie es Menschen gibt, die mein lebendes Abbild sogar gegen ihren Willen umhertragen. Ich habe also keinen Anlaß zum Neid auf die übrigen Götter, wenn man eben den einen oder andern in irgendeinem Winkel der Erde zu einer bestimmten Zeit feiert, [...]. Nur muß mir eben alle Welt einhellig und ohn' Unterlaß viel geziemendere Opfer bringen." (61)
4.2.2 Geburtsort und Jugendgenossen
Nach der Darlegung ihrer biologischen Abstammung kommt Stultitia auf ihren Geburtsort zu sprechen:
"Ihr werdet gewiß nach meinem Geburtsort fragen, da die gesellschaftliche Achtung heute davon abhängen soll, wo man das erst Geschrei ausgestoßen hat." (11)
Ihre Worte wecken den Eindruck, als beantworte sie die Frage nach ihrem Geburtsort lediglich aus Gefälligkeit gegenüber ihrer Zuhörerschaft, als halte sie selbst einen Bezug zu ihrer Reputation jedoch für belanglos, gar für lächerlich. Wenn der Leser nun vielleicht denkt, daß die Torheit so die Tatsache herunterspielen will, daß sie an einem völlig unbedeutenden Ort zur Welt gekommen ist, so sieht er sich getäuscht. Denn nachdem Stultitia die außergewöhnlichen und berühmten Geburtsstätten anderer Götter vorweg als nicht den ihrigen darstellt, und so gleichermaßen die negative Erwartungshaltung des Lesers auf die Spitze treibt, folgt eine überraschende und triumphale Wendung: es sind die "Inseln der Glückseligkeit selbst"(11), auf denen Stultitia das Licht der Welt erblickt hat.
Dies sind die Inseln der ewigen Jugend, die Heimat ihrer Mutter, unbeschwert von Mühen und Krankheit, Ort der Fruchtbarkeit und Fülle der Natur35. Es ist kein Zufall, daß Erasmus die Torheit ausgerechnet hier zur Welt kommen läßt, denn die Qualitäten dieses Ortes stimmen überein mit Stultitias Wesen.
Als Ort der Schönheit, Jugend und Fülle sind die Inseln die
"Stätte des primitiven Lebensgenusses oder der Weltlust schlechthin im Gegensatz zum Streben nach Weisheit oder der Sehnsucht der Seele nach der Heimkehr zu Gott."36
Es klingt die Vorstellung vom irdischen Paradies an, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden, weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Dies findet seine Entsprechung im Goldenen Zeitalter der Antike. Stultitia selbst kommt an späterer Stelle im Zusammenhang mit der von ihr behaupteten natur-gegebenen Torheit des Menschengeschlechts ausdrücklich darauf zu sprechen. Sie argumentiert, daß auch in der antiken Mythologie die Entdeckung der Wissenschaften und Künste das Goldene Zeitalter beendet, den "Sündenfall" der Menschheit darstellt:
"So sind die Wissenschaften und Künste mit allem übrigen Unheil in das menschliche Leben eingedrungen und kommen von den Urhebern aller Widerwärtigkeiten, den Dämonen, die ihre Namen sogar diesem Umstande verdanken, indem der griechische Name ja "Wissende" bedeutet. Im Goldenen Zeitalter war die Menschheit ja auch harmlos und frei von dem Rüstzeug der Wissenschaften und Künste, lebte nur im Vertrauen auf ihren natürlichen Instinkt.(40)"37.
Ein "Paradies" sind die Inseln der Seligen aber noch in anderer Hinsicht. Sie sind nämlich der weltentrückte Ort, an dem die göttlichen Heroen, die Halbgötter des vierten Menschenalters nach ihrem Tod ein glückliches und sorgenfreies Leben führen38. Stultitia stellt sich also obendrein auch noch in eine Reihe mit ruhmreichen, verdienstvollen und angesehenen Helden und Halbgöttern.
Im Anschluß an die Schilderung ihres Geburtsortes nennt Stultitia ihre Nährmütter: Trunkenheit und Beschränktheit, und ihre in ihren Diensten stehenden Jugendgenossen: Eigenliebe, Schmeichelei, Vergessen, Trägheit, Vergnügen, Wahnsinn, Ergötzen, Ausgelassenheit und Siebenschläfer (12).
Einen interessanten Hinweis auf die Qualität dieser Gefolgschaft gibt Walter Kaiser:
"If they sound more like a gang of juvenile delinquents than fit playmates of a goddess, that of course is intentional. Foolery and roguery ["Schurkerei/ Schelmerei"!] go hand in hand, and it is only to be expected that the greatest fool of all should travel in the company of the deadly sins, now expanded from seven to eleven."39
Diese dubiosen Gesellen und Mitstreiter der Torheit stellen sich im Verlauf der Lobrede als die wahren Freunde der Menschen heraus: die Todsünden werden zu Tugenden!
4.3 Die Masken der Torheit
Wie auch in denjenigen Schelmenromanen, die autobiographisch in der ersten Person geschrieben sind, herrscht in der Lobrede eine tiefe Kluft zwischen erzählendem und erzählten Ich. Während in den Schelmenromanen diese Spannungen auch daher rühren, daß der gealterte Schelm rückschauend über den jugendlichen Schelm berichtet, liegen die Spannungen im Enkomium im zeitlosen Charakter der Stultitia begründet, die als Allegorie der Torheit scheinbar töricht über sich selbst spricht. Die Schelme stellen als scheinbare Einfaltspinsel ebenfalls Verkörperungen der Torheit dar, allerdings als reale Personen, die an Zeit, Ort und Mitmenschen gebunden sind und konkrete Abenteuer erleben. Ihre Schilderungen weisen meist topographisch und historisch genaue Fakten auf. Stultitia, die Torheit, ist den Dimensionen Zeit und Raum entrückt: sie beherrscht die gesamte Welt zu allen Zeiten. Das Lob der Torheit als literarisches Werk ist dagegen natürlich Zeit und Ort seiner Entstehung verhaftet, denn Erasmus kritisiert auf abstrakte Weise konkrete Mißstände.
Hier wie dort versucht ein subjektives Ich, sich objektiv darzustellen. Diese Problematik wird noch potenziert, da ein greifbares, charakterlich festlegbares "Ich" überhaupt nicht existiert: der Schelm, wie auch Stultitia, tritt stets in Masken auf, wer sich hinter diesen Masken verbirgt, bleibt unklar40.
Bei der Torheit handelt es sich um ein Abstraktum, das unterschiedliche Versinnlichungen zuläßt41. Diese Vielfältigkeit des Torheit-Begriffes gilt zum Einen für das Treiben der irdischen Narren. Torheit ist beispielsweise jene "harmlose" Dummheit und Töpelhaftigkeit, die andere Menschen zum Lachen bringt. Sie meint ferner die zeitweilige Leidenschaft, von der ein ansonsten als weise Geltender plötzlich übermannt wird. Sie kann aber genausogut die Unerfahrenheit des Wissenschaftlers in alltäglichen Dingen bedeuten, dünkelhaften Wissensstolz, und, letztendlich, die Torheit des Kreuzes.
Zum Anderen wechselt auch und gerade Stultitia selbst im Verlauf der Rede ihre Masken42. Im ersten Teil der Rede tritt Stultitia als heiter über Welt und Leben philosophierende antike Göttin auf. Sie preist sich als Spenderin des Lebens und der Lebensfreude, als Schöpferin aller wichtigen Errungenschaften von Zivilisation und Kultur, als die Verkörperung wirklicher Weisheit und damit Ursache wahren menschlichen Glücks, als das vitale Lebensprinzip schlechthin.
Im zweiten Teil der Rede, der Ständerevue, wandelt sie sich dann zu einer schonungslosen Kritikerin und Satirikerin.
Hudson äußert über die Figur Stultitia:
"At times she seems to be on the way to become a character; but usually she is a puppet, and at times is forgotten completely by author and reader"43,
In Vergessenheit gerät die Sprecherfiktion insbesondere in den Angriffen auf Gelehrte und Kleriker. Der amüsierte Spott des ersten Teils weicht bissigem Tadel und Sarkasmus, aus dem Lob wird eine Anklage. Nur mit Mühe erhält Stultitia ihre Maskerade des ersten Teils aufrecht, wenn sie ihren schon zornigen Angriffen Sätze einflicht wie "Jedenfalls haben diese Menschen durch mich ein angenehmes Leben..." (68f), oder "Ich könnte mir keine jämmerlichere Lage denken, wenn ich ihnen nicht nach Kräften unter die Arme griffe" (77). Der Leser gewinnt allerdings den Eindruck, daß sie dies nur noch der Form halber tut, es fehlt die Überzeugungskraft des ersten Teils.
Wenn sie abschließend äußert, sie wolle nicht den Eindruck eines Satirikers statt eines Enkomiasten machen (92), und sagt: "Ich habe das nur kurz gestreift, um zu zeigen, daß kein Mensch ohne meine Weihe und Gunst ein angenehmes Leben führen kann" (92), so ist dies eine glatte Lüge. Oder besser: eine Ironie, die hier tatsächlich das Gegenteil meint. Denn auf den immerhin über 30 Seiten dieses zweiten Hauptteils der Rede - und das kann man wahrhaftig nicht als "kurz" bezeichnen -, hat sie sehr wohl die Position einer Satirikerin eingenommen. Hier ist Stultitia als Sprachrohr des Erasmus zu erkennen, mittels dessen er seine Zeit- genossen attackiert. Sie selbst ist der von ihr angeführte "naseweise[ ] Beobachter", der "das ganze tragische Gehabe auf witzige Art der Lächerlichkeit preisg[ibt]" (86).
Im letzten Teil tritt die Torheit dann als christliche Gottesgelehrte auf und erobert als Torheit des Evangeliums und der mystischen Ekstase die letzte und höchste Bastion: die Heilige Schrift. Ihre Herkunft aus der antiken Götterwelt gerät dabei vollends in Vergessenheit. In einer gewagten Bibelauslegung, mit einer Flut von Bibelversen, beweist sie, "gefährlich nahe an Blasphemie"44 grenzend, die Torheit als Weisheit vor Gott, als Grundbedingung christlicher Verwirklichung überhaupt. Dies ist zunächst eine Parodie auf die scholastische Handhabung der Schriftauslegung. Die Frage, was darüberhinaus ernst gemeint ist und was nicht; ob und inwieweit Stultitias Ansichten hier mit denen des Theologen Erasmus identisch sind, ist besonders in diesen Passagen umstritten45. Gerade an dieser Stelle demonstrieren die Uneinigkeiten in den Interpretationen, welche Irritation die schelmische Ironie der Stultitia bei ihren Lesern hervorruft46. Eines jedoch ist offensichtlich: der abrupte Abbruch der Rede, der jedes harmonische Ausklingen oder förmliche Ende vermissen läßt, beendet zwar den Diskurs der Stultitia, nicht aber den Diskurs im allgemeinen. Das Problem steht im Raum, der Leser ist angehalten, nachzudenken und sich selbst eine Meinung zu bilden47.
4.4 Die sympathische Torheit
Wenn es auch nicht gelingt, hinter ihren Masken die Person Stultitia auszumachen, so läßt sich dennoch zumindest über sie sagen - und auch diese Eigenschaft teilt sie mit den Schelmen -, daß sie nicht bösartig und gewalttätig ist. Sie selbst markiert den wesentlichen Unterschied:
"Es gibt wirklich eine zweifache Art Unverstand, eine, die die Rachegöttinnen immer aus der Unterwelt schicken, wenn sie mit ihren schlangendrohenden Häuptern die Hitze des Krieges, unersättlichen Golddurst, schändliche und ruchlose Liebesleidenschaft, Meuchelmord, Blutschande, Kirchenschändung oder ähnliches Unheil über das menschliche Herz verhängen oder aber das schuldbeladene Gewissen mit Raserei und Fackeln des Schreckens jagen. Die andere Art Unverstand unterscheidet sich sehr davon und ist von allen besonders begehrt, wohl weil sie von mir ausgeht. Sie wird euch zuteil, sooft eine liebenswürdige Täuschung den Geist von Ängsten und Sorgen frei macht und ihn mit vielfältiger Lust beglückt." (47)
Auch hier steht wieder das glückbringende Wesen der Torheit im Vordergrund, das zentrale Stichwort ist die "liebenswürdige Täuschung", mittels derer die Menschen das Elend der Welt vergessen dürfen. Mit dem wahrhaft Bösen, dem Wahnsinn, den menschlichen Abgründen will die Torheit nichts zu tun haben48. Dies korrespondiert mit dem Wesen der Schelme, die zwar ihren Mitmenschen Streiche spielen, oftmals Diebe sind, aber niemals, z.B. als Mörder, wirkliches Verderben über sie bringen. Dennoch ist Stultitia als Schelmin keine eindeutig positive Figur. Dies wäre sie, wenn es sich bei ihrer Torheit lediglich um eine Maske handelte, hinter der sich eine ausnahmslos weise Person versteckt.
"The main difficulties with the view are that it claims for Folly a consistency which, as has been pointed out, does not exist, and for Erasmus a power of dramatic conception which was denied him."49
Tatsächlich weiß der Leser so gut wie nie, wann die Torheit der Stultitia echt, und wann sie nur gespielt ist. Die Sympathie der Stultitia rührt daher, daß sie die Diskreditierung der Weisheit und ihr Eigenlob auf humorvolle Weise mit bestechend-verführerischen Argumenten betreibt.
"Es wird alles daran gesetzt, um die Position [...] der Torheit, wenngleich im Schein, zu stärken. Gerade dadurch entsteht der Eindruck der Zwiespältigkeit [...], da die ironische Enunziation nach Aufhebung des Scheins nie zur Tatsächlichkeit zurückgeführt wird und so eine endgültige Objektivierung erfährt."50
Die völlige Umkehrung bzw. Infragestellung verbindlicher Werte und Normen, bzw. die Verweigerung einer letztgültigen Wahrheit irritiert selbst den aufgeschlossenen Leser. Demjenigen Leser, der sich nicht auf dieses Spiel mit der Wahrheit einlassen will oder kann, mag Stultitia deswegen gar gefährlich erscheinen.
Schultz erkennt in der Haltung des Erasmus gegenüber seinem Geschöpf ebenfalls eine positive Komponente. Aus der Schrift spricht nicht etwa die Verbitterung des Gelehrten:
"[Erasmus] weiß um die Schwäche der Weisheit sowie um die Stärke der Torheit - und lächelt. Das "Lob der Torheit" ist mehr als zaghafte Verstellung, viel eher Verehrung des ihm Verwehrten, der Torheit, des stärkeren Gegners."51
V. Die Stoßrichtung des Enkomiums
5.1 Bildungsparodie
Vielfach geben literarische Schelme ihre Erlebnisse und Ansichten in einem gelehrten Stil wieder, der ihre scheinbare Einfalt und Dummheit Lügen straft. Eine solche Ausdrucksweise kennzeichnet in außerordentlichem Maße auch das Enkomium. Da Stultitia die Verkörperung der Torheit schlechthin darstellt, wirkt der Gegensatz zwischen Inhalt und Form der Aussagen umso irritierender.
Bereits die Redesituation ist eine Anspielung auf das Gebaren der gelehrten Welt. Wie ein Akademiker vor sein Auditorium tritt die Stultitia vor ihre Zuhörer, um eine "Lehrrede" (declamatio) zu halten52. Die Provokation besteht in Person und Anliegen der Rednerin: die personifizierte Dummheit hält vor Weisen und im Stil der Weisen eine Lobrede auf sich selbst.
Den "akademischen Ernst" wischt sie dabei allerdings sogleich vom Tisch, indem sie ihre Zuhörer auffordert, ihr wie "den Spielleuten, Possenreißern und Narren [...], mit sogenannten Midasohren"(7), also Eselsohren, zuzuhören53.
Nicht allein die Redesituation, auch die gesamte Lobrede ist eine Parodie auf akademische Formen. Das Enkomium befolgt bereits im Aufbau die Vorschriften der aristotelisch-scholastischen Rhetorik54. Unter diesem Aspekt gewinnen auch die Schilderungen der Stultitia über ihre Herkunft eine neue Dimension. Sie hält sich genau an die inhaltlich-formalen Vorgaben für eine Lobrede auf eine Person55.
Noch vor ihrer eigentlichen Selbstdarstellung äußert die Torheit sich abfällig über jene Ehrenmänner und Weisen, die sich gegen Geld einen Lobredner bestellen (8), und noch stolz darauf sind,
"..., wenn der Lobhudler den Nichtsnutz zu einem Gott macht, wenn er ihn als höchstes Muster aller Tugenden hinstellt, von dem er sich doch selbst meilenweit entfernt weiß, wenn er seine Helmzier mit fremden Federn schmückt, wenn er eine Mohrenwäsche und geradewegs aus der Mücke einen Elefanten macht."(8)
Damit rechtfertigt Stultitia ihr "bescheideneres" Eigenlob, um in ihrer Lobrede dann selbst zu tun, was sie vorher an den Lobrednern kritisiert hat, und zwar nach allen Regeln der Kunst.
Das parodistische Element im Enkomium tritt außer in Redesituation und Gliederung noch greifbarer zu Tage in den zahllosen gelehrten Zitaten, Sprichwörtern und Anspielungen, mittels derer Stultitia ihre Ausführungen untermauert. Auch hier operiert sie mit
"all den gelehrten Mätzchen, die sie bloßstellen will. Sie brilliert mit Zitaten und Anspielungen, daß dem Leser der Kopf brummt und er gar nicht mehr weiß, was es überhaupt zu beweisen gilt."56
Stultitia macht sich sowohl durch direkte Benennung der Mißstände57, als auch indirekt durch bloßstellende Vorführung über die geschulten Methoden der Gebildeten lustig. Dabei nimmt sie sich durchaus selbstironisch aufs Korn, wenn sie sich etwa nach einer Flut aneinandergereihter Sprichwörter selbst zur Räson ruft:
"Doch ich will nicht weiter Sprüchlein machen, sonst komme ich noch in Verdacht, die "Adagia" meines Erasmus geplündert zu haben." (92f)58
5.2 Religionskritik und Gelehrtensatire
Im ersten Teil ihrer Rede, wenn sie über die allgemeinen Torheiten spricht, macht sich Stultitia u.a. lustig über die "Liebhaber lügenhafter Wunder und Weissagungen" (51), über jene,
"..., die sich bei trügerischem Ablaß in Sicherheit wiegen und die Fegefeuerstrafen gleichsam mit der Wasseruhr mathematisch genau und untrüglich nach Jahrhunderten, Jahren, Monaten, Tagen und Stunden abmessen" (51),
oder über den volkstümlichen Heiligenkult (52). Abschließend weist sie darauf hin, das dieser "Aberwitz"(53), aus gutem Grund gerade von den Priestern gestattet und gefördert werde, da die "vernünftige" Mahnung zu einem christlichen, gottesfürchtigen Leben den Menschen nur verwirre und unglücklich mache. Sie thematisiert damit religiöse Praktiken, die Aberglauben anstelle wahrer Frömmigkeit demonstrieren.
Wenn Stultitia dieses Gebaren hier noch spöttisch belächelt, so ändert sich ihr Ton im zweiten Teil der Rede. Der eigentliche Angriff gilt den Vertretern der Bildung und den Klerikern als Religionsvermittlern. Für Erasmus sind Bildung und Religion nicht voneinander trennbar59, beispielsweise im Stand der Theologen treffen ohnehin beide zusammen.
Stultitia beginnt ihre Rede bereits mit einem Seitenhieb auf die Gelehrten, wenn sie ihr Anliegen wie folgt beschreibt:
"Ich möchte mit euch ein wenig Sophisterei betreiben, will es aber nicht machen wie gewisse Zeitgenossen, die ihre läppischen Angstgebilde Kindern aufdrängen und mehr als weibische Zanksucht zur Mode machen. Lieber will ich mich an die Alten halten, die sich Sophisten nennen ließen, um der fragwürdigen Bezeichnung eines Weisen aus dem Wege zu gehen." (8)
Den Beginn ihrer Selbstdarstellung unterbricht sie nochmals mit einem vorwegnehmenden Exkurs über jene, "die für sich besonders nachdrücklich Maske und Titel der Weisheit in Anspruch nehmen" (9), die sie dann explizit bezeichnet als "die Töricht-Weisen [...], da sie doch in Wirklichkeit überaus töricht sind, aber weise wie Thales erscheinen wollen" (10).
Bezeichnend ist dann die Auswahl der Personenkreise im zweiten Teil der Rede. Nachdem Stultitia die Ständesatire mit einem vergleichsweise kurzen Kapitel über die Kaufleute eingeleitet hat, spricht sie:
"Ich wäre aber selbst törichter als alle [...], wenn ich weiter die Erscheinungen eingebürgerter Wahnvorstellungen und Torheiten aufzählen wollte. Ich will mich zu jenen wenden, die in der Welt die Weisheit vorstellen und den sogenannten Weisheitszweig des Aeneas für sich in Anspruch nehmen."(64)
Dann knöpft sie sich nacheinander zunächst die Vertreter der weltlichen und geistlichen Gelehrsamkeit: Grammatiker, Dichter, Redner, Schriftsteller, Juristen, Philosophen, Theologen und Mönche vor. Dann, nach einem Kapitel über die Könige und Fürsten, widmet sie sich dem ordinierenden Klerus: Päpste, Kardinäle und Bischöfe und Leutpriester. Wie eingangs die Kaufleute, so werden auch die Könige und Fürsten vergleichsweise kurz, gleichwohl scharfzüngig, abgehandelt, um der Form der Ständesatire genüge zu tun. Den übrigen, zahlreichen weltlichen Ständen widmet Stultitia keinerlei Aufmerksamkeit.
Damit nimmt Erasmus gegenüber den vorangegangenen katalogisierenden Ständesatiren eine entscheidende Gewichtung vor60. Die Ausfälle der Stultitia gelten den Repräsentanten der geistlichen und weltlichen Bildungselite und bilden somit eine Gruppe, "die als eigenständiges Objekt eines satirischen Angriffs zuvor noch niemals in Erscheinung getreten war."61 Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Gruppen demonstrieren sie einheitlich Verfehlungen gegen das Bildungs- und Frömmigkeitsideal:
"Erasmus geht es [...] nicht primär darum, typische Ständelaster aufzuspüren oder gesellschaftliche Mißstände anzuprangern, die sich in solchen Lastern konkretisieren. Stattdessen attackiert er die Gelehrten, Mönche und Geistlichen, weil sie ihrer Aufgabe, Frömmigkeit, Moral und Bildung zu fördern, nicht mehr gewachsen sind, da sie aus allem, was sie lehren und tun, den lebendigen Geist vertrieben haben. [...] Sie alle haben über der Form den Inhalt vergessen oder umgeben sich mit totem Wissensstoff, der ihnen den Blick auf die lebendige Wirklichkeit um sie herum versperrt."62
Es ist die "Selbstgefälligkeit und Anmaßung eines säkularen Menschenbildes"63, die sich in diesem Teil des Lobes spiegelt. Erasmus wendet sich mit seiner Schrift als Gelehrter an Gelehrte. Das Enkomium ist eine Aufforderung an die Gebildeten, ihre Einstellung zur Bildung und Religion selbstkritisch zu überprüfen.
VI. Episodik
Der Aufbau des Enkomiums markiert einen wesentlichen Unterschied zu den Schelmenromanen. Der Schelmenroman ist konstatiert durch seine Episodik: die Abenteuer des Protagonisten ließen sich beliebig fortsetzten, sein Lebenslauf ist unorganisch, er durchlebt keine innere, zielgerichtete Wandlung.
Betrachtet man die Ständesatire der Lobrede isoliert, so besteht hier durchaus ein episodisches Moment, insofern die Torheit einen Stand nach dem anderen vor ihrem geistigen Auge vorbeiziehen läßt. Ergänzungen sind hier denkbar und wurden auch tatsächlich von Erasmus vorgenommen64. Das Enkomium ist aber nicht primär zur Unterhaltung verfaßt. Das Eulenspiegel-Volksbuch beispielsweise stellt eine regelrechte Ständekritik um ihrer selbst willen dar, in der die einzelnen Kapitel im allgemeinen inhaltlich doch für sich stehen und weitere Kapitel beliebig hinzugefügt werden können. Hier werden auch eher die niederen Stände, insbesondere auch die der von Erasmus völlig außer Acht gelassenen Handwerker, aufs Korn genommen.
Die erasmische Ständesatire dagegen, wie schon gezeigt, dient nicht dazu, einzelne Ständelaster anzuprangern, sondern ist dem Zweck untergeordnet, veräußerlichte Religion und Gelehrsamkeit im Allgemeinen, wenngleich in unterschiedlichsten Ausprägungen, anzuprangern. Die "Beweisführung" ist zwar im Einzelnen ergänzbar, aber doch im Wesentlichen abgeschlossen.
Betrachtet man das Enkomium als Gesamtwerk, so verbietet sein Schluß, der gleichzeitig seinen Höhepunkt bildet, grundsätzlich eine Fortsetzung. Ob nur zum Schein oder tatsächlich gemeint, Stultitia hat sich zur Torheit des Kreuzes empor- gehoben und damit eine endgültige Wandlung vollzogen - auch wenn sie mit ihren letzten Worten dieses Podest vermeintlich selbst wieder umstößt, indem sie sich ihren Zuhörern als die scherzende Torheit in Erinnerung ruft, die ihre eigenen Worte so wenig ernst nimmt, daß sie sich ihrer noch nicht einmal erinnert:
"Ich sehe, ihr wartet auf ein Nachwort. Ihr seid aber nicht recht gescheit, wenn ihr annehmt, ich könnte mich nach solch kunterbuntem Allerlei noch meiner Worte erinnern. [...] Lebt also wohl, klatscht Beifall, lebt und trinkt, ihr hochgepriesenen Mysten der Torheit!"(112)
VII. Schlußbemerkungen
Das Lob der Torheit weist in mehrerer Hinsicht, formal wie inhaltlich, Entsprechungen zu den im Seminar behandelten Schelmenromanen auf. Die entscheidende Übereinstimmung besteht in dem Strukturprinzip der ironischen Doppeldeutigkeit. Der Leser bleibt im unklaren darüber, wann die Torheit als Weisheit wahr, wann als Torheit töricht spricht, und wer sich eigentlich hinter der Torheit verbirgt. Wie der Schelm, stellt auch sie für selbstverständlich genommene Werte auf den Kopf, durchbricht überkommene Denkstrukturen und zwingt so den überraschten Leser zum Nachdenken.
Von ihrer olympischen Warte aus betrachtet sie das närrische Treiben auf Erden als unbeobachtete Beobachterin. Wie der Schelm unter den Menschen, so ist sie unter den Göttern jedoch von niedrigem Rang. Ihre ungewöhnlich-gewöhnliche und gleichzeitig illegitime Geburt kompensiert sie durch hochstaplerische Anmaßung der Weltherrschaft. Dabei ist die Herrschaft der Torheit hier auch explizites Thema der Schrift. Auch wenn sich die Abstammumg der Stultitia vordergründiger so interpretieren ließe, daß es Erasmus darauf ankam, die Torheit allegorisch als Kind des Reichtums und der Jugend darzustellen, so sind die Parallelen zum Schelm m.E. zu deutlich.
Während der Gegner der konventionellen Satire einseitig negativ beurteilt und bloßgestellt wird, trägt Stultitia eindeutig positive Züge. Sie verfügt über verführerischen Charme und hinter ihren äußerungen verbergen sich tiefe Wahrheiten. Ist die Lobrede eine "ironische Spielerei", dann in der Hinsicht, daß dieses Spiel gleichzeitig den Ernst beinhaltet. Erasmus hat mit der Lobrede gleichsam einen abstrakten Schelmenroman geschrieben, wenn auch in abgeschlossener Form und mit thematischer Schwerpunktsetzung. Die allgemein- menschlichen Torheiten werden eher spöttisch belächelt, die Verfehlungen der "Töricht-Weisen", der Geistlichen und Gebildeten, dagegen scharf getadelt. Beider Narrheit wird gleichwohl schonungslos bloßstellt.
Literatur
Augustijn, Cornelis: Erasmus von Rotterdam. Leben - Werk - Wirkung. Aus d. Holländ. übers. v. Marga E. Baumer. München: Beck, 1986.
Colie, Rosalie L.: Problems of Paradoxes. In: Twentieth Century Interpretations of The Praise of Folly. A Collection of Critical Essays. Hg.v. Kathleen Williams. New Jersey: Prentice Hall, 1969. S.92-97.
Dean, Leonard F.: The Praise of Folly and Its Background. In: Twentieth Century Interpretations of The Praise of Folly. A Collection of Critical Essays. Hg.v. Kathleen Williams. New Jersey: Prentice Hall, 1969. S.40-60.
Eckert, Paul Willehad: Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. 2 Bde. Bd I: Der humanistische Theologe. Köln: Wienand, 1967 [=Zeugnisse der Buchkunst 4].
Erasmus von Rotterdam: Das Lob der Torheit. Enkomium Moriae. übersetzt und herausgegeben von Anton J. Gail. Stuttgart: Reclam, 1996 [=Universal- Bibliothek 1907].
Gail, Anton J.: Nachwort. In: Erasmus von Rotterdam: Das Lob der Torheit. Enkomium Moriae. übersetzt und herausgegeben von Anton J. Gail. Stuttgart: Reclam, 1996. S.127-136.
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. Hg., mit Anmerkungen u. einer Zeittafel versehen v. Alfred Kelletat. Vollst. Ausgabe nach dem Erstdruck von 1668 und der Continuatio von 1669. München: dtv, 199513 [=dtv 2004].
Hudson, Hoyt H.: The Folly of Erasmus. In: Twentieth Century Interpretations of The Praise of Folly. A Collection of Critical Essays. Hg.v. Kathleen Williams. New Jersey: Prentice Hall, 1969. S.21-39.
Huizinga, Johan: Europäischer Humanismus: Erasmus. Hamburg: rowohlt, 11958 [=rowohlts deutsche enzyklopädie 78].
Jensma, Goffe: Erasmus von Rotterdam 1469-1536. In: Erasmus von Rotterdam. Die Aktualität seines Denkens. Hg.v. Jan Sperna Weiland; Wim Blockmans; Willem Frijhoff. Ins Dt. übertr. v. Annemarie Hübner. Hamburg: Wittig 1988. S.9-56.
Könneker, Barbara: Satire im 16.Jahrhundert. Epoche-Werk-Wirkung. München: Beck, 1991 [=Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte].
Könneker, Barbara: Wesen und Wandlung der Narrenidee im Zeitalter des Humanismus. Brant - Murner - Erasmus. Wiesbaden: Steiner, 1966.
Leben und Wandel Lazaril von Tormes. Und Beschreibung, was derselbe für Unglück und Widerwärtigkeit ausgestanden hat. Verdeutscht 1614. Hg.v. Manfred Sestendrup. Nachwort v. Gisela Noehles. Stuttgart: Reclam, 1979 [=Universal-Bibliothek 1389].
Mann, Thomas: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil. Frankfurt: Fischer, 1996.
Schmidt-Dengler, Wendelin: Einleitung. Das Lob der Torheit. In: Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften. Ausgabe in acht Bänden. Lateinisch und Deutsch. Hg.v. Werner Welzig. Bd II: Moriae Enkomion sive Laus Stultitiae. Das Lob der Torheit. übers. v. Alfred Hartmann. Carmina Selecta. Auswahl aus den Gedichten. übers. v.Wendelin Schmidt-Dengler. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Wendelin Schmidt-Dengler. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. S.9-30.
Schultz, Uwe: Nachwort. In: Erasmus von Rotterdam. Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen von Hans Holbein d.J. übers.u.hg.v. Uwe Schultz. Sonderausgabe der Sammlung Dietrich. Bremen: Schönemann, 1966. S.113- 125.
Schwab, Gustav: Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. Mit einer Einleitung von Karl-Heinz Ebnet. Kehl: SWAN, 1993 [=Die Deutschen Klassiker 12].
Twentieth Century Interpretations of The Praise of Folly. A Collection of Critical Essays. Hg.v. Kathleen Williams. New Jersey: Prentice Hall, 1969.
Jensma, Erasmus, S.55
Die in den laufenden Text in Klammern gesetzten Seitenangaben der Zitate beziehen sich auf die im Literaturverz. angef-hrte Reclam-Ausgabe (hg.u.-bers.v. Anton J. Gail).
Barbara K”nneker beschreibt das Enkomium als "leicht und witzig gef -hrte, aber keineswegs vordergr-ndige Er”rterung -ber das Wesen des Gl-cks im Verh„ltnis zur Weisheit und Torheit" (K”nneker, Narrenidee, S.272) und er”rtert die philosophischen und theologischen Aspekte dieser Fragestellung (vgl.ebd., ff). Huizinga, Humanismus, S.67.
Vgl. ebd., S.69f
Kaiser, Ironic Mock Enkomium, S.78
Vgl. z.B. ”nneker, Satire, S.90; Schmidt -Dengler, Einleitung, S.18.
Vgl. Hudso , Folly of Erasmus, S.30ff.
Huizinga, Humanismus, S.67
Dies bedeutet nicht, daß die Reformtheologen, insbesondere Luther, Erasmus gewogen waren. Erasmus verneinte den revolution„ren Geist, durch den er Bildung und gesellschaftlichen Fortschritt gef„hrdet sah. Als eher gem„ßigter Reformtheologe hatte er sich nie von der alten Kirche trennen wollen. W„hrend die Katholiken in ihm den Wegbereiter Luthers sahen, vermißten die Evangelischen an ihm ein klares Bekenntnis (vgl. Gail, Nachwort, S.127; S.129). Zu seiner Auseinandersetzung mit Luther -ber den freien Willen, den Luther abstritt, vgl. Augustijn, Erasmus von Rotterdam, Kap.XI: Der Streit -ber die Willensfreiheit, S.121-130.
Vertreter der Franziskaner und Dominikaner hatten einen ganzen Katalog von Irrt-mern und Ketzereien in den Werken Erasmus' ausgemacht. Eine 1527 schon anberaumte Konferenz zwecks Er”rterung dieser Aff„re wurde wegen drohender Pestgefahr auf unbestimmte Zeit vertagt, fand aber nicht mehr statt. Zudem stand Erasmus unter dem Schutz m„chtiger Pers”nlichkeiten, u.a. ausgerechnet des Großinquisitors und Erzbischofs von Sevilla wie auch des Kaisers. Vgl. Augustijn, Erasmus von Rotterdam, S.138.
Vgl. ”nneker, Narrenidee, Anm.65, S.296.
Hudson, Folly of Erasmus, S.33
Zum Folgende vgl. Jensma, Erasmus, S.54.
Jensma, Erasmus, S.54
Dean, Background, S.53f
”nneker, Satire, S.95. K”nneker sieht darin insbesondere auch einen Angriff auf die "Sic et Non"- Methodik, eben das "Entweder-Oder" der mittelalterlichen Scholastik (vgl. K”nneker, Narrenidee, S.291ff.
Vgl. ”nneker, Satire, S.95.
”nneker, Narrenidee, S.255.
Zur Frage der Datierung des Widmungsschreibens vgl. Schmid -Dengler, Einleitung, S.10.
Dabei er„hnt er u.a. den Eselsroman des Apulejus (4).
Vgl. Sestendru (Hg), Lazaril, Vorrede, S.7f.
”nneker, Narrenidee, S.262.
Ebd
Ebd., S.259
Eckert, Werk und Wirkung, S.132
Obwohl sie es sich nicht verkneifen kann, wenigstens Anspielungen zu machen, die die Identit„t einer konkreten Person dennoch preisgeben. Hierbei handelt es sich, wie bei der Anspielung auf den Theologen Nikolaus Lyranus (98) aber zumeist um Personen, die lange vor Erasmus' Zeiten gelebt haben, also nicht um pers”nliche Angriffe. Allerdings weiß der zeitgen”ssische Leser nat-rlich genau, wenn Stultitia meint, wenn sie sich an anderer Stelle -ber kriegf-hrende P„pste beklagt(89f), n„mlich den papa terribile Julius II. (1503-13).
Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.88
Vgl. Grimmelshausen, Simplicissimus, S.7ff
Kaiser verweist in diesem usammenhang auf den literarischen Topos des locus amoenus. Vgl Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.88.
”nneker, Narrenidee, S.263.
Vgl. ebd
Es sind die Helden, die vor Theben sowie bei der Schlacht um Troja ums Leben kamen. Ihr Ende l„utete das Zeitalter des f-nften und letzten, des eisernen und verderbten Menschengeschlechts ein. Vgl. Schwab, Sagen, S.11f.
Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.89 (Hervorhebungen von mir)
"Verkleidet also war ich in jedem Fall, und die unmaskierte Wirklichkeit zwischen den beiden Erscheinungsformen, das Ich-selber-Sein, war nicht bestimmbar, weil tats„chlich nicht vorhanden." Mann, Felix Krull, S.238.
Vgl. Schmid -Dengler, Einleitung, S.18.
Zum Folgenden vgl. ”nneker, Satire, S.91ff.
Hudson, Folly of Erasmus, S.3
”nneker, Satire, S.99.
”nneker und Schmidt -Dengler schließen bei Erasmus, auch mit Hinweisen auf andere Werke Erasmus und die geplante Trilogie des Lobes der Natur, der Torheit und der Gnade, auf ein positives Verst„ndnis christlicher Torheit (vgl. K”nneker, Narrenidee, u.a. S.317f; Schmidt-Dengler, Einleitung, S.21f). Dagegen warnt Huizinga davor, ohne jedoch den Passagen einen tiefen Hintergrund abzusprechen, die Lobrede "allzu ernst" zu nehmen: "Denn dies muß so nachdr-cklich wie m”glich festgehalten werden, daß das [Moriae Encomium] echter, fr”hlicher Scherz ist" (Huizinga, Humanismus, S.69).
Und gerade dies bes„rkt die Annahme, daß Erasmus die Torheit des Kreuzes ernst meint und die Lobrede auf diese letzten Passagen hin konzipiert hat. So konnte und sollte das eigentliche und letztendliche Hauptanliegen Erasmus, im Mund der Stultitia zum Scherz degradiert, dennoch ausgesprochen und der Vorwurf der Blasphemie mit Verweis auf die Sprecherin abgewendet werden. Vgl. Colie, Problems of Paradox s, S.96.
”nneker macht hier einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Enkomium und den Narrendichtungen Murners und Brants aus. Fast schon vorwurfsvoll merkt sie an, daß Erasmus das B”se und Teuflische bewußt verbannt und "nicht gewillt ist, sich intensiver mit der eigentlichen Problematik menschlicher Existenz einzulassen" (K”nneker, Narrenidee, S.262). Damit weise er jede Erziehungsabsicht zur-ck und verleihe dem Enkomium den Charakter einer rein akademischen Er”rterung, aus der nur Gleichrangige und geistig Hochstehende Gewinn ziehen k”nnten (vgl.ebd).
Hudson, Folly of Erasmus, S.3
Schmid -Dengler, Einleitung, S.14.
Schultz, Nachwort, S.120
Bezeichnend ist die bildliche Darstellung dieser Situation durch Holbein. In seiner Zeichnung spricht Stultitia von einer Kanzel herab. Zudem tr„gt sie als parodierendes Attribut die narrentypische Schellenkappe.
Damit meint sie vielleicht die Eselsohren tat„chlich als bildliches Symbol und Erkennungszeichen der Dummheit und Narrheit. Denkt man aber an dem Mythos, wie Midas zu seinen Eselsohren kam, so er”ffnet sich dar-berhinaus eine tiefgr-ndigere und m.E. reizvollere Interpretation. Beim musikalischen Wettstreit zwischen dem Herausforderer Pan und Apollo widerspricht einzig Midas dem richterlichen Urteil, welches zugunsten Apolls ausgefallen war, woraufhin Apoll ihm zur Strafe die Eselsohren anzaubert (Ovid, Metamorphosen XI; vgl. Erasmus, Lob der Torheit, Anm.3, S.114.). Die "Dummheit" des Midas besteht also darin, die Wahrheit zu sagen, bzw. eine andere Wahrheit als die allgemein anerkannte zu „ußern. Letztlich ist es das dominierende Prinzip der gesamten Lobrede, feststehende Wahrheiten in Frage zu stellen und umzukehren. Von daher ist Stultitias Forderung nach den Midasohren vielleicht eher der versteckte Aufruf zu einer entsprechenden Geisteshaltung, n„mlich Offenheit f-r andere Wahrheiten.
Vgl. Hudson, Folly of Erasmus, S.23f. Formale Entsprechungen im Gesamtaufbau der Lobrede weist auch Walter Kaiser nach. Bei ihm findet sich eine Kurz-bersicht der Gliederung des Lobes der Torheit neben der Gliederung gem„ß der aphtonianischen sowie der quintilianischen Rednervorschriften. Vgl. Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.90. Diesen Ansatz bezeichnet Schmidt-Dengler allerdings mit dem Hinweis, daß Erasmus selten ein Thema -ber l„ngere Strecken diszipliniert durchf-hre, als "unverbindliche Spekulation" (vgl. Schmidt-Dengler, Einleitung, S.21).
So hatte der Redner eben mit den Ahnen und der Familie des Gelobten zu beginnen, auf dessen Geburtsort bzw. -land einzugehen, und ferner sein Aufwachsen, seine Erziehung, seine Freunde, Bekannten oder Untergebenen darzustellen. Vgl. Hudson, Folly of Erasmus, S.24.
Gail, Nachwort, S.131
Vgl. z.B. die Aus -hrungen -ber bezuglose Anspielungen und Zitate in Predigten und Reden (80) oder das sinnentstellende Zitieren der Theologen (99).
In der Tat sind die meisten Sprich”rter im Lob der Torheit der Adagia entnommen. Vgl. Erasmus, Enkomium, Anm.163, S.123. Die erste Sammlung von ungef„hr 800 antiken Sprichw”rtern, Redewendungen und Anekdoten gab Erasmus im Jahr 1500 heraus. Er setzte die Sammlung, mit der er die kritisierte Zitiersucht der Gelehrten also gleichsam bediente, fort, nach acht Jahren umfaßte sie mehr als 4200 Sprichw”rter.
Vgl. Gail, Nachwort, S.128
Vgl. ”nneker, Satire, S.96.
”nneker, Satire, S.96.
Ebd
Gail, Nachwort, S.132
Dazu aus -hrlich: Augustijn, Erasmus von Rotterdam, S.54; S.62ff. Drei Jahre nach dem Erstdruck des Enkomiums (1511) erschien eine von Erasmus
-berarbeitete Ausgabe. Er schob, neben geringf-gigen ? nderungen, vier ausf-hrliche Passagen in den Text ein, durch die der Inhalt st„rker zugespitzt wurde. Darunter befindet sich z.B. die Vorstellung jenes "glorreiche[n]" Theologen, der in den Endungen der m”glichen Beugungen des Namens Jesu' das tiefste Heilsgeheimnis zu erkennen glaubt - Jesus ist summus (der Erste), medius (die Mitte) und ultimus (der Letzte) (81f) - und ferner darauf hinweist, daß der Mittelbuchstabe des Namens "Jesus", das "s", hebr„isch "sin" in der Sprache der Schotten (eine An- spielung auf die Herkunft des Scholastikers Duns Scotus) "S-nde" bedeutet, von welcher Christus die Welt erl”st habe (81f). "Die neuen Passagen beziehen sich alle auf Kirche, Kirchenf-rsten und vor allem auf Theologen und Prediger, so daß das Werk erst jetzt eine klare Zielrichtung erfuhr" (Augustijn, Erasmus von Rotterdam, S.62).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vollständiger Titel ab der Baseler Ausgabe von 1515: Moriae Enkomium sive stulticiae laus.
2 In den einschlägigen mythologischen Lexika konnte die Verfasserin keine Göttin der Torheit, weder unter dem lat. Namen Stultitia, noch griech.: Moria, ausfindig machen. Einen einzigen Hinweis liefert Huizinga, wenn er die Geburt der erasmischen Stultitia interpretiert, leider jedoch ohne Quellenangabe: "In Wahrheit wurde Stultitia nach der Art ihrer ernsthaften Schwester Pallas geboren." (Huizinga, Humanismus, S.64). Erasmus hat sich jedenfalls, wie das angeführte Zitat zeigt, nicht an die mythologischen "Vorgaben" gehalten, sondern stattdessen die Figur Stultitia in seinem Sinne neu konstruiert. Die abstrakt-philosophische Diskussion um das Gegensatzpaar stultitia - sapientia in Antike und Mittelalter faßt Könneker zusammen: Könneker, Narrenidee, Kap. I,II.: Der Brantsche Narrenbegriff und die stultitia-sapientia Tradition, S.5-14.
3 Zum Folgenden vgl. Eckert, Werk und Wirkung, S.137ff.
4 Spanien bildete diesbezüglich das Schlußlicht. Dort fahndete jahrhundertelang die Inquisition nach den Schriften des Erasmus. Die erste Übersetzung erschien erst im 19. Jahrhundert: 1842 (vgl. Eckert, Werk und Wirkung, 142).
5 Zur Tradition der antiken Enkomien und zum erneuten Aufschwung dieser Gattung mit und nach dem Lob der Torheit vgl. Könneker, Narrenidee, S.255f; zur Sündenthematik vgl. Könneker, Narrenidee, u.a. S.262. Könneker setzt sich mit dieser Thematik so intensiv und umfangreich auseinander, daß eine einzelne Seitenangabe dem nicht gerecht wird. Vgl. a.a.O. Kapitel II: Die ethisch-religiöse Narrenidee im Narrenschiff Sebastian Brants; Kapitel III: Der diabolisierte Narr in den Narrendichtungen Thomas Murners.
6 Jensma, Erasmus, S.55.
7 Die in den laufenden Text in Klammern gesetzten Seitenangaben der Zitate beziehen sich auf die im Literaturverz. angeführte Reclam-Ausgabe (hg.u.übers.v. Anton J. Gail).
8 Barbara Könneker beschreibt das Enkomium als "leicht und witzig geführte, aber keineswegs vordergründige Erörterung über das Wesen des Glücks im Verhältnis zur Weisheit und Torheit" (Könneker, Narrenidee, S.272) und erörtert die philosophischen und theologischen Aspekte dieser Fragestellung (vgl.ebd., ff).
9 Huizinga, Humanismus, S.67.
10 Vgl. ebd., S.69f.
11 Kaiser, Ironic Mock Enkomium, S.78.
12 Vgl. z.B. Könneker, Satire, S.90; Schmidt-Dengler, Einleitung, S.18.
13 Vgl. Hudson, Folly of Erasmus, S.30ff.
14 Huizinga, Humanismus, S.67
15 Dies bedeutet nicht, daß die Reformtheologen, insbesondere Luther, Erasmus gewogen waren. Erasmus verneinte den revolutionören Geist, durch den er Bildung und gesellschaftlichen Fortschritt gefährdet sah. Als eher gemäßigter Reformtheologe hatte er sich nie von der alten Kirche trennen wollen. Während die Katholiken in ihm den Wegbereiter Luthers sahen, vermißten die Evangelischen an ihm ein klares Bekenntnis (vgl. Gail, Nachwort, S.127; S.129). Zu seiner Auseinandersetzung mit Luther über den freien Willen, den Luther abstritt, vgl. Augustijn, Erasmus von Rotterdam, Kap.XI: Der Streit über die Willensfreiheit, S.121-130.
16 Vertreter der Franziskaner und Dominikaner hatten einen ganzen Katalog von Irrtümern und Ketzereien in den Werken Erasmus' ausgemacht. Eine 1527 schon anberaumte Konferenz zwecks Erörterung dieser Affäre wurde wegen drohender Pestgefahr auf unbestimmte Zeit vertagt, fand aber nicht mehr statt. Zudem stand Erasmus unter dem Schutz mächtiger Persönlichkeiten, u.a. ausgerechnet des Großinquisitors und Erzbischofs von Sevilla wie auch des Kaisers. Vgl. Augustijn, Erasmus von Rotterdam, S.138.
17 Vgl. Könneker, Narrenidee, Anm.65, S.296.
18 Hudson, Folly of Erasmus, S.33.
19 Zum Folgenden vgl. Jensma, Erasmus, S.54.
20 Jensma, Erasmus, S.54.
21 Dean, Background, S.53f.
22 Könneker, Satire, S.95. Könneker sieht darin insbesondere auch einen Angriff auf die "Sic et Non"- Methodik, eben das "Entweder-Oder" der mittelalterlichen Scholastik (vgl. Könneker, Narrenidee, S.291ff.
23 Vgl. Könneker, Satire, S.95.
24 Könneker, Narrenidee, S.255.
25 Zur Frage der Datierung des Widmungsschreibens vgl. Schmidt-Dengler, Einleitung, S.10.
26 Dabei erwähnt er u.a. den Eselsroman des Apulejus (4).
27 Vgl. Sestendrup (Hg), Lazaril, Vorrede, S.7f.
28 Könneker, Narrenidee, S.262.
29 Ebd.
30 Ebd., S.259.
31 Eckert, Werk und Wirkung, S.132.
32 Obwohl sie es sich nicht verkneifen kann, wenigstens Anspielungen zu machen, die die Identität einer konkreten Person dennoch preisgeben. Hierbei handelt es sich, wie bei der Anspielung auf den Theologen Nikolaus Lyranus (98) aber zumeist um Personen, die lange vor Erasmus' Zeiten gelebt haben, also nicht um persönliche Angriffe. Allerdings weiß der zeitgenössische Leser natürlich genau, wenn Stultitia meint, wenn sie sich an anderer Stelle über kriegführende P„pste beklagt(89f), nämlich den papa terribile Julius II. (1503-13).
33 Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.88.
34 Vgl. Grimmelshausen, Simplicissimus, S.7ff.
35 Kaiser verweist in diesem Zusammenhang auf den literarischen Topos des locus amoenus.
36 Könneker, Narrenidee, S.263.
37 Vgl. ebd.
38 Es sind die Helden, die vor Theben sowie bei der Schlacht um Troja ums Leben kamen. Ihr Ende läutete das Zeitalter des fünften und letzten, des eisernen und verderbten Menschengeschlechts ein. Vgl. Schwab, Sagen, S.11f.
39 Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.89 (Hervorhebungen von mir).
40 "Verkleidet also war ich in jedem Fall, und die unmaskierte Wirklichkeit zwischen den beiden Erscheinungsformen, das Ich-selber-Sein, war nicht bestimmbar, weil tatsächlich nicht vorhanden." Mann, Felix Krull, S.238.
41 Vgl. Schmidt-Dengler, Einleitung, S.18.
42 Zum Folgenden vgl. Könneker, Satire, S.91ff.
43 Hudson, Folly of Erasmus, S.33.
44 Könneker, Satire, S.99.
45 Könneker und Schmidt-Dengler schließen bei Erasmus, auch mit Hinweisen auf andere Werke Erasmus und die geplante Trilogie des Lobes der Natur, der Torheit und der Gnade, auf ein positives Verständnis christlicher Torheit (vgl. Könneker, Narrenidee, u.a. S.317f; Schmidt-Dengler, Einleitung, S.21f). Dagegen warnt Huizinga davor, ohne jedoch den Passagen einen tiefen Hintergrund abzusprechen, die Lobrede "allzu ernst" zu nehmen: "Denn dies muß so nachdrücklich wie möglich festgehalten werden, daß das [Moriae Encomium] echter, fröhlicher Scherz ist" (Huizinga, Humanismus, S.69).
46 Und gerade dies bestärkt die Annahme, daß Erasmus die Torheit des Kreuzes ernst meint und die Lobrede auf diese letzten Passagen hin konzipiert hat. So konnte und sollte das eigentliche und letztendliche Hauptanliegen Erasmus, im Mund der Stultitia zum Scherz degradiert, dennoch ausgesprochen und der Vorwurf der Blasphemie mit Verweis auf die Sprecherin abgewendet werden.
47 Vgl. Colie, Problems of Paradoxes, S.96.
48 Könneker macht hier einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Enkomium und den Narrendichtungen Murners und Brants aus. Fast schon vorwurfsvoll merkt sie an, daß Erasmus das Böse und Teuflische bewußt verbannt und "nicht gewillt ist, sich intensiver mit der eigentlichen Problematik menschlicher Existenz einzulassen" (Könneker, Narrenidee, S.262). Damit weise er jede Erziehungsabsicht zurück und verleihe dem Enkomium den Charakter einer rein akademischen Erörterung, aus der nur Gleichrangige und geistig Hochstehende Gewinn ziehen könnten (vgl.ebd).
49 Hudson, Folly of Erasmus, S.33
50 Schmidt-Dengler, Einleitung, S.14.
51 Schultz, Nachwort, S.120.
52 Bezeichnend ist die bildliche Darstellung dieser Situation durch Holbein. In seiner Zeichnung spricht Stultitia von einer Kanzel herab. Zudem trägt sie als parodierendes Attribut die narrentypische Schellenkappe.
53 Damit meint sie vielleicht die Eselsohren tatsächlich als bildliches Symbol und Erkennungszeichen der Dummheit und Narrheit. Denkt man aber an dem Mythos, wie Midas zu seinen Eselsohren kam, so eröffnet sich darüberhinaus eine tiefgründigere und m.E. reizvollere Interpretation. Beim musika- lischen Wettstreit zwischen dem Herausforderer Pan und Apollo widerspricht einzig Midas dem richterlichen Urteil, welches zugunsten Apolls ausgefallen war, woraufhin Apoll ihm zur Strafe die Eselsohren anzaubert (Ovid, Metamorphosen XI; vgl. Erasmus, Lob der Torheit, Anm.3, S.114.). Die "Dummheit" des Midas besteht also darin, die Wahrheit zu sagen, bzw. eine andere Wahrheit als die allgemein anerkannte zu äußern. Letztlich ist es das dominierende Prinzip der gesamten Lobrede, feststehende Wahrheiten in Frage zu stellen und umzukehren. Von daher ist Stultitias Forderung nach den Midasohren vielleicht eher der versteckte Aufruf zu einer entsprechenden Geisteshaltung, nämlich Offenheit für andere Wahrheiten.
54 Vgl. Hudson, Folly of Erasmus, S.23f. Formale Entsprechungen im Gesamtaufbau der Lobrede weist auch Walter Kaiser nach. Bei ihm findet sich eine Kurzübersicht der Gliederung des Lobes der Torheit neben der Gliederung gemäß der aphtonianischen sowie der quintilianischen Rednervorschriften. Vgl. Kaiser, Ironic Mock Encomium, S.90. Diesen Ansatz bezeichnet Schmidt- Dengler allerdings mit dem Hinweis, daß Erasmus selten ein Thema über längere Strecken diszipliniert durchführe, als "unverbindliche Spekulation" (vgl. Schmidt-Dengler, Einleitung, S.21).
55 So hatte der Redner eben mit den Ahnen und der Familie des Gelobten zu beginnen, auf dessen Geburtsort bzw. -land einzugehen, und ferner sein Aufwachsen, seine Erziehung, seine Freunde, Bekannten oder Untergebenen darzustellen. Vgl. Hudson, Folly of Erasmus, S.24.
56 Gail, Nachwort, S.131.
57 Vgl. z.B. die Ausführungen über bezuglose Anspielungen und Zitate in Predigten und Reden (80) oder das sinnentstellende Zitieren der Theologen (99).
58 In der Tat sind die meisten Sprichwörter im Lob der Torheit der Adagia entnommen. Vgl. Erasmus, Enkomium, Anm.163, S.123. Die erste Sammlung von ungefähr 800 antiken Sprichwörtern, Redewendungen und Anekdoten gab Erasmus im Jahr 1500 heraus. Er setzte die Sammlung, mit der er die kritisierte Zitiersucht der Gelehrten also gleichsam bediente, fort, nach acht Jahren umfaßte sie mehr als 4200 Sprichwörter.
59 Vgl. Gail, Nachwort, S.128.
60 Vgl. Könneker, Satire, S.96.
61 Könneker, Satire, S.96.
62 Ebd.
63 Gail, Nachwort, S.132.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Lob der Torheit" (Moriae Enkomium) von Erasmus von Rotterdam?
Das "Lob der Torheit" (Moriae Enkomium) ist eine satirische Schrift von Erasmus von Rotterdam, verfasst im Jahr 1509 und erstmals gedruckt 1511. In dieser Schrift tritt die Torheit (Stultitia/Moria) personifiziert als antike Göttin auf und hält eine Preisrede auf ihr eigenes Wesen und Wirken in der Welt.
Was sind die Hauptthemen des "Lob der Torheit"?
Zu den Hauptthemen gehören: die Maskenhaftigkeit des menschlichen Daseins, das Leben als Theater und Spiel der Torheit, die heilsame Torheit als wahre Weisheit im Gegensatz zur eingebildeten Weisheit, die Religionskritik und Gelehrtensatire, sowie die Bedeutung der Torheit für Glück und Lebensfreude.
Was ist die erasmische Ironie und wie äußert sie sich im "Lob der Torheit"?
Die erasmische Ironie ist eine besondere Form der Ironie, die nicht nur das Gegenteil des Gesagten meint, sondern mehrere Perspektiven gleichzeitig ausdrückt. Es wird unterschieden zwischen subjektiver (formaler) Ironie, die Erasmus vor Kritik schützen soll, und objektiver Ironie, die das Publikum überzeugen und Denkgewohnheiten in Frage stellen will.
Welche Rolle spielt die Figur der Stultitia (Torheit)?
Stultitia ist die Hauptfigur und Rednerin des Enkomiums. Sie wird als antike Göttin dargestellt, die über die Torheit philosophiert und die Welt und die Menschen aus einer überlegenen Perspektive betrachtet. Sie wechselt im Verlauf der Rede ihre Masken, von einer heiteren Spenderin des Lebens zu einer schonungslosen Kritikerin und Satirikerin.
Welche Kritik übt Erasmus im "Lob der Torheit"?
Erasmus kritisiert insbesondere die Gelehrten, Theologen und Kleriker seiner Zeit für ihre Scheinheiligkeit, ihren Aberglauben, ihre Formelhaftigkeit und ihre Verfehlungen gegenüber dem Bildungs- und Frömmigkeitsideal.
Inwiefern unterscheidet sich das "Lob der Torheit" von Schelmenromanen?
Während Schelmenromane oft episodisch sind und das Leben eines Schelms schildern, der sich durch Betrug und List durchschlägt, ist das "Lob der Torheit" eine in sich geschlossene Schrift mit einem klaren thematischen Schwerpunkt. Es teilt jedoch mit Schelmenromanen das Strukturprinzip der ironischen Doppeldeutigkeit und die Infragestellung konventioneller Werte.
Was bedeutet die "Torheit des Kreuzes" im "Lob der Torheit"?
Die "Torheit des Kreuzes" bezieht sich auf die christliche Lehre, die für viele Menschen unvernünftig und töricht erscheint. Erasmus interpretiert diese Torheit als eine höhere Form der Weisheit, die im Glauben und in der mystischen Ekstase zu finden ist.
Warum ist das "Lob der Torheit" auch heute noch relevant?
Das "Lob der Torheit" ist auch heute noch relevant, weil es auf humorvolle und intelligente Weise grundlegende Fragen nach Wahrheit, Weisheit, Glück und dem Sinn des Lebens aufwirft. Es regt zum Nachdenken an und fordert dazu auf, Denkgewohnheiten kritisch zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Vorsmann (Autor:in), 1998, Erasmus von Rotterdam - Das Lob der Torheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98543