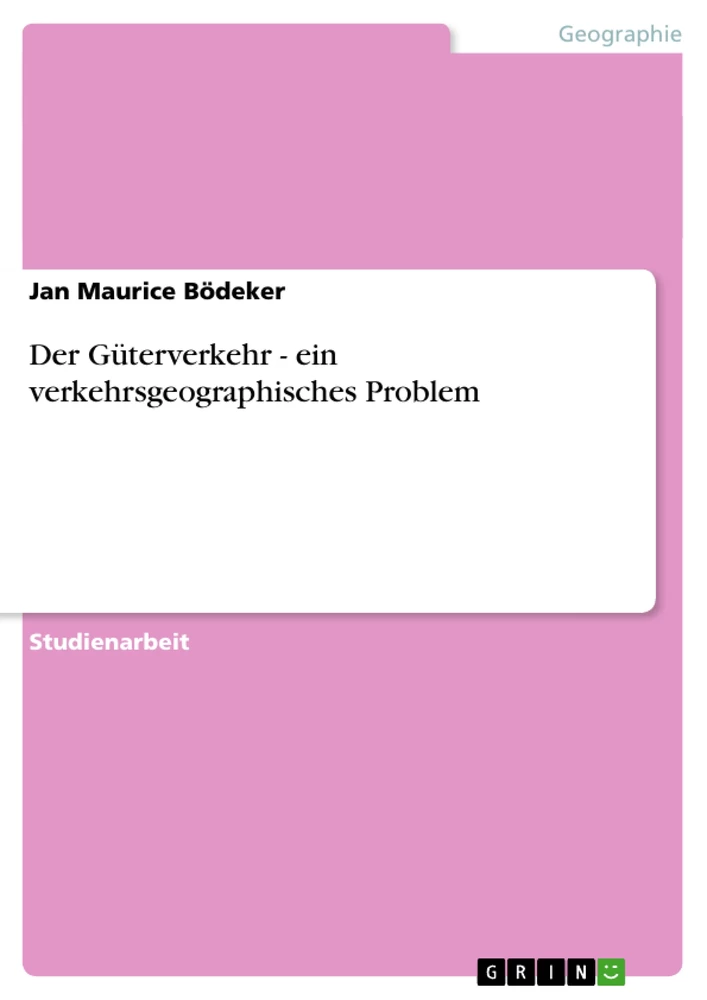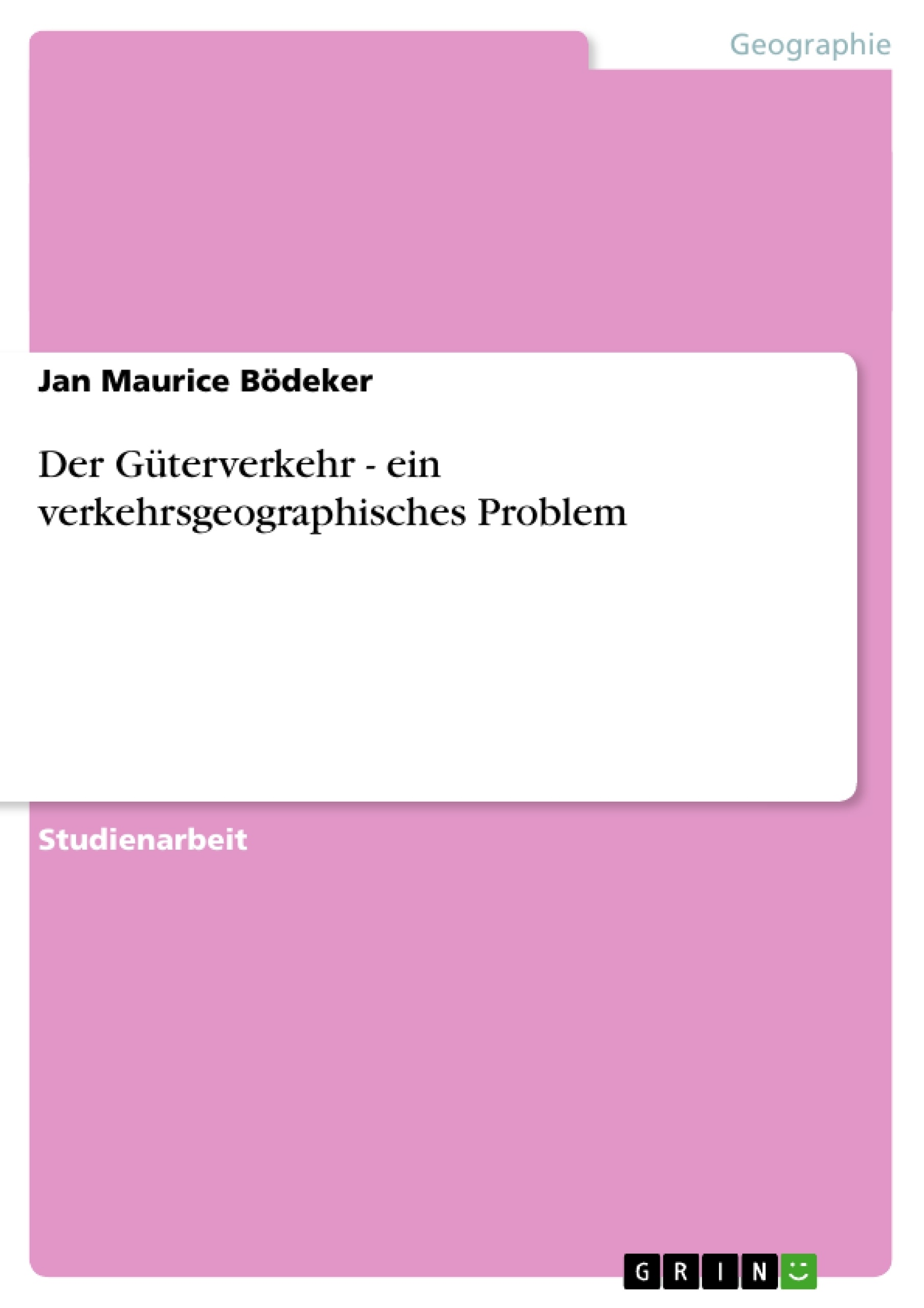Der Güterverkehr - ein verkehrsgeographisches Problem.
bearbeitet von Jan Maurice Bödeker / September 2000
1.: Einleitung:
1.1.: Definitionen und Begrifflichkeit:
Bevor auf den Aufbau des Textes näher eingegangen wird, folgen zunächst einige für das Verständnis des Textes notwendige Begrifflichkeiten.
Der Verkehr im Allgemeinem wird definiert als „die Raumüberwindung von Gütern, Personen und Nachrichten1 “ und stellt ferner „ein wichtiges Bindeglied zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Raum dar2 “.
Die Verkehrsgeographie versucht „eine Darstellung und Analyse der Verkehrsstrukturen im Güter-, Personen- und Nachrichtenverkehr unter Berücksichtigung des staatlichen Einflusses auf das Verkehrsangebot und regionaler Verkehrsstrukturen3 “ zu erarbeiten und ferner „die Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt3 “ zu analysieren. Darüber hinaus versucht sie „die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Verkehr [...] und dem Raum in seiner natürlichen und bevölkerungsmäßigen, sowie vom Menschen geprägten Ausstattung in Hinblick auf die bestehenden Raumstrukturen zu erklären4 “. Die Verkehrsgeographie bedient sich demnach - zur qualitativen Analyse und Darstellung - auch anderer Wissenschaftsbereiche wie zum Beispiel der Raumordnungspolitik, der Politikwissenschaft und besonders der Volkswirtschaftslehre (s. Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: „ Einordnung der VerkehrsgeographieA “
„Die Beförderung von Gütern aller Art durch Kraftfahrzeuge, Eisenbahn, Luftfahrzeuge, Schiffe, Rohrleitungen, Transport- und Seilbänder als auch Trag- und Zugtiere“ zählt im Rahmen der verkehrsgeographischen Nomenklatur zum „Güterverkehr“. Dieser wiederum wird nochmals im gesetzlichen / statistischen Sinne unterschieden in „Güternahverkehr (Entfernung bis 50km)“, „Güterfernverkehr (Entfernung 50km +)“ und „Werkverkehr (Verkehr des produzierenden Gewerbes ohne Inanspruchnahme eines Transportunternehmens)“.
Güter, welche einzeln in Kisten, Fässern, Ballen, Bündeln oder Säcken abgepackt und transportiert werden nennt man „Stückgüter“.
Als „Massengüter“ werden demnach alle Industrieprodukte bezeichnet, die in großen Mengen hergestellt werden und - im Vergleich zu ihrem Wert- ein großes Transportvolumen beanspruchen (z.B. Erz, Kohle, Kalisalze etc.).
1.2.: Inhalt und Struktur:
Für die folgenden Betrachtungen werden nur die Verkehrsträger Straße, Schiene, Binnenschifffahrt und Flugzeuge einbezogen, da Trag- bzw. Zugtiere in der Bundesrepublik Deutschland keine Bedeutung haben und Seil- und Transportbänder wegen ihrer geringen räumlichen Wirkung weniger ins Gewicht fallen.
Rohrleitungen (Pipelines) und die durch sie transportierten Güter werden ebenfalls außer Acht gelassen, da die gleichbleibend „große Regelmäßigkeit des Transports der Güter zwischen wenigen, von vornherein fixierten Punkten5 “ für eine Betrachtung des äußerst dynamischen Güterverkehrsmarktes nahezu keine Bedeutung hat.
Der Text befasst sich mit Problemen und den stets im Wandel befindlichen Strukturen des Güterverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland seit 1960 (wegen erhöhter Dynamik nach Ende des 2.Weltkriegs interessant; z.B. Wirtschaftsboom, europäische Integration / global sourcing, Postfordismus), beschränkt sich aber auf infrastrukturelle, finanzpolitische, politische, wirtschaftliche und ökologische Problemzusammenhänge des Transports von Gütern (s. Kapitel 2.) .
Abschließend werden in Kapitel 3. Neuerungen und Lösungsansätze für die Verkehrsträger vorgestellt (kombinierter Verkehr / modal split, GVZ, Logistikoptimierung etc.) und diskutiert inwieweit diese zur Problembehebung in Zukunft beitragen können.
Durch eine angemessene Visualisierung (Diagramme, Abbildungen etc.) unter Einbezug aktueller Daten soll eine gefällige Darstellung der Verhältnisse in der derzeitigen Güterverkehrssituation erlangt werden.
2.: Entwicklung und Problematik des Güterverkehrs in Deutschland
2.1.: Ökonomische Grundlagen:
In einer der ersten ökonomisch ausgerichteten Ausarbeitungen stellte Alfred Webers Standorttheorie (1922) dabei die Transportkosten bei der Distanzüberwindung von Gütern in den Vordergrund. Unter Annahme eines wirtschaftlich, politisch und kulturell homogenen Raum ermittelte er den optimalen Produktionsstandort als Symbiose aus Transportkostenminimalpunkt, Arbeitskosten und Agglomerationswirkungen. Die frühe Einbeziehung des Güterverkehrs (Weber, Lösch, von Thünen) unter wirtschaftlichen Aspekten zeigt einerseits, dass Standorte je nach Wirtschaftlichkeit unregelmäßig über den Raum verteilt sind und andererseits, dass bei der Distanzüberwindung von Gütern nicht die Entfernung, sondern die Kosten im Mittelpunkt stehen. „Nicht nur die Entgeltkosten des Verkehrsunternehmers sind einzukalkulieren, sondern auch:
1. die Qualitäts- und Quantitätsverluste des Gutes,
2. die Zinskostenverluste ( da das Gut während der Transportdauer dem Produktionsprozess entzogen ist),
3. die Verpackungskosten,
4. die Transport-, Verlade- und Verwaltungskosten im Betrieb selbst und
5. die Versicherungskosten des Gutes.“
„Die ökonomische Funktion eines Verkehrssystems ist es“ folglich, „die Lücke zwischen Produzent und Verbraucher von Gütern“ im betriebwirtschaftlichen Sinne kostenminimal „zu überwinden.“ Bei der Wahl der Verkehrsträger durch die Nachfrageseite zählen nicht nur finanzielle Aspekte, sondern auch die Eilbedürftigkeit der Güter, die Lagerhaltung, die Verfügbar- und Erreichbarkeit der Verkehrsträger und die zeitliche Komponente zu den Bewertungskriterien (s. Abbildung 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: „ Bestimmung der Verkehrsmittelwahl im G ü terverkehrB “
Neben „der eigentlichen Transportfunktion6 “ stellt der Güterverkehr deshalb „ein wichtiges Element der Volkswirtschaft6 “ dar, ist aber im Gegenzug wiederum völlig abhängig von konjunkturbedingten Schwankungen der Wirtschaft.
„(Güter-)verkehr ist nicht nur Produktionsfaktor, sondern Vorraussetzung und tragende Stütze aller übrigen Erzeugungsvorgänge7 “ in der Volkswirtschaft.
Dabei bedingen nach F. v. STACKELBERG vier Arten von Effekten die Entwicklung des Güterverkehrs in entschiedenem Maße:
1. „der Wachstumseffekt8 “, der durch Steigerung des Bruttoinlandsproduktes „zu einer Erhöhung der Nachfrage nach Güterverkehrsleistungen führt8 “.
2. „der Güterstruktureffekt [...], der sich beim Verkehr in einer Abnahme der Nachfrage nach Massenverkehrsleistungen8 “ (Massengüter) „und in einer Erhöhung der Nachfrage nach individuellen Leistungen8 “ (Stückgüter) „bemerkbar macht7 “.
3. „der Regionalverkehr, der zur Konzentration von Produktionsstätten in Ballungszentren [...] und gleichzeitig zur Zersplitterung der Produktion und damit der Verkehrsnachfrage8 “ führt.
4. „der Logistikeffekt8 “, der auf verändernden Organisations- und Produktionsstrukturen (just-in-time / lean production) - hin zu verminderter Lagerhaltung - basiert.
Auch die Einflüsse des Staates durch Struktur- und Ordnungspolitik als Steuerungsmöglichkeit der (Güter-)Verkehrspolitik müssen in die Darstellung einbezogen werden.
[...]
1 SCHLIEPHAKE, K.(1982): Verkehrsgeographie. In: Harms Handbuch der Geographie: Sozial- und Wirtschaftsgeographie 2. München: Paul List Verlag. S.39.
2 VOIGT (1973): In: NUHN, H. (1998): Verkehr und Kommunikation. In: KULKE (Hrsg.) (1998): Wirtschaftsgeographie Deutschlands. Gotha / Stuttgart. Klett-Perthes. S.199.
3 MAIER, J. / ATZKERN, H.D. (1992): Verkehrsgeographie. Stuttgart. Teubner Studienbücher. S.14.
4 SCHLIEPHAKE, K.(1982): Verkehrsgeographie. In: Harms Handbuch der Geographie: Sozial- und Wirtschaftsgeographie 2. München: Paul List Verlag. S.42.
5 SCHLIEPHAKE, K.(1982): Verkehrsgeographie. In: Harms Handbuch der Geographie: Sozial- und Wirtschaftsgeographie 2. München: Paul List Verlag. S.69.
6 MAIER, J. / ATZKERN, H.D. (1992): Verkehrsgeographie. Stuttgart. Teubner Studienbücher. S. 40
7 WILLEKE (1966): In: SCHLIEPHAKE, K.(1982): Verkehrsgeographie. In: Harms Handbuch der Geographie: Sozial- und Wirtschaftsgeographie 2. München: Paul List Verlag. S.56 / 57.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Der Güterverkehr - ein verkehrsgeographisches Problem"?
Der Text behandelt Probleme und sich ständig ändernde Strukturen des Güterverkehrs in Deutschland seit 1960. Der Fokus liegt auf infrastrukturellen, finanzpolitischen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Problemzusammenhängen des Transports von Gütern.
Welche Verkehrsträger werden im Text betrachtet?
Der Text konzentriert sich auf Straße, Schiene, Binnenschifffahrt und Flugzeuge als Verkehrsträger. Trag- und Zugtiere sowie Seil- und Transportbänder werden aufgrund ihrer geringen Bedeutung bzw. räumlichen Wirkung vernachlässigt. Rohrleitungen (Pipelines) werden ebenfalls nicht betrachtet.
Welche Definitionen und Begrifflichkeiten werden im Text erläutert?
Der Text definiert allgemeine Begriffe wie "Verkehr" und "Verkehrsgeographie" und erläutert spezifische Termini des Güterverkehrs, wie "Güternahverkehr," "Güterfernverkehr," "Werkverkehr," "Stückgüter," und "Massengüter".
Welche ökonomischen Grundlagen des Güterverkehrs werden diskutiert?
Die Ausführungen basieren auch auf Alfred Webers Standorttheorie, welche die Transportkosten bei der Distanzüberwindung von Gütern in den Vordergrund stellt. Zudem werden Faktoren wie die Qualität und Quantität der Güter, Zinskosten, Verpackungskosten, Transport-, Verlade- und Verwaltungskosten sowie Versicherungskosten betrachtet. Auch die Rolle der Verkehrsmittelwahl wird unter Bezugnahme auf Lagerhaltung und der zeitlichen Komponente der Güter behandelt.
Welche Effekte beeinflussen die Entwicklung des Güterverkehrs laut F. v. STACKELBERG?
Laut F. v. STACKELBERG bedingen vier Arten von Effekten die Entwicklung des Güterverkehrs: der Wachstumseffekt (Steigerung des BIP), der Güterstruktureffekt (Verschiebung von Massengütern zu Stückgütern), der Regionalverkehr (Konzentration und Zersplitterung der Produktion) und der Logistikeffekt (Veränderungen durch Just-in-Time/Lean Production).
Welche Lösungsansätze werden abschließend angesprochen?
Der Text erwähnt abschließend Neuerungen und Lösungsansätze wie kombinierter Verkehr / Modal Split, Güterverkehrszentren (GVZ) und Logistikoptimierung als mögliche Beiträge zur Problembehebung im Güterverkehr.
- Quote paper
- Jan Maurice Bödeker (Author), 2001, Der Güterverkehr - ein verkehrsgeographisches Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98533