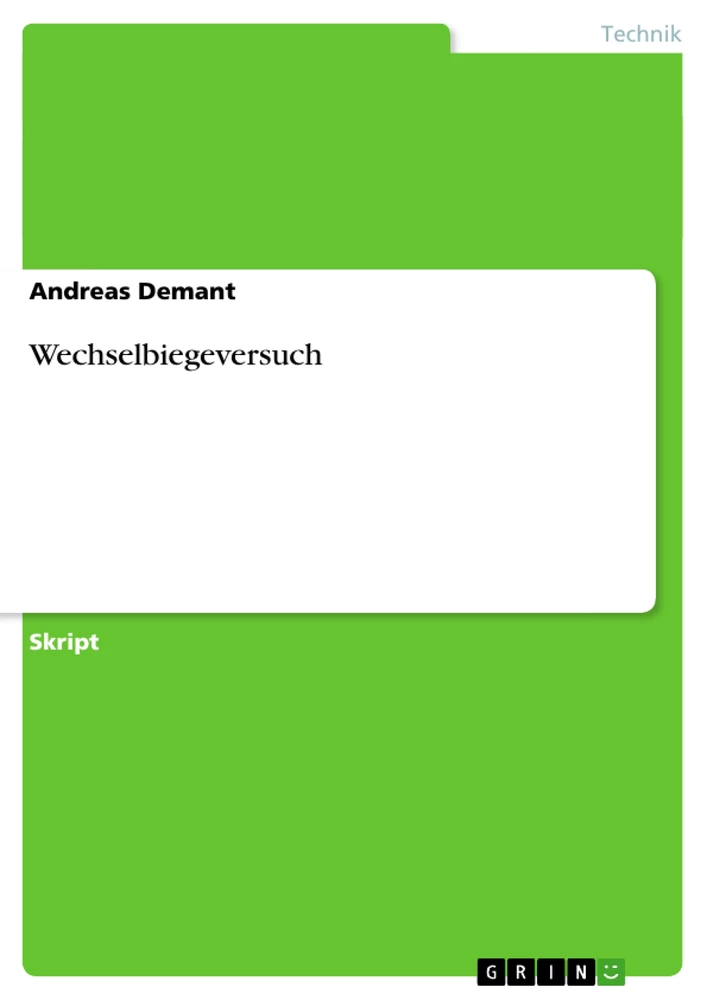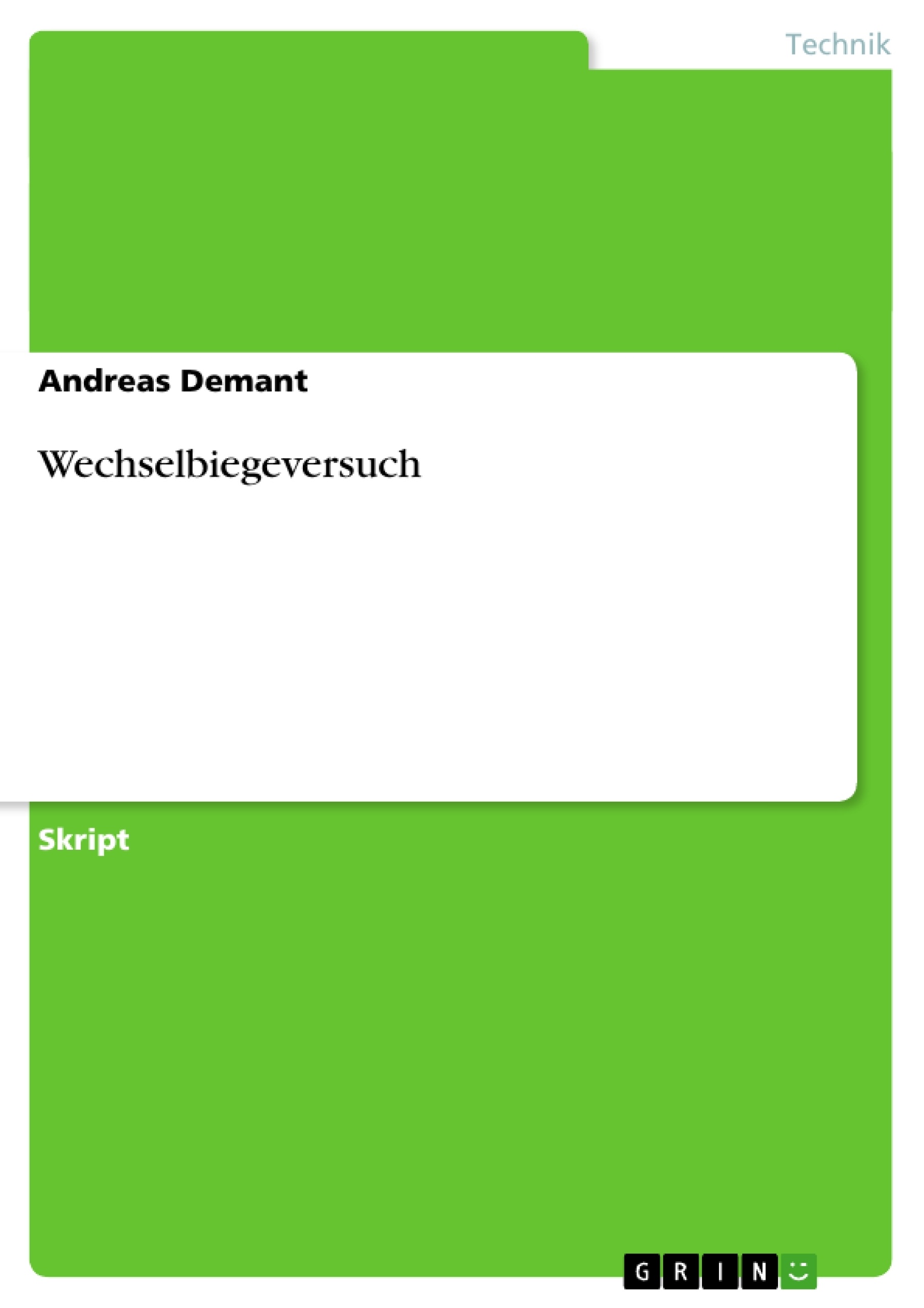Stellen Sie sich vor, ein unsichtbarer Feind nagt unaufhörlich an der Substanz eines Bauteils, bis es plötzlich und unerwartet versagt. Der Wechselbiegeversuch enthüllt die heimtückischen Mechanismen der Materialermüdung und ermöglicht es, die Grenzen der Belastbarkeit von Werkstoffen präzise zu bestimmen. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise in die Welt der Werkstoffprüfung, beginnend mit der detaillierten Vorbereitung der Probengeometrie und der präzisen Ermittlung des Widerstandsmoments. Erfahren Sie, wie die Biegewechselmaschine, ein komplexes Zusammenspiel aus Pleuel, Exzenterscheibe und Messschwinge, die Probe einer wechselseitigen Schwingbelastung aussetzt, um ihre Dauerfestigkeit oder Gestaltfestigkeit zu testen. Die Analyse der Dauerschwingbeanspruchung, anschaulich dargestellt durch Diagramme, offenbart die kritischen Bereiche des Schwellbereichs und Wechselbereichs, in denen die Probe entweder Druck oder Zugkräften ausgesetzt ist. Entdecken Sie die Ursachen für Dauerbrüche, von zu hohen Schwingbeanspruchungen bis hin zu kerbartig wirkenden Werkstofffehlern, und lernen Sie, wie Sie diese vermeiden können, um die Lebensdauer Ihrer Bauteile zu verlängern. Die Auswertung der Versuchsergebnisse, einschließlich der Erstellung einer Wöhlerkurve und eines Smith-Diagramms, liefert Ihnen wertvolle Erkenntnisse über die Dauerbeanspruchbarkeit der Probe in Abhängigkeit von der Lastspielzahl und dem Spannungsausschlag. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Ingenieure, Werkstoffprüfer und alle, die sich für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bauteilen interessieren, um die Geheimnisse der Materialermüdung zu entschlüsseln und die Dauerfestigkeit von Konstruktionen zu optimieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Werkstoffprüfung und entdecken Sie, wie Sie Ihre Produkte widerstandsfähiger und langlebiger machen können, indem Sie die Prinzipien des Biegewechselversuchs verstehen und anwenden. Vermeiden Sie kostspielige Ausfälle und Konstruktionsfehler, indem Sie die Dauerfestigkeit Ihrer Materialien präzise bestimmen und die Ursachen von Materialermüdung eliminieren. Ein essentielles Werkzeug für jeden, der sich mit der Entwicklung und Herstellung von zuverlässigen und langlebigen Produkten beschäftigt, um die Lebensdauer und Sicherheit von Bauteilen und Konstruktionen zu gewährleisten und Materialermüdung zu verstehen.
Andreas Demant:
Wechselbiegeversuch
1. Einleitung
Mit Hilfe des Biegewechselversuches nach DIN 50142 wird zum Beispiel ein bestimmtes Hartmetall oder ein spezieller Gußwerkstoff auf seine mechanisch-technologischen Eigenschaften hin überprüft, was in der Versuchsdurchführung auch zur Zerstörung der Probe führen kann. Bei diesem Versuch wird das Bauteil einer zeitabhängigen, wechselhaften Schwingbelastung unterzogen. Der Biegewechselversuch dient in erster Linie zur Bestimmung oder Überprüfung der Dauerfestigkeit oder der Gestaltfestigkeit eines Bauteils. Eine hohe Dauerfestigkeit ist zum Beispiel eine notwendige Voraussetzung bei einer Schraubenfeder im Fahrwerk eines Automobils.
2. Versuchsdurchführung
2.1. Probengeometrie
Zur Ermittlung der Dauerfestigkeit einer Probe eines bestimmten Werkstoffes wird folgende Probe mit einer maschinenspezifischen Geometrie verwendet, um ein sicheres Einspannen der Probe zu ermöglichen und so auch ein störungsfreies Aufbringen der Spannungen zu garantieren.
Darstellung der Probe:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2. Vorbereitung der Versuchsausgangsdaten
Anhand der Probenabmessungen ermitteln wir das Widerstandsmoment W des Prüfquerschnittes nach der Formel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Des weiteren wird aus dem erhaltenen Widerstandsmoment W des Prüfquerschnitts das Biegemoment Mb nach der Formel Mb = W (= Biegespannung, vorgegeben) errechnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhand dieses Biegemomentes wird der Spannungsausschlag der Probe mittels einer maschinenspezifischen Wertetabelle festgestellt. Dem auf der Ordinate angetragenen Biegemoment von 586,67 Ncm entspricht der Spannungsausschlag 146,5 in1 /100 mm auf der Abszisse.
2.3. Beschreibung der Biegewechselmaschine
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wichtigstes Merkmal der im Versuch verwendeten Maschine ist der elektrische Antrieb eines Pleuels (7) über eine Doppelexzenterscheibe (8). Hierdurch wird der wechselseitige Spannungsausschlag am Werkstück erreicht. Das Pleuel überträgt seine Kraft auf eine mittels eines Drehpunktes befestigten Antriebsschwinge (6), welche wiederum im Punkt 4 drehend gelagert ist. Das Werkstück ist jedoch zur Hälfte mit der Antriebsschwinge fest verschraubt, so daß die Antriebsschwinge ein Moment, erzeugt von Pleuel und Exzenterscheibe, auf die Probe übertragen kann. Mit der anderen Hälfte drückt das Werkstück auf eine Feder (10) mit einer bestimmten Federkonstanten D. Auf dieser Feder ist eine Meßschwinge angebracht, deren Auslenkung zwischen den beiden Meßuhren (1) von der jeweiligen Federbelastung durch das Werkstück abhängt.
Festzustellen ist weiterhin, daß der Exzenter abhängig vom aufzubringenden Biegemoment Mb verstellt werden kann. Des weiteren ist an der Maschine ein Sicherheitsmechanismus angebracht, der ermöglicht, daß bei Erreichen des Bruchs während der Belastung die Maschine automatisch stoppt. Dies geschieht in Form eines an der Meßschwinge angebrachten Tasters, der bei entsprechender Auslenkung der Schwinge einen Tastschalter berührt und somit die Maschine abschaltet.
2.4. Versuchsablauf
Vor Versuchsbeginn wird der Zählerstand an der Biegewechselmaschine abgelesen (in unserem Fall: Zählerstand zu Beginn des Versuchs 24587000). Die Belastungsfrequenz seitens des Exzenters auf die Probe beträgt 25 Hz und die Belastungsspannung _W am Werkstück ist 440 N/mm2, woraus sich ein aufzubringendes Biegemoment von 586,67 Ncm ergibt. Zu Versuchsbeginn muß die Kontaktschraube des Ausschaltkontaktes hochgeschraubt werden, sonst würde die Maschine beim Einstellen der Versuchsbedingungen gegebenenfalls ständig ausschalten. Während des Wechselbiegeversuchs werden die Umdrehungen des Exzenters auf dem Lastspielzähler gezählt und somit kann man nach dem Bruch der Probe die benötigten Schwingungen errechnen, bis das Werkstück gebrochen ist.
Zählerstand (nach Bruch der Probe): 24.627.100
- Zählerstand (vor Versuchsbeginn): 24.587.000 Anzahl der Lastspiele: 40.100
3. Analyse der Dauerschwingbeanspruchung
3.1. Graphische Darstellung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Diagramm ermöglicht die Unterscheidung dreier verschiedener Bereiche, die mit Schwellbereich (Druck), Wechselbereich (Druck und Zug) und wiederum Schwellbereich (Zug) bezeichnet werden. Die Biegewechselbeanspruchung liegt im Wechselbereich, in dem Zug- und Druckbeanspruchung betragsmäßig gleich groß sind. Die in der untenstehenden Graphik stehenden Spannungen bedeuten wie folgt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2. Dauerschwingfestigkeit
Für die Konstruktion im Maschinenbau ist es häufig erstrebenswert, besonders dauerschwingfeste Bauteile zu konstruieren. Der Begriff "Dauerschwingfestigkeit" bedeutet, daß eine Probe beliebig oft um ihre Mittellage einen Spannungsausschlag _a erfahren kann, ohne daß sie bricht. Die Dauerschwingfestigkeit und somit die Gestaltfestigkeit eines Bauteils kann mittels des Biegewechselversuches ermittelt oder überprüft werden. Wird allerdings die Dauerschwingfestigkeit überschritten, was eine Materialermüdung zur Folge hat, kann diese Überbelastung zu einem Dauerbruch des Werkstückes führen.
3.3. Ursachen eines Dauerbruchs
Während des Biegewechselversuches kommt es so lange zu einer abwechselnden Zug- und Druckbelastung des Werkstückes, bis möglicherweise das Werkstück bricht. Dies ist einerseits auf eine einmalige Überbelastung (Gewaltbruch) des Werkstücks, andererseits auf eine Materialermüdung (Dauerbruch) zurückzuführen, obwohl das Bauteil keiner Überbelastung unterzogen gewesen sein muß. Die Ursachen für einen Dauerbruch können folgender Art sein:
- Höhe der Schwingbeanspruchung war zu groß
- Zahl der Lastspiele war überschritten
- Es gab unbemerkte Resonanzschwingungen
- Ungenügende Berücksichtigung der Gestaltfestigkeit
- Kerbartig wirkende Werkstoff-Fehler (Bohrungen, Keilnuten, Hohlkehlen) in einem fertigen Bauteil
Im elastisch Bereich während einer Biegewechselbelastung befinden sich die Atome nicht immer in der ihnen im Gitter zukommenden Gleichgewichtslage, so daß sie schon bei geringer äußerer Belastung zu gleiten beginnen. Durch diese Gleitung entsteht im Werkstück ein Anriß, der sich über die Querschnittlänge ausbreitet. Infolge des kerbartig wirkenden Anrisses erhöht sich die Spannung automatisch an der Rißfläche und es kommt zu einem Gewaltbruch des Werkstücks.
4. Auswertung
4.1.Ergebnisse
Die im Versuch verwendete Probe brach nach 40100 Lastspielen auseinander, bei einem Biegemoment von 586,67 N/cm². Ursache des Bruchs ist die zu hohe Schwingungsbeanspruchung. Durch den ständigen Wechsel zwischen Druck- und Zugbelastung entstehen Mikrorisse im Gefüge, die sich schließlich zu Makrorissen ausbilden und den Bruch herbeiführen.
4.2.Wöhlerkurve>
Das Versuchsergebnis liefert genau einen Punkt der sogenannten Wöhlerkurve. Die se liefert zuverlässige Aussagen über die Dauerbeanspruchbarkeit der Probe bezüglich der Lastspielzahl in Abhängigkeit vom Spannungsausschlag. Um eine solche Wöhlerkurve erhalten zu können, muß bei jedem Versuch der Spannungsausschlag abgeändert werden. Alle anderen Versuchsbedingungen bleiben gleich. Allerdings liefert die Wöhlerkurve oberhalb der Dauerschwingfestigkeit im Bereich deZeitschwingfestigkeit keine brauchbaren Werte für die Praxis, da hier bei großer Lastspielzahl immer ein Bruch auftritt. Deswegen muß im Bereich der Zeitfestigkeit eine sogenannte Schadenslinie experimentell ermittelt werden, damit auch bei einer sehr großer Lastspielzahl kein Materialbruch auftritt. (wird erreicht durch niedrigeren Spannungsausschlag).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I) Kurzzeitfestigkeit
II) Zeitfestigkeit
III) Dauerfestigkeit
4.3. Smith- Diagramm
Für die Veranschaulichung der Dauerschwingfestigkeit eines Werkstoffes gibt es mehrere Varianten. In Deutschland hat sich das Dauerfestigkeitsschaubild von Smith durchgesetzt. Hier wird zur Mittelspannung die jeweils zugehörige Ober- und Unterspannung eingetragen. Die Mittelspannung erscheint im Diagramm als eine Gerade, die im 45°-Winkel zur Abszisse durch den Ursprung verläuft. Beanspruchungen oberhalb der Fließgrenze sind aufgrund der zu großen Verformungen unzulässig. Deswegen wird das Schaubild mit der Streckgrenze im Bereich der Oberspannung abgeschnitten. Analog dazu ist eine Gerade von der Mittelspannung zur Unterspannung zu ziehen, so daß der Ausschlag um die Mittelspannung auf beiden Seiten gleich groß ist (A - B).
Häufig gestellte Fragen zu "Wechselbiegeversuch"
Was ist der Zweck des Biegewechselversuchs?
Der Biegewechselversuch nach DIN 50142 dient in erster Linie zur Bestimmung oder Überprüfung der Dauerfestigkeit oder der Gestaltfestigkeit eines Bauteils. Eine hohe Dauerfestigkeit ist zum Beispiel eine notwendige Voraussetzung bei einer Schraubenfeder im Fahrwerk eines Automobils.
Wie wird ein Biegewechselversuch durchgeführt?
Bei diesem Versuch wird das Bauteil einer zeitabhängigen, wechselhaften Schwingbelastung unterzogen. Die Probe hat eine maschinenspezifische Geometrie. Anhand der Probenabmessungen wird das Widerstandsmoment W des Prüfquerschnittes ermittelt. Daraus wird das Biegemoment Mb errechnet. Der Spannungsausschlag der Probe wird anhand einer Wertetabelle festgestellt.
Wie funktioniert die Biegewechselmaschine?
Die Maschine besitzt einen elektrischen Antrieb eines Pleuels über eine Doppelexzenterscheibe. Dadurch wird der wechselseitige Spannungsausschlag am Werkstück erreicht. Das Pleuel überträgt seine Kraft auf eine Antriebsschwinge, die ein Moment auf die Probe überträgt. Das Werkstück drückt auf eine Feder, deren Auslenkung von der jeweiligen Federbelastung abhängt.
Was sind wichtige Aspekte des Versuchsablaufs?
Vor Versuchsbeginn wird der Zählerstand abgelesen. Die Belastungsfrequenz wird eingestellt. Während des Versuchs werden die Umdrehungen des Exzenters gezählt, bis die Probe bricht. Die Anzahl der Lastspiele bis zum Bruch wird errechnet.
Welche Bereiche werden in der Analyse der Dauerschwingbeanspruchung unterschieden?
Es werden drei Bereiche unterschieden: Schwellbereich (Druck), Wechselbereich (Druck und Zug) und wiederum Schwellbereich (Zug). Die Biegewechselbeanspruchung liegt im Wechselbereich, in dem Zug- und Druckbeanspruchung betragsmäßig gleich groß sind.
Was bedeutet Dauerschwingfestigkeit?
Dauerschwingfestigkeit bedeutet, daß eine Probe beliebig oft um ihre Mittellage einen Spannungsausschlag erfahren kann, ohne daß sie bricht. Die Gestaltfestigkeit eines Bauteils kann mittels des Biegewechselversuches ermittelt oder überprüft werden.
Was sind Ursachen für einen Dauerbruch?
Ursachen für einen Dauerbruch können sein: zu hohe Schwingbeanspruchung, überschrittene Zahl der Lastspiele, unbemerkte Resonanzschwingungen, ungenügende Berücksichtigung der Gestaltfestigkeit, kerbartig wirkende Werkstoff-Fehler.
Was wird durch die Wöhlerkurve dargestellt?
Die Wöhlerkurve liefert zuverlässige Aussagen über die Dauerbeanspruchbarkeit der Probe bezüglich der Lastspielzahl in Abhängigkeit vom Spannungsausschlag. Um eine solche Wöhlerkurve erhalten zu können, muß bei jedem Versuch der Spannungsausschlag abgeändert werden.
Was ist das Smith-Diagramm und wozu dient es?
Das Smith-Diagramm ist ein Dauerfestigkeitsschaubild. Hier wird zur Mittelspannung die jeweils zugehörige Ober- und Unterspannung eingetragen. Es dient zur Veranschaulichung der Dauerschwingfestigkeit eines Werkstoffes.
- Quote paper
- Andreas Demant (Author), 2001, Wechselbiegeversuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98488