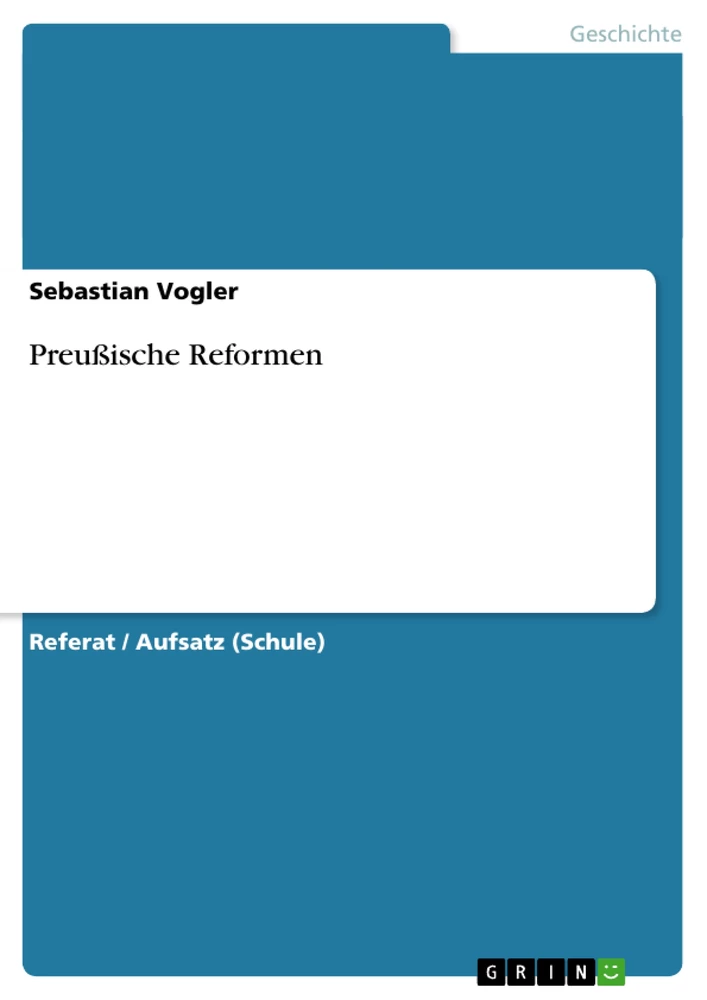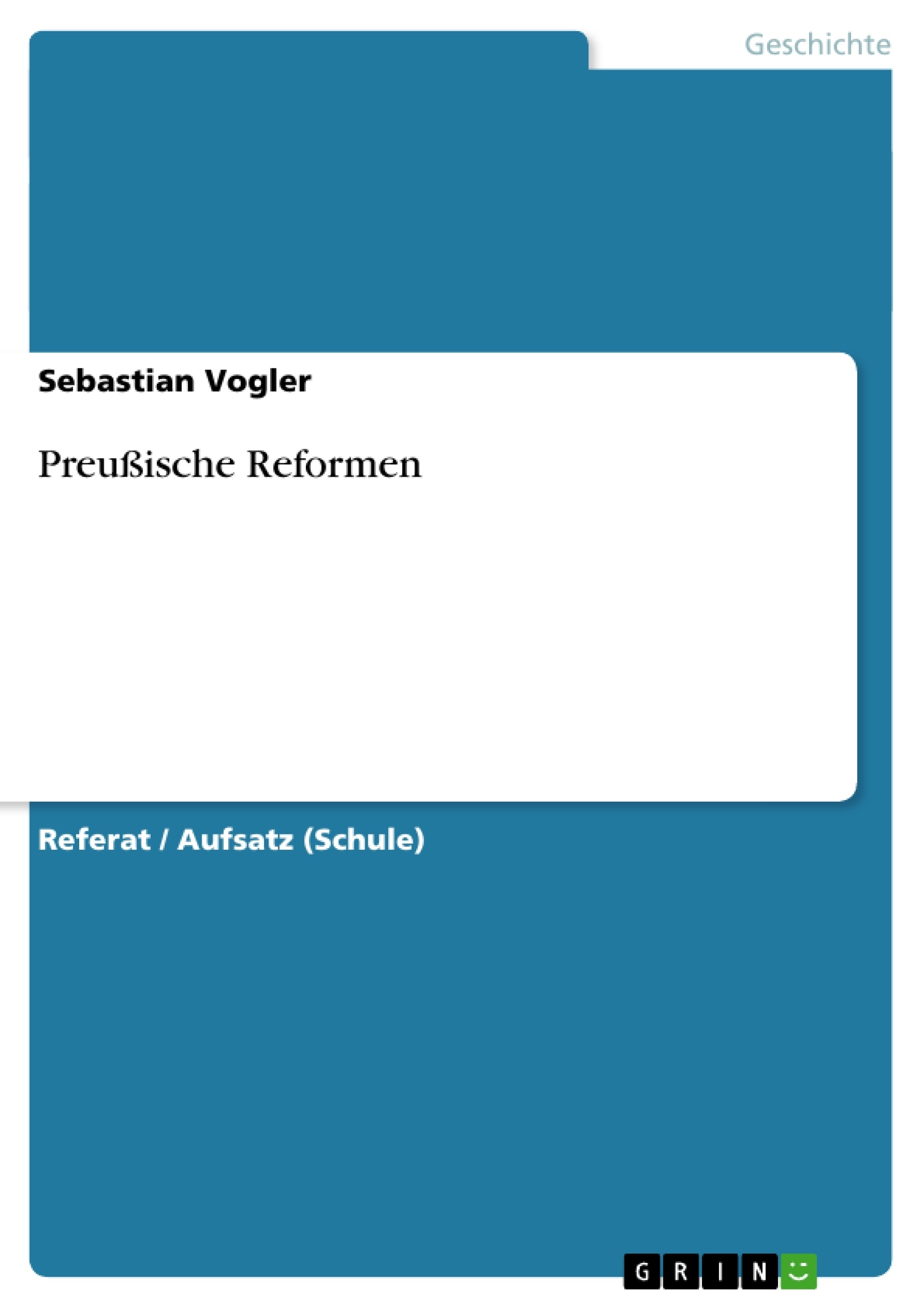In den Wirren der napoleonischen Kriege, als Preußen am Abgrund stand, entzündete sich ein Funke der Erneuerung, der das Königreich nachhaltig verändern sollte. Diese „Revolution von oben“, initiiert von visionären Staatsbeamten wie Stein und Hardenberg, zielte darauf ab, Preußen aus seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rückständigkeit zu befreien und es als moderne Großmacht neu zu positionieren. Doch welche Opfer brachte dieser tiefgreifende Wandel mit sich? Entdecken Sie, wie die preußischen Reformen, von der Liberalisierung des Bauernstandes über die Einführung der Gewerbefreiheit bis hin zur Heeresreform, das Gesicht Preußens wandelten. Erfahren Sie, wie Wilhelm von Humboldts Bildungsreform das Fundament für eine neue Ära des Wissens und der nationalen Identität legte, während die Judenemanzipation zaghafte Schritte in Richtung Gleichberechtigung wagte. Tauchen Sie ein in die komplexen Zusammenhänge der Agrarreform, die zwar den Gutsbesitzern zugutekam, aber auch zur Entstehung eines Landproletariats führte. Verfolgen Sie die Einführung der Stein'schen Städteordnung, die den Bürgern eine Stimme gab und den Keim für eine bürgerliche Verfassungsbewegung legte. Untersuchen Sie die Hindernisse auf dem Weg zu einer gesamtstaatlichen Verfassung und die Konflikte zwischen Tradition und Fortschritt. Dieses Buch enthüllt die Triumphe und Tragödien der preußischen Reformen, die nicht nur Preußen, sondern ganz Deutschland prägten und deren Auswirkungen bis in die moderne Zeit nachwirken. Eine fesselnde Reise durch eine Epoche des Umbruchs, die zeigt, wie aus einer militärischen Niederlage die Saat für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel gesät wurde, der bis heute relevant ist. Die Reformen umfassten die Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und zielten auf eine umfassende Modernisierung des Staates ab. Wesentliche Aspekte waren die Bauernbefreiung, die Bildungsreform nach Humboldtschen Idealen, die Judenemanzipation, die Gewerbefreiheit und die Heeresreform. Diese Maßnahmen stießen jedoch auch auf Widerstand, insbesondere vom Adel, und führten zu sozialen Spannungen, trugen aber letztendlich zur Stärkung des Bürgertums und zur Entwicklung eines Nationalbewusstseins bei. Das Buch analysiert die langfristigen Folgen dieser Reformen und ihren Einfluss auf die deutsche Geschichte.
Preußische Reformen
Vorgeschichte
- Niederlage des preußischen Heeres gegen Napoleon (1806) und Friede von Tilsit (1807)
- Preußen verliert Hälfte seiner Gebiete; keine europ. Großmacht mehr; Reparationszahlungen an Frk.
- gesellsch. rückständig; unmotiviertes Heer; veralteete Militärtaktik
- Ständesystem, keine Verfassung, keine Menschen- u. Bürgerrechte
- Witschaftsschäden u. Kriegsfolgen nur durch umfangreiche Reformen behebbar
- Die nach 1806 eingeleiteten Reformen antworteten also nicht auf gesellschaftlichen Druck von unten - es gab ihn nicht -, sondern sie wurden als ,,Revolution von oben" entworfen und durchgeführt.
- Initiative dazu ging nicht vom entschlußlosen preußischen König aus (Friedrich Wilhelm III., 1797-1840) sondern von leitenden Staatsbeamten.
Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein1
- Seine ,,Nassauer Denkschrift" (1807), Ziel der Reformen: ,, Belebung des Gemeingeistes und Bürgersinns; die Benutzung der schlafenden und falsch geleiteten Kr ä fte und der zerstreut liegenden Kenntnisse; der Einklang zwischen dem Geist der Nation, ihren Ansichten und Bedürfnissen und denen der Staatsbehörden; die Wiederbelebung der Gefühle für Vaterland, Selbst ä ndigkeit und Nationalehre" genannt.
Karl August von Hardenberg2
- Ziel: aufgeklärter Absolutismus Preußens sollte einem Liberalismus weichen; Herstellung einer ,,vernünftige Rangordnung" , die ,,nicht einen Stand vor dem anderen begünstigte, sondern den Staatsbürgern aller Stände ihre Stellen nach gewissen Klassen nebeneinander anwiesen". ,,Aus dem Hauptgrundsatz, daß die natürliche Freiheit nicht weiter beschränkt werden müsse, als es die Notwendigkeit erfordert, folgte schon die mögliche Herstellung des freien Gebrauchs der Kräfte des Staatsbürgers aller Klassen."
1. Reformkomplex Gesellschaft:
Die Liberalisierung des Bauernstandes (1807-1811) (Freiherr vom und zum Stein, von Hardenberg)
- Ständegliederung ,, angekratzt" durch ,,Edict den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend" vom 9. Oktober 1807 (Oktoberedikt), wenige Wochen nach der Berufung von Stein zum Minister, eingeleitet.
- gestattete Bürgern bäuerlichen Grund zu erwerben und in Bauernstand überzutreten
- Bauer sollte frei wirtschaften, der Adlige ein bürgerliches Gewerbe ausüben, der Bürgerliche adligen Grundbesitz erwerben können.
- bedeutete Aufhebung der feudalen Grundherrschaft vor allem östlich der Elbe und der Grundherrschaft westlich der Elbe.
- Gutsherren verloren entschädigungslos die Anrechte auf Zwangsdienste und auf übrige Leistungen.
- Der Adel wurde unterrichtet, ,,daß die seitherige Erbuntertänigkeit dem Kulturgrade aller Staatsbürger nicht mehr angemessen und schädlich sei".
Bildungsreform: (1810-1814) (Wilhelm von Humboldt)
- Besondere an preußischer Bildungsreform: einzigartige Verbindung von Nationalerziehung, Neuhumanismus und Idealismus
- Bildung zweckfrei ,dient Formung des Individuums zur Persönlichkeit
- durch Gesetze und Verordnungen Unterwerfung verschiedener Bildungseinrichtungen unter einheitliche Regelungen:
- Gliederung des Schulwesens
- Einführung bzw. Neuordnung staatlicher Prüfungen
- Abitur als generelle (ab 1834 einzige) Zugangsmöglichkeit zum Universitätenbesuch, Lehrbefugnis an den Universitäten
- Verbeamtung von Lehrern und Hochschullehrern
- Bildungsreform zielte auf Verdrängung von Standesvorrechten
Judenemanzipation: 1812)
- Aufhebung sämtlicher Beschränkungen
- Gleichstellung mit ,,normalen" Bürgern
- nur unzureichend durchgesetzt
2. Reformkomplex Wirtschaft:
Agrarreform (1811)
- Mit dem ,,Regulierungsedict" vom 14. September 1811 sollte allen bäuerlichen Untertanen Eigentum verliehen werden.
- Doch schob sich vor die Verwirklichung die durch das Allgemeine Landrecht gesicherte Entschädigungspflicht.
- Bauer mußte, je nach landschaftlichem Besitzrecht, _ od. _ seines Bodenanteils dem ehemaligen Herrn übergeben oder seinen ganzen Boden durch Renten bzw. Kapital freikaufen.
- Abschaffung d. Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt des Grundherrn
- Die Bauern wurden von den adligen Grundbesitzern oft auf schlechte Böden abgedrängt und konnten dann ihre Höfe nicht halten. · Übergang in Klasse der Tagelöhner .
- Abwanderung in Städte -> Arbeiter ·Förderung der Industrialisierung
- Den Gewinn der Landreform hatten die Gutsbesitzer, die ihren Besitz um ca. 18% vergrößern konnten.
- Die rund 12 000 Rittergüter wurden wirtschaftlich gestärkt. Sie erhielten auch den Großteil der ,,Allmenden", der in den Gemeinden gemeinschaftlich bewirtschafteten Wiesen und Wälder.
Die Gewerbefreiheit (1810)
- Die preußische Gewerbe- und Handelspolitik erstrebte einen gesamtstaatlichen Markt, der bisher durch berufsständische Schranken, durch Privilegien und Binnenzölle (bis 1818) zerschnitten war
- Durch Gewerbefreiheit (1810), die Zunftzwang beseitigte und viele Gesellen selbständig werden ließ, wurde Wirtschaft aufeine breitere Basis gestellt, und höhere Steuereinnahmen wurden erzielt.
- Von den Zunftschranken befreit, verdoppelte sich die Zahl der Handwerker zwischen 1816 und 1846, Entstehung zahlloser Einmannbetriebe
3. Reformkomplex Politik
Die Stein'sche Städteordnung (1808)
- Die Selbstverwaltung sollte das Herzstück der Reformen sein, Stein konnte sie aber nur als Städteordnung (mit staatlichem Aufsichtsrecht) durchsetzen
- In ländlichen Gemeinden und Kreisen scheiterte er am Widerstand des Adels
- Die neue Städteordnung griff auf mittelalterliche Städteverfassungen zurück, übernahm aber auch Einzelheiten aus den Stadtgesetzen der Französischen Revolution · Sie stützte sich im Allgemeinen auf den Hausbesitz in der Annahme, daß die Hauseigentümer am stärksten mit den Belangen des Gemeinwesens verbunden seien. · Hausbesitzer wählten Magistrat, dem ein Bürgermeister vorstand. · Die Beschlüsse des Stadtparlaments (Legislative) waren für den Magistrat (Exekutive) bindend
- Fürsorgeangelegenheiten, Finanz- und Schulwesen waren städtische Aufgaben, Polizei und Gerichtsbarkeit staatliche.
- Die Bürger hatten in der Stadtverordnetenversammlung einen rechtmäßigen Ort der politischen Diskussion.
- bürgerliche Verfassungsbewegung wuchs
- Die Selbstverwaltung wurde zur Vorschule eines gesamtstaatlichen Verfassungsdenkens. Heeresreform: (1811-1814) (Gerhard Johann von Scharnhorst + August Neidhart von Gneisenau )
- Adelsprivileg für Offizierslaufbahn fiel ·stattdessen: Aufstieg durch Wissen, Fähigkeiten · adlige Kadettenschulen blieben grundsätzlich bestehen
- Armee moderner (in Taktik und Führung)
- http://www.geschi.de/cgi-bin/link.cgi?http://www.geschichte.2me.net/dcx_1810.htm
Bis Einführung der allgemeinen Wehrpflicht (vorher war sie durch die Bestimmungen des Pariser Vertrags 1808, die die preußische Heeresstärke auf 42 000 Mann beschränkte, nicht möglich) wurde das sog. Krümpersystem praktiziert: Die Soldaten wurden vor Ablauf ihrer Dienstzeit ,,beurlaubt" und durch neu einberufene Rekruten ersetzt, so daß eine zahlenmäßig
starke Reservearmee entstand
- 1814 Hermann von Boyen Kriegsminister
- Schöpfer allgemeine Wehrpflicht (September 1814) -> unterteilt in Landwehr u. Landsturm · Bürger und Bauern erbrachten Beweis patriotischer Zuverlässigkeit
- mittlerer Schulabschluss ermöglichte Ableistung eines ½ jährigen freiwilligen Dienstes mit anschließender Qualifikation zum Landwehroffizier
- Konservative und Adel missbilligten Landwehr
- gegen Verbürgerlichung des Heeres und für Erhalt des traditionellen Königsheeres
Verfassung und Volksvertretung
- Bereits 1810 konnte Hardenberg Friedrich Wilhelm III. bewegen, in Finanzedikt vom 27. Oktober, das eine verhältnismäßig gleiche Besteuerung vorsah, Verfassungsversprechen einzusetzen
- Das Reformwerk in gesamtstaatliche Verfassung münden zu lassen, scheiterte am Widerstand des konservativen preußischen Adels.
- Die auf dem Wiener Kongreß von allen deutschen Regierungen angenommene Bundesakte hatte jedem Staat den Erlaß einer ,,landständischen Verfassung" vorgeschrieben. · Mit Hilfe einer ständischen Repräsentativverfassung wollten die preußischen Reformer die nationalstaatliche Einheit herbeiführen.
- 1821 entschied schließlich der König durch Kabinettsordre vom II. Juni, daß die Reform auf die Einrichtung der Kreis- und Provinzialstände zu begrenzen sei.
- 1823 wurde für die Provinziallandtage eine Provinzialständische Verfassung geschaffen.
- Unter den Ständevertretern hatte der Adel mit einem Drittel der Abgeordneten das Übergewicht.
- Allerdings hatten die Abgeordneten nur beratende Funktionen und Zuständigkeiten für die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Provinz.
- Somit erwies diese Verfassung sich als ein Kompromiß zwischen altständischer Repräsentation und modernen Tendenzen.
- Zwischen dem monarchischen Prinzip, nach dem die alleinige und einheitliche Staatsgewalt in der Hand des Monarchen liegt, und demokratischen Vorstellungen gab es keinen Kompromiß.
- Alle Bestrebungen nach einer übergreifenden Verfassungsordnung, die in Parteien oder in der Presse laut werden konnten, wurden zensiert und unterdrückt.
- Es entstand eine Herrschaft aus staatlicher Bürokratie und selbständiger Landaristokratie.
- Der Adel konnte seinen politischen Einfluß auf der Ebene des Gutes und Kreises festigen, das Stadtbürgertum mit seinen wirtschaftlichen Erfolgen ein politisches Selbstbewußtsein entwickeln.
- Der Verwaltungsstaat hatte Schwächen: Die unerfüllten bürgerlichen Verfassungsforderungen und die soziale Krise, die mit Fabrikarbeiterschaft und Landproletariat entstanden, trieben in Richtung Revolution.
- Andererseits haben die preußischen Reformen durch ihre die alte Ständegesellschaft verändernden Inhalte in vieler Hinsicht nachhaltiger gewirkt als die liberale Bewegung des Vormärz und die Revolution von 1848.
[...]
1 Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757-1831), aus nassauischem reichsritterlichem Geschlecht, Aufgeklärtes Denken ließ ihn die Selbstverwaltung als Kern eines zeitgemäßen Gemeinwesens begreifen.
Häufig gestellte Fragen zu den Preußischen Reformen
Was waren die unmittelbaren Ursachen für die Preußischen Reformen?
Die Preußischen Reformen wurden hauptsächlich durch die Niederlage Preußens gegen Napoleon im Jahr 1806 und den Frieden von Tilsit 1807 ausgelöst. Preußen verlor die Hälfte seiner Gebiete, seinen Status als europäische Großmacht und war zu Reparationszahlungen an Frankreich verpflichtet. Zudem wurde die gesellschaftliche Rückständigkeit, das unmotivierte Heer und die veraltete Militärtaktik deutlich. Wirtschaftsschäden und Kriegsfolgen machten umfassende Reformen notwendig.
Wer waren die Schlüsselfiguren der Preußischen Reformen?
Zu den wichtigsten Persönlichkeiten gehörten Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, der mit seiner ,,Nassauer Denkschrift" die Belebung des Gemeingeistes und Bürgersinns anstrebte, sowie Karl August von Hardenberg, dessen Ziel ein Liberalismus anstelle des aufgeklärten Absolutismus war. Auch Wilhelm von Humboldt spielte eine zentrale Rolle bei der Bildungsreform.
Was beinhaltete die Liberalisierung des Bauernstandes?
Das Oktoberedikt von 1807 ermöglichte es Bürgern, bäuerlichen Grund zu erwerben und in den Bauernstand überzutreten. Bauern sollten frei wirtschaften können, der Adel bürgerliche Gewerbe ausüben und Bürgerliche adligen Grundbesitz erwerben können. Dies bedeutete die Aufhebung der feudalen Grundherrschaft östlich der Elbe und der Grundherrschaft westlich der Elbe.
Was war das Ziel der Bildungsreform unter Wilhelm von Humboldt?
Die Bildungsreform zielte auf eine einzigartige Verbindung von Nationalerziehung, Neuhumanismus und Idealismus ab. Bildung sollte zweckfrei sein und der Formung des Individuums zur Persönlichkeit dienen. Durch Gesetze und Verordnungen wurden verschiedene Bildungseinrichtungen unter einheitliche Regelungen gestellt, was zur Verdrängung von Standesvorrechten führte.
Was bedeutete die Judenemanzipation von 1812?
Die Judenemanzipation von 1812 sollte sämtliche Beschränkungen für Juden aufheben und sie mit ,,normalen" Bürgern gleichstellen. Allerdings wurde dies nur unzureichend umgesetzt.
Was regelte die Agrarreform von 1811?
Mit dem ,,Regulierungsedict" von 1811 sollte allen bäuerlichen Untertanen Eigentum verliehen werden. Allerdings mussten Bauern, je nach Besitzrecht, einen Teil ihres Bodens an den ehemaligen Herrn übergeben oder ihren gesamten Boden durch Renten bzw. Kapital freikaufen. Dies führte oft zur Abwanderung von Bauern in die Städte und zur Stärkung der Gutsbesitzer.
Welche Auswirkungen hatte die Gewerbefreiheit von 1810?
Die Gewerbefreiheit von 1810 beseitigte den Zunftzwang und ermöglichte es vielen Gesellen, sich selbstständig zu machen. Dies führte zu einer breiteren Basis der Wirtschaft und höheren Steuereinnahmen. Die Zahl der Handwerker verdoppelte sich zwischen 1816 und 1846.
Was war die Stein'sche Städteordnung von 1808?
Die Stein'sche Städteordnung von 1808 sollte die Selbstverwaltung der Städte stärken. Hausbesitzer wählten einen Magistrat, dem ein Bürgermeister vorstand. Die Beschlüsse des Stadtparlaments waren für den Magistrat bindend. Fürsorgeangelegenheiten, Finanz- und Schulwesen waren städtische Aufgaben, Polizei und Gerichtsbarkeit staatliche.
Was beinhaltete die Heeresreform von 1811-1814?
Die Heeresreform unter Gerhard Johann von Scharnhorst und August Neidhart von Gneisenau führte dazu, dass das Adelsprivileg für die Offizierslaufbahn fiel und stattdessen Wissen und Fähigkeiten für den Aufstieg entscheidend waren. Die Armee wurde moderner in Taktik und Führung. Die allgemeine Wehrpflicht wurde 1814 eingeführt.
Warum scheiterte die Einführung einer gesamtstaatlichen Verfassung in Preußen?
Die Einführung einer gesamtstaatlichen Verfassung scheiterte am Widerstand des konservativen preußischen Adels. Stattdessen wurden Kreis- und Provinzialstände eingerichtet, wobei der Adel weiterhin das Übergewicht hatte. Alle Bestrebungen nach einer übergreifenden Verfassungsordnung wurden zensiert und unterdrückt.
- Quote paper
- Sebastian Vogler (Author), 2000, Preußische Reformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98424