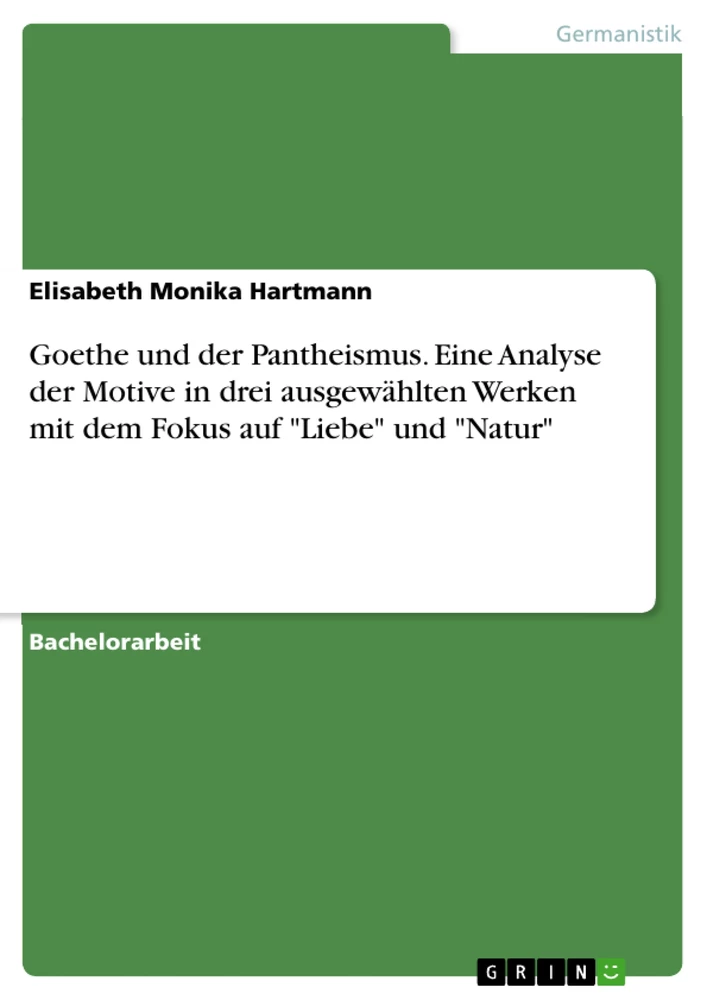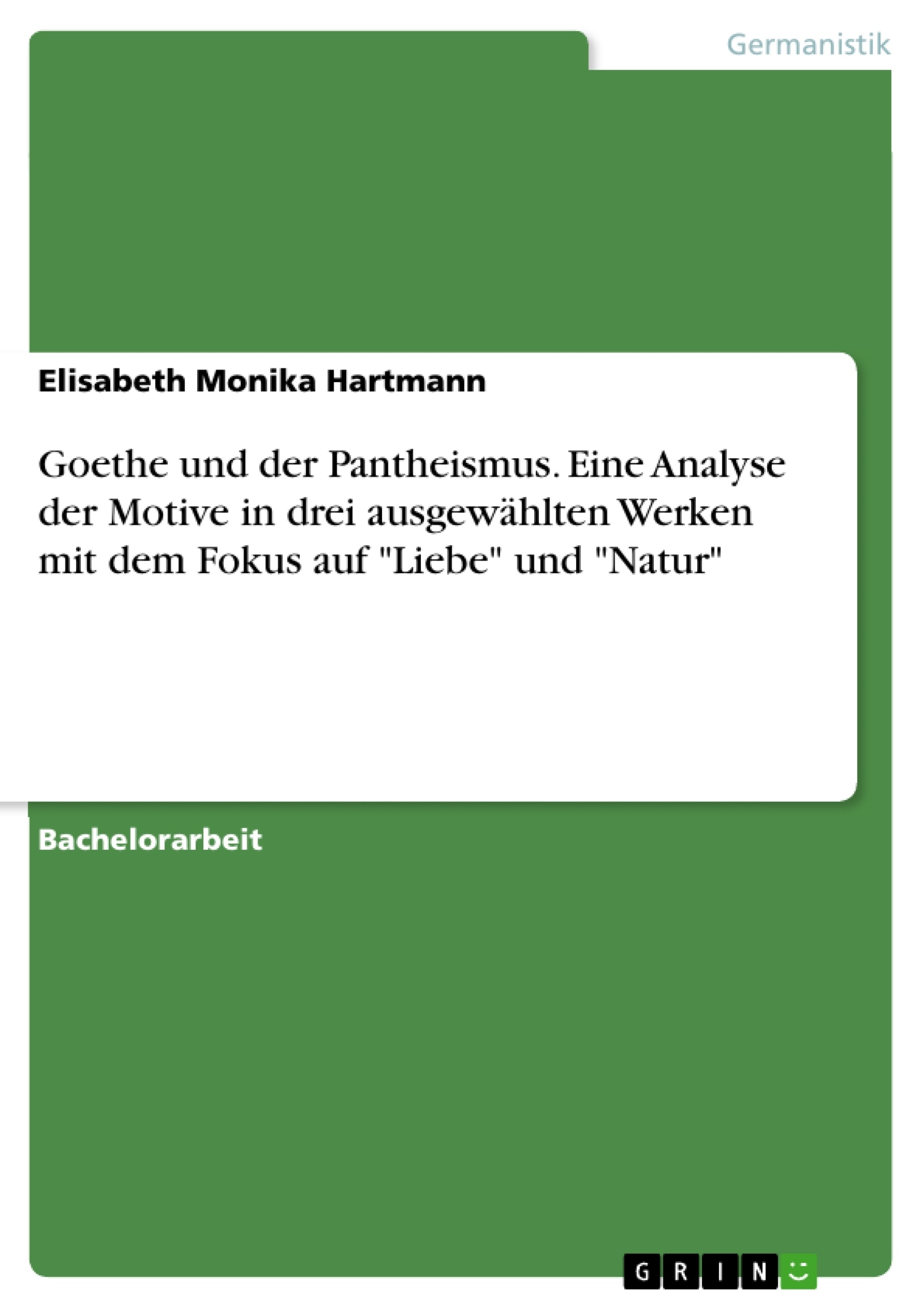Was hat Goethe mit dem Pantheismus zu tun, welche verschiedenen Formen und Auslegungen des Pantheismus gibt es, und wie sieht es mit der Problematik von Liebe und der Natur aus? Diese Fragen werden in dieser Arbeit sowohl anhand zweier Gedichte - dem "Mailied" (1771) als Erlebnislyrik und der mythologischen Hymne "Ganymed" - als auch anhand des "Brief vom 10. Mai" aus dem Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" (1774), erörtert. Dabei wird genauer auf die Ähnlichkeiten, Differenzen und Entwicklungen in Bezug auf das Göttliche der drei Texte eingegangen und hinterfragt, wo es eine Distanz vom Überschwang der Empfindungen gibt.
Der Beginn der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit der Religiosität in der Zeit der Empfindsamkeit und es wird genauer untersucht, was es mit dem Geniegedanken auf sich hat und von welchen Glaubensrichtungen der junge Goethe beeinflusst wurde.
Die Jahre von Goethes Anfängen als Schriftsteller - zwischen 1765 (dem Beginn seines Jurastudiums in Leipzig) und 1775 (dem Jahr seines Umzuges nach Weimar) - gelten in der Literaturgeschichtsschreibung als kritischer Zeitraum des Wandels von der Aufklärung zum Sturm und Drang. Für die Illustration dieses Prozesses wird Goethe mit seinem ganzen frühen Werk beansprucht wie kein anderer Autor seiner Generation. Das schriftstellerische Schaffen des jungen Goethe war der Anfang eines neuen Zeitalters der Dichtkunst (Poesie). Das Jugendwerk Goethes gibt deutlich etwas von seinem Naturverständnis preis. Hinzu komme - so Thorsten Valk - eine ausgeprägte Natursehnsucht, die nicht nur, aber auch auf die fortschreitende Verstädterung im späten 18. Jahrhundert reagiere. Im Rückgriff auf Jean-Jaques Rousseaus kulturkritische Schriften werde die unberührte Natur idealisiert, während der zivilisatorische Fortschritt als unumkehrbares Zerstörungswerk interpretiert werde.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Religiosität in der Zeit der Empfindsamkeit
- 2.1 Der junge Goethe in der Genieperiode des Sturm und Drang
- 2.2 Goethes Bezug zum Pietismus
- 3 Pantheistische Denkweisen
- 3.1 Goethe und der Pantheismus
- 3.2 Verschiedene Auslegungen und Formen des Pantheismus
- 4 Analyse und Interpretation ausgewählter Texte des jungen Goethe
- 4.1 Das Gedicht „Mailied“ (1771) als Erlebnislyrik
- 4.2 Die mythologische Hymne „Ganymed“
- 4.3 Werthers „Brief vom 10. Mai“
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Pantheismus im Frühwerk Goethes. Sie analysiert, wie sich pantheistische Denkweisen in seinen Gedichten und Briefen manifestieren und wie diese mit seiner religiösen Entwicklung und dem Zeitgeist der Empfindsamkeit zusammenhängen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss des Pietismus und des Sturm und Drang auf Goethes Weltanschauung.
- Goethes religiöse Entwicklung in der Zeit des Sturm und Drang
- Der Pantheismus als zentrales Thema im Frühwerk Goethes
- Analyse ausgewählter Texte (Mailied, Ganymed, Brief vom 10. Mai aus den Leiden des jungen Werthers)
- Der Einfluss von Natur und Liebe auf Goethes pantheistische Sichtweise
- Vergleich und Kontrast verschiedener Auslegungen des Pantheismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Zeitraum von 1765 bis 1775 als eine kritische Phase des Übergangs von der Aufklärung zum Sturm und Drang in der Literaturgeschichte, wobei Goethes frühes Werk als exemplarisch für diesen Wandel gilt. Es wird auf Goethes Naturverständnis und seine ausgeprägte Natursehnsucht eingegangen, die als Reaktion auf die zunehmende Verstädterung interpretiert werden kann. Die Polarität in Goethes Werk, insbesondere zwischen Natur und Liebe, wird hervorgehoben, und der Pantheismus als zentrales Thema der Arbeit wird eingeführt. Die Einleitung legt den Fokus auf die Definition und die verschiedenen Auslegungen des Pantheismus, insbesondere im Kontext der philosophischen Debatten um Spinoza und Toland.
2 Religiosität in der Zeit der Empfindsamkeit: Dieses Kapitel erörtert die religiösen Strömungen der Zeit, insbesondere den Deismus und den Einfluss des Pietismus. Es wird untersucht, wie die Aufklärer zumeist zwar an einen Schöpfer glaubten, sich aber in ihren Aussagen über Gott auf die Vernunft beschränkten. Im Kontrast dazu wird die Empfindsamkeit als literarische Strömung vorgestellt, die die neuen, widersprüchlichen Gefühle der Zeit erkundet und den Fokus auf das Gefühl statt die Vernunft setzt. Der Zusammenhang zwischen Empfindsamkeit und Pietismus wird beleuchtet. Das Kapitel schließt mit einem Hinweis auf den Sturm und Drang, der den individuellen, fühlenden Menschen in den Mittelpunkt stellt.
3 Pantheistische Denkweisen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen und Auslegungen des Pantheismus. Es werden verschiedene Denker und Philosophen (Spinoza, Kant, Herder, Lessing etc.) erwähnt, die den Pantheismus vertraten. Der zentrale Gedanke des Pantheismus, die Einheit von Gott und Kosmos, wird erläutert. Es wird auf die Schwierigkeit der vollen Erkenntnis des Göttlichen hingewiesen, und die Bedeutung der Poesie und der Philosophie für die Annäherung an diese Erkenntnis wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Pantheismus, Goethe, Sturm und Drang, Empfindsamkeit, Pietismus, Natur, Liebe, Religiosität, Erlebnislyrik, „Mailied“, „Ganymed“, „Die Leiden des jungen Werthers“, Geniegedanke, Deismus, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pantheismus im Frühwerk Goethes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Pantheismus im Frühwerk Johann Wolfgang von Goethes (ca. 1765-1775). Sie analysiert, wie pantheistische Denkweisen in seinen Gedichten und Briefen zum Ausdruck kommen und wie diese mit seiner religiösen Entwicklung und dem Zeitgeist der Empfindsamkeit zusammenhängen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Einfluss des Pietismus und des Sturm und Drang auf Goethes Weltanschauung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Goethes religiöse Entwicklung während des Sturm und Drang, den Pantheismus als zentrales Thema in seinem Frühwerk, analysiert ausgewählte Texte (Mailied, Ganymed, Brief vom 10. Mai aus den Leiden des jungen Werthers), untersucht den Einfluss von Natur und Liebe auf Goethes pantheistische Sichtweise und vergleicht verschiedene Auslegungen des Pantheismus.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Goethes Gedicht „Mailied“ (1771), die mythologische Hymne „Ganymed“ und einen Brief Werthers vom 10. Mai aus „Die Leiden des jungen Werthers“. Diese Texte werden im Hinblick auf ihre pantheistischen Elemente interpretiert.
Wie wird der Pantheismus definiert und eingeordnet?
Die Arbeit definiert den Pantheismus als die Lehre von der Einheit von Gott und Kosmos. Sie diskutiert verschiedene philosophische Auslegungen des Pantheismus bei Denkern wie Spinoza, Kant, Herder und Lessing und beleuchtet die Schwierigkeiten, das Göttliche vollständig zu erfassen. Die Rolle der Poesie und Philosophie bei der Annäherung an diese Erkenntnis wird ebenfalls diskutiert.
Welchen historischen Kontext betrachtet die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum von 1765 bis 1775, eine Übergangszeit von der Aufklärung zum Sturm und Drang. Sie untersucht die religiösen Strömungen dieser Epoche, insbesondere den Deismus, den Pietismus und die Empfindsamkeit, und deren Einfluss auf Goethes Werk. Der Sturm und Drang wird als literarische Bewegung präsentiert, die den individuellen, fühlenden Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pantheismus, Goethe, Sturm und Drang, Empfindsamkeit, Pietismus, Natur, Liebe, Religiosität, Erlebnislyrik, „Mailied“, „Ganymed“, „Die Leiden des jungen Werthers“, Geniegedanke, Deismus, Aufklärung.
Welche Kapitelstruktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Religiosität in der Zeit der Empfindsamkeit, ein Kapitel über pantheistische Denkweisen, ein Kapitel zur Analyse ausgewählter Texte Goethes und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext und führt in die Thematik ein. Die Kapitel untersuchen die religiösen und philosophischen Hintergründe sowie die literarische Umsetzung des Pantheismus im Frühwerk Goethes.
- Citar trabajo
- Elisabeth Monika Hartmann (Autor), 2014, Goethe und der Pantheismus. Eine Analyse der Motive in drei ausgewählten Werken mit dem Fokus auf "Liebe" und "Natur", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/983516