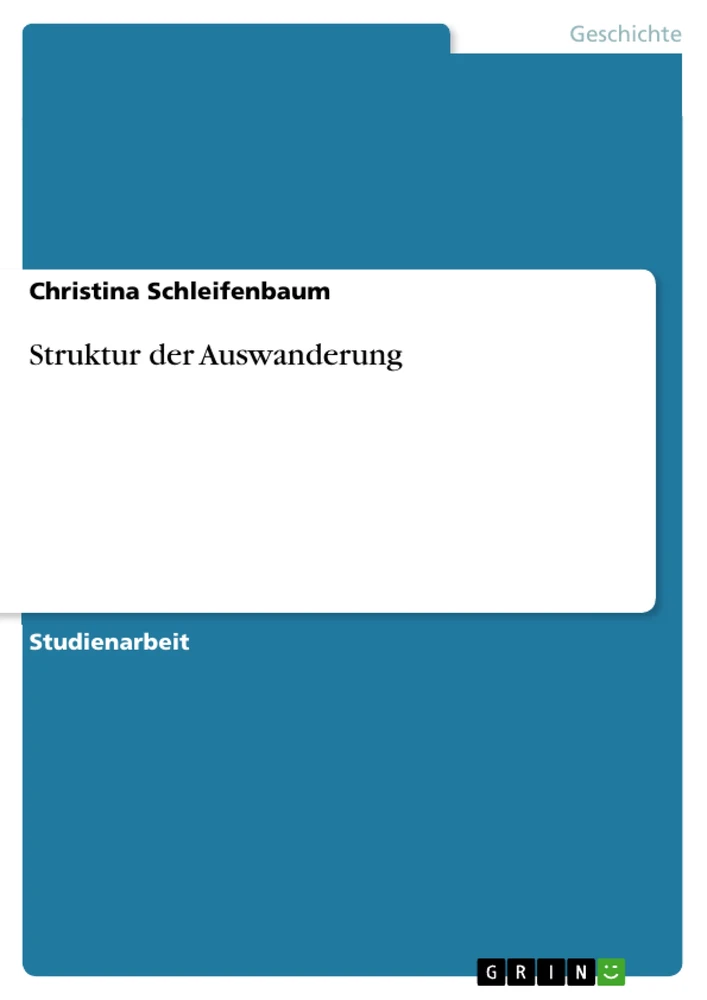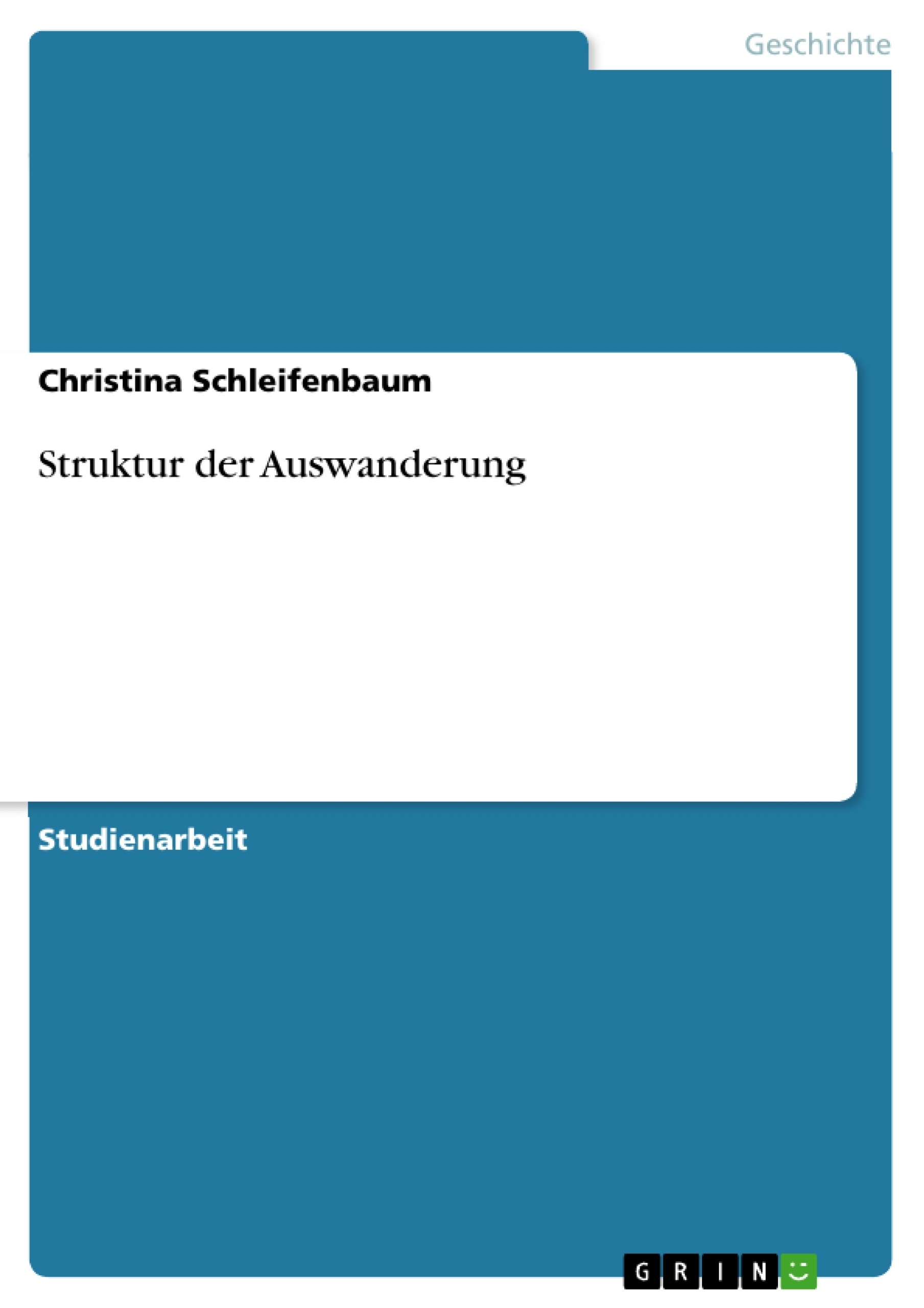Diese Arbeit soll einen Überblick über die Strukturen der Auswanderung im 19. Jahrhundert bieten. Als Erstes werden daher allgemeine Faktoren, wie wirtschaftliche, soziale und politische untersucht, um die Motivation zur Auswanderung erklären zu können. Aus dieser Untersuchung werden sich verschiedene Wanderungswellen ergeben. Auch allgemeine Tendenzen der Bevölkerungs- und Auswanderungsentwicklung sollen miteinander verglichen werden, um einerseits zu veranschaulichen, wie unterschiedlich die beiden Strukturen sind und andererseits den Einfluss der Auswanderung auf die Bevölkerungsstruktur darzustellen.
In einem spezielleren Untersuchungsabschnitt wird auf die Formen der Auswanderung näher eingegangen. Zum einen auf Familien- und Einzelauswanderung, die sich im Verlauf des Jahrhunderts verändert, zum anderen auf Charakteristika des Auswanderers, wie Alter, Geschlecht, Beruf, Vermögen und Wahl des Schiffstyps. Diese Analyse soll Aufschluss darüber geben, wie sich diejenigen Gruppen, die zur Auswanderung bereit waren, im Laufe der Zeit veränderten, und welche Art von Menschen ihr Land verließen, um einen Neuanfang zu wagen.
Gliederung
1.) Einleitung
2.) Ursachen und Verlauf ( push and pull- Faktoren )
a) wirtschaftliche Faktoren
b) politische/religiöse/ individuelle Motivation
c) Wanderungsverlauf aufgrund der wirtschaftlichen Faktoren
3.) Bevölkerungs- und Auswanderungsentwicklung allgemein
4.) Einzel- und Familienauswanderung
5.) Strukturen der Auswanderung
a) Alter
b) Geschlecht
c) Beruf
d) Vermögen
e) Wahl des Schifftyps
6.) Zusammenfassung
7.) Literaturangaben
8.) Anhang
Diagramm 1: Deutsche Bevölkerungszunahme
Diagramm 2: Familien und Einzelwanderung im Raum Alzey
Diagramm 2a: Familienwanderung und -größe
Diagramm 3: Württembergische Wohnbevölkerung 1861
Diagramm 3a: Altersstruktur in den Hamburger Schiffslisten
Diagramm 4: Deutsche überseeische Auswanderung
Diagramm 5: Berufsentwicklung der württembergischen Auswanderer
1.) Einleitung:
Diese Arbeit soll einen Überblick über die Strukturen der Auswanderung im 19. Jahrhundert bieten. Als erstes werden daher allgemeine Faktoren, wie wirtschaftliche, soziale und politische untersucht, um die Motivation zur Auswanderung erklären zu können. Aus dieser Untersuchung werden sich verschiedene Wanderungswellen ergeben. Die “push and pull“ Faktoren dieser Wanderungsbewegungen verdeutlichen werden. Auch allgemeine Tendenzen der Bevölkerungs- und Auswanderungsentwicklung sollen miteinander verglichen werden, um einerseits zu veranschaulichen wie unterschiedlich die beiden Strukturen sind und andererseits den Einfluß der Auswanderung auf die Bevölkerungsstruktur darzustellen.
In einem spezielleren Untersuchungsabschnitt wird auf die Formen der Auswanderung näher eingegangen. Zum einen auf Familien- und Einzelauswanderung, die sich im Verlauf des Jahrhunderts verändert, zum anderen auf Charakteristika des Auswanderers, wie Alter, Geschlecht, Beruf, Vermögen und Wahl des Schifftyps. Diese Analyse soll Aufschluß darüber geben, wie sich diejenigen Gruppen, die zur Auswanderung bereit waren, im Laufe der Zeit veränderten, und welche Art von Menschen ihr Land verließen, um einen Neuanfang zu wagen.
Die Untersuchung von Auswanderungsstrukturen, sprich von Statistiken die einen Nachweis über die Charakteristika der Emigranten geben, ist ein wichtiger Bestandteil der Beurteilung über das Auswanderungsverhalten der Deutschen im 19. Jahrhundert. Die Statistiken bergen aber auch Probleme in sich, die bei der Darstellung zu berücksichtigen sind. Man findet man kaum Statistiken, die sich auf Gesamtdeutschland beziehen. Detaillierte Untersuchungen wurden fast ausschließlich im regionalen Rahmen vorgenommen. Somit erweist es sich als schwierig, die aus den Auswandererdaten gewonnen Erkenntnisse in einen umfassenden Rahmen zu bringen. In dieser Arbeit kann deshalb nur auf einzelne Teilstaaten Deutschlands eingegangen werden. Wegen der großen Anzahl an Auswanderern ist hierbei besonders der Südwesten Deutschlands zu berücksichtigen. Eine weitere Schwierigkeit bergen die staatlichen Aufzeichnungen der einzelnen Länder in sich. Die erfaßten Daten beziehen sich
nur auf Auswanderer, die mit behördlicher Erlaubnis das Land verließen.
Illegale Auswanderer sind hierbei nur in den seltensten Fällen erfaßt. Man kann somit aus diesen Daten keine hundertprozentig zuverlässige Angabe über die Zahl der Auswanderer bekommen. Hilfreich hierbei sind jedoch die Schiffslisten der Reedereien, die auch die Illegalen erfassen. Da allerdings nur Daten von Bremen und Hamburg vorliegen, wird man auch hier nur eine kleine Anzahl der Auswanderer statistisch erfaßt finden. Angaben von den Häfen Le Havre,
Rotterdam und Amsterdam, über die ein Großteil der Menschen aus Süd-West- Deutschland nach Amerika das Land verließ, fehlen.
Man muß die Statistiken ausführlich betrachten und dabei darauf achten
welcher Aufbaustrukturen sie sich bedienen. Probleme ergeben sich hierbei, wenn man zwei verschiedene Statistiken über denselben Inhalt vergleichen möchte, da aufgrund der unterschiedlichen Handhabung des Zahlenmaterials, sprich der verschiedenen Ordnungsprinzipe oft keine direkten Vergleiche möglich sind.
2.) Ursachen und Verlauf:
Allgemein läßt sich sagen, daß es zwei große Beweggründe zur Auswanderung gibt. Den “push-Faktor“ als von der Heimat wegtreibende Kraft, der besonders bei wirtschaftlichen Miseren, wie Mißernten, Lebensmittelteuerungen, aber auch aufgrund von Wirtschaftskrisen im Zielland zum Tragen kommt. Und der “pull- Faktor“ als anziehende Kraft des Ziellandes, der an die individuellen Erwartungen des Auswanderers, wie günstige Ansiedlungsbedingungen und wirtschaftliche Stabilität der neuen Heimat geknüpft ist. Positiv auf den Auswanderungswillen wirken sich auch Briefe von Verwandten und Bekannten aus. Diese beiden Faktoren stehen in den meisten Auswanderungsfällen in Wechselwirkung und erklären so die Ursachen für die Auswanderung.1
a) Wirtschaftliche Faktoren:
Ein Grund das Heimatland für immer zu verlassen ist die wirtschaftliche
Situation. Im 19. Jahrhundert gab es immer wieder Mißernten, Kälteeinbrüche und Unwetter, die Lebensmittelpreise ansteigen ließen und es den Menschen
unmöglich machten sich ausreichend zu ernähren. Die Mißernte von 1816/172
und die daraus resultierende Teuerung veranlaßte 35 000 Einwohner
Südwestdeutschlands auszuwandern. Davon gingen 20 000 nach Nordamerika. In Tabelle 33 von Wolfgang von Hippel geben 1817 89,6% der Befragten als Grund für ihre Emigration Vermögenszerfall, Nahrungslosigkeit und Hoffnung auf besseres Glück an.3 Nachdem 1817 die Ernte wieder besser ausfiel ebbte die Wanderungslust ab. In der Pfalz wanderten ab den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wieder vermehrt Menschen aus. Die Zollpolitik war hierbei ein entscheidender Faktor, da besonders die Weinbauern durch hohe Ausfuhrzölle Absatzschwierigkeiten hatten. Erst die Gründung des Deutschen Zollvereins 1834/35 brachte eine Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Pfalz. Ein weiterer Grund das Land zu verlassen war die Bevölkerungszunahme im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts und die:“ Besitzsplitterung infolge der althergebrachten und durch den Code Civil noch weiter geförderten Erb- oder Realteilung...“4, die den landwirtschaftlichen Betrieb schwächte. Den Handwerkern schadete die Liberalisierung der gewerblichen Arbeitsverfassung, die Mechanisierung und der Ausbau des Fabrikwesens. In den 40er Jahren des
19. Jahrhunderts brachten wiederholte Mißernten und die Kartoffelfäule die
Einwohner erneut zur Auswanderung. Die Situation besserte sich erst ab 1855 als die Wirtschaft in Deutschland stabiler wurde. Gleichzeitig gab es in Amerika von 1854-1856 eine Wirtschaftskrise, die den Anreiz auszuwandern abschwächte. Auch der amerikanische Bürgerkrieg von 1861-1865 war Grund für geringere Auswanderungszahlen. Ähnlich wie in der Pfalz sah es auch in anderen Teilen Deutschlands aus. Mißernten, Viehseuchen und Unwetter hatten immer wieder eine Teuerung der Lebensmittelpreise zur Folge. In diesen schlechten Zeiten versuchten die Menschen durch Auswanderung ihrer elenden Situation zu entgehen.
b) Politische/religiöse/individuelle Motivation
„ In der älteren Literatur findet sich fast durchweg die Ansicht, daß infolge der Karlsbader
Beschlüsse von 1819, der Ereignisse in den 30er Jahren sowie im Anschluß an die Revolution von 1848/49 Tausende vor politischem Druck und Verfolgung geflohen seinen.“5
In der neueren Literatur vertritt man diese Meinung nicht mehr. Nach dem
Hambacher Fest 1832 werden 187 Pfälzer staatlich verfolgt, von diesen sind jedoch nur etwa 1/3 in die Schweiz, nach Frankreich oder Amerika ausgewandert. Nach der 1848er Revolution flohen zwar einige Tausend in das benachbarte Ausland, besonders in die Schweiz, die meisten kehrten aber wieder in ihr Heimatland zurück.6 Der Schweizer Konsul in Le Havre zählte nur 1006 deutsche politische Flüchtlinge die über diesen Hafen nach Amerika auswanderten. Man kann also nicht von einer massiven Flucht aus politischen Gründen reden.
Ein Auswanderungsgrund, der zumindest vom Staat verursacht wurde, war das Verlassen der Heimat aufgrund des Militärdienstes. Viele junge Männer entzogen sich der Wehrpflicht, indem sie nach Amerika übersiedelten. In dieser Gruppe findet sich auch der größte Teil der illegalen Auswanderer, da der Staat Maßnahmen ergriff um die Wehrpflichtigen an ihrer Ausreise zu hindern. Am
23.6.1817 erließ z.B. der preußische Innenminister ein Gesetz, das jungen Männern zwischen 17 und 25 Jahren verbot auszuwandern. Es wurde eine Kommission gegründet, die untersuchen sollte, ob die oben genannten nur auswanderten um sich der Militärpflicht zu entziehen. 1837 verfügte die Bezirksregierung des preußischen Saarlandes, daß illegale Auswanderer, die sich vor dem Militärdienst drücken wollen eine Gefängnisstrafe von 6 Wochen, oder eine Geldbuße von bis zu 50 Talern abzuleisten haben. Solche Gesetze und Bestimmungen wurden immer wieder neu verfaßt und verschärft, woran man erkennen kann, daß trotz der Strafen noch viele Wehrpflichtige unerlaubt das Land verließen.
Auch die Auswanderung aus religiösen Motiven spielt keine große Rolle und hat es auch nie getan. Selbst im 18. Jahrhundert wanderten, abgesehen von einigen Mennoniten kaum Menschen wegen ihrer Religion aus. Im 19. Jahrhundert hatte dann auch die Auswanderung von Mennoniten mehr wirtschaftliche als religiöse Beweggründe. Ausnahme ist Württemberg, wo:“ religiöse Motive vor allem während der beiden Auswanderungswellen von 1803/04 und 1816/17 eine gewisse Rolle spielten...“7. 1817 gaben 5,5% der 17 216 Emigranten an aus religiösen Gründen auszuwandern.8
Individuelle Auswanderungsmotive kann man heute nur noch schwer ermitteln,
da in der Regel keine Aufzeichnungen darüber Aufschluß geben. In diesen
Bereich gehören z.B. diejenigen, die das Land verließen um:“ zerrütteten Eheund Familienverhältnissen zu entkommen oder den mit schweren persönlichen Schicksalsschlägen in der Heimat verbundenen Erinnerungen auszuweichen [...]“9. Auch Mütter mit unehelichen Kindern verließen die Heimat, um ohne diesen „Makel“ neu anzufangen. Teilweise wanderten Verbrecher aus um sich der Strafverfolgung zu entziehen, oder total verschuldete Menschen. Viele davon hatten schon Verwandte in Amerika.10
In den Bereich der persönlichen Gründe gehören aber auch Risikobereitschaft, Intelligenz und Bildungsstand, sowie die Qualität der Verkehrsverbindungen, Dauer und Risiken der Reise, Kosten für die Transportmittel und organisatorische Absicherung.11 Der Auswanderungswillige wägte all diese Faktoren ab, bevor er sich zur Reise entschloß. Der Anteil dieser Ursachen an denen der Gesamtwanderung ist jedoch verschwindend gering.
c) Wanderungsverlauf aufgrund der wirtschaftlichen Faktoren:
Wie oben erwähnt war die Hauptursache der Auswanderung die wirtschaftliche Situation. Man kann deshalb den Verlauf der Wanderbewegung am deutlichsten an diesem Faktor aufzeigen. Daraus ergeben sich vier große Wanderungswellen. 1816/17 wanderten besonders aus der Pfalz die Menschen wegen der Mißernte von 1816, Überschwemmungen und der Versorgung der alliierten Truppen in Frankreich mit Getreide aus. Dies waren circa 35 000 Menschen. Das Hauptziel der Auswanderer war noch nicht Nordamerika, sondern Rußland und Polen. In den 1820ern und 30ern fand wie oben erwähnt ein Preisverfall für Agrarprodukte statt. Wiederholte Mißernten kamen dazu und ließen die Auswanderungszahlen wieder anwachsen. Es wanderte insbesondere der Mittelstand aus, dessen Hauptziel nun Nordamerika geworden war. Das Pauperismusjahrzehnt 1845-55 hatte zu einer Verarmung der Bevölkerung durch Loslösung von der Grundherrschaft und der Zunftverfassung mit einer gleichzeitigen Bevölkerungszunahme geführt. Auch in dieser Zeit gab es Mißernten, die das Verlassen der Heimat begünstigten. Die Auswanderung nahm nun ein riesiges Ausmaß an, zwischen 1845 und 1855
verließen 63 43712 Menschen die Pfalz, so viele wie in keinem Jahrzehnt davor
und danach. Als es Ende 1854 in Amerika eine Wirtschaftskrise gab, war der Wanderungsboom wieder zuende. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wanderten hauptsächlich die Menschen aus, die es sich vorher nicht leisten konnten. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hatte sich relativ stabilisiert und bot nun keinen direkten Auswanderungsanlaß mehr. Nun stand die Binnenwanderung im Vordergrund, da sich durch die Entwicklung industrieller Zentren, wie Ludwigshafen, Kaiserslautern und das Ruhrgebiet neue Arbeitsplatzmöglichkeiten boten. Viele Menschen zogen aus ihrer alten Heimat in solch ein wirtschaftlich attraktives Gebiet, oder pendelten als Saisonarbeiter zwischen zwei Orten.
3.) Bevölkerungs- und Auswanderungsentwicklung allgemein:
Problematisch bei der statistischen Erfassung der Auswanderer ist, daß bis weit ins 19. Jahrhundert kaum amtliche Statistiken vorhanden sind. Die Akten die angelegt wurden sind nicht immer ausführlich geführt worden und viele Ämter waren:“ bestrebt, die Auswandererzahlen in ihrer Verwaltungseinheit möglichst niedrig erscheinen zu lassen.“13 Dies führte dazu, daß nicht alle Emigranten erfaßt wurden. In den Ämtern wurde auch meist keine Unterscheidung zwischen Übersee- und Binnenwanderung gemacht, womit es zu einer Verfälschung der Auswanderungszahlen kam.
Insgesamt wanderten zwischen 1820 und 1900 nach Friedrich Burgdörfer
5.051.47514 Menschen aus dem Deutschen Reich aus. Höhepunkte waren hier die Jahre 1852-54 und 1867/68. In Diagramm 4 kann man diese Wanderungsspitzen erkennen. Der Verlauf für Gesamtdeutschland ist jedoch verschieden von dem für Süd-West-Deutschland, bzw. der Pfalz, der vier Wanderungshöhepunkte aufweist.15
Beachtlich ist, daß in manchen Deutschen Staaten ein Bevölkerungsrückgang aufgrund der Auswanderung festzustellen ist, und dies obwohl die Bevölkerung im 19. Jahrhundert relativ stark zunahm. In der Pfalz zum Beispiel gab es in den
Jahren 1852 und 1855 einen Bevölkerungsrückgang von 4 894, bzw. 24 14216
Menschen. Im gesamten Deutschen Reich ist zwischen 1841 und 1895 ein
Defizit bei der Bevölkerungszunahme aufgrund der Auswanderung zu
verzeichnen. Wie man in Diagramm 1 sieht, gab es in diesen Jahren einen
Geburtenüberschuß und die Bevölkerung nahm theoretisch zu. Betrachtet man jedoch das tatsächliche und das natürliche Wachstum, läßt sich eine Differenz erkennen, die Aufschluß über die Auswanderung gibt.
Die Entwicklung der Bevölkerungs- und Auswanderungszahlen ist nicht die
einzige Veränderung, die bei der Untersuchung zu berücksichtigen ist.
Auch die Hauptgebiete der Auswanderung veränderten sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Wanderten 1830-34 noch 98,8 % aus Süd-West- Deutschland aus, waren es 1865-69 nur noch 13,8% der Gesamtwanderung. Auch die Zahl der Emigranten aus dem rechtsrheinischen Bayern und Westdeutschland nahm von 16,4% (1835-39) bzw. 12,5 % 1845-49 auf 3,0% bzw. 7,9% 1865-69 ab. In Nordostdeutschland, Ostdeutschland und Mecklenburg stieg die Zahl derer, die ihre Heimat verließen dagegen von 0,7%, 2,9% 1845-49 und 3,9% 1850-54 auf 5,9%, 11,3% und 4,3% 1865-69 an17. Die meisten Auswanderer kamen zwar immer noch aus dem Süden und Westen Deutschlands, ihr Anteil an der
Gesamtauswanderung verringerte sich jedoch von fast 100% auf 24,7%. Diese Verlagerung der Ausreisegebiete von West nach Ost läßt sich mit dem Gutssystem in Ostdeutschland erklären. Durch die wachsende Bevölkerung wurden die im Pachtsystem verteilten Parzellen so klein, daß die Pächter nicht mehr genug ernten konnten und deshalb auswanderten.
4.) Einzel- und Familienauswanderung:
Grob kann man drei Phasen der Auswanderungsbewegung unterscheiden. Bis etwa 1865 wanderten hauptsächlich Kleinbauern und Kleinhandwerker aus dem Süden und Westen Deutschlands im Familienverband aus. Zwischen 1865 und 1895 wanderten die unterbäuerlichen Schichten aus Norddeutschland aus und die Einzelwanderung nahm zu. In der Zeit von 1895 bis 1914 wanderte die Industriearbeiterschaft aus, die Familienauswanderung und die Siedlung in Nordamerika sind zuende.
Es findet also im Laufe der Zeit eine Verlagerung von der Familien- zur
Einzelwanderung statt. Man kann dies teilweise damit erklären, daß
Familienväter vorzogen, eine Existenzbasis gründeten und ihre Familie später nachholten. Junge Männer die keinen Militärdienst leisten wollten machten jedoch auch einen Großteil der Einzelwanderer aus.
Die Anzahl der Familienauswanderung sank in Teilen von Württemberg von
83.9% 1817/19 auf 20,5% 186018. In Diagramm 2a kann man sehen, daß die Familienauswanderung schon einmal 1825-29 unter 50% sank und 1835-39 noch einmal. Endgültig nahm sie dann ab 1854 stetig ab. Gleichzeitig ist auch ein Rückgang der Familiengröße zu beobachten. Diese sinkt von Durchschnittlich 4,8 Personen auf 3,0 im gleichen Zeitraum. Die Abnahme ist jedoch nicht kontinuierlich und ist verschieden von der anderer Regionen.19 In Diagramm 2 wird die Emigration von Familien und Einzelwanderern im Raum Alzey dargestellt. Auch hier läßt sich erkennen, daß die Auswanderung von Einzelpersonen zunimmt und von 6,5% 1842 bis auf 83,6% zwischen 1891-95 ansteigt. Tendenziell läßt sich also sagen, daß die Einzelwanderung zunahm, wenn sie auch nicht kontinuierlich im Laufe der Jahre anstieg. Der Anstieg der Emigranten, die alleine die Heimat verließen kann als Indiz dafür genommen werden, daß die Massenauswanderung allmählich ihrem Ende entgegen ging.
5.) Strukturen der Auswanderung:
Durch die Untersuchung der Strukturen, läßt sich feststellen ob und wie sich das Bild der Emigranten im Laufe des 19. Jahrhunderts verändert hat. Problematisch ist hierbei, daß in den meisten Fällen in den Behörden nicht alle Charakteristika der Auswanderer aufgenommen wurden. Man kann also nicht hundertprozentig über alle ausgewanderten Deutschen Angaben machen. Es lassen sich jedoch Tendenzen erkennen, wie die Zusammensetzung der Emigranten aussah. In den folgenden Teilabschnitten wird darauf näher eingegangen.
a) Alter
Das Alter der Emigranten wird in den behördlichen Erfassungen, zumindest in
Württemberg am schlechtesten erfaßt. In 90% der Fälle fehlt die Angabe in dieser Sparte.
Wie man an der Darstellung der Württembergischen Bevölkerung von 1861 in Diagramm 3 erkennen kann hatte diese eine Pyramidenstruktur, wie die gesamte deutsche Bevölkerung zu dieser Zeit.. Die Darstellung der Altersstruktur der Auswanderer in den Hamburger Schiffslisten in Diagramm 3a weist hingegen eine Zwiebelform auf . Die Alterstruktur der Emigranten ist also verschieden von der der deutschen Gesamtbevölkerung. Die meisten wanderten im Alter von 20-35 Jahren aus. Dies läßt sich damit erklären, daß in diesem Alter die Chancen für einen beruflichen Neuanfang am größten waren. Auch die Anzahl der 15-20 jährigen ist recht groß, was damit zu erklären wäre, daß Eltern mit jungen Kindern eher bereit waren auszuwandern, da man damals mit 14 Jahren ins Berufsleben einstieg. Insgesamt liegt der Anteil der 15-40 jährigen in Württemberg stets über 65%20. Das Durchschnittsalter der männlichen Auswanderer lag zwischen 1817 und 1860 bei 26,7 Jahren, das der weiblichen bei 27,6. In der Pfalz ändert sich die Alterstruktur im Laufe der Jahre. Waren 1835-1860 noch 32% der Auswanderer unter 16 Jahre, 13% älter als 40 und 55% zwischen 16 und 40, waren zwischen 1860 und 1870 nur noch 23% unter 17, 11% über 40 und 65% zwischen 17 und 40 Jahren21. Die sinkende Zahl der unter 17 jährigen und über 40 jährigen läßt darauf schließen, daß ab 1860 die Einzelwanderung lediger Männer zunahm und die Familienwanderung abnahm.
Bemerkenswert ist die große Anzahl von Säuglingen unter einem Jahr und die im Vergleich dazu sehr geringe Masse von einjährigen. Dieses Phänomen läßt sich mit den Schiffspreisen erklären, da man für Säuglinge nur drei Taler, für Kinder von einem bis zehn Jahren jedoch die Hälfte des
Erwachsenenfahrpreises, circa 30 Taler zahlen mußte. Höchstwahrscheinlich wurden deshalb viele einjährige als Säuglinge ausgegeben um Kosten zu sparen.
Die geringe Anzahl der Auswanderer über 40 läßt sich damit erklären, daß in diesem Alter die Bereitschaft einen Neuanfang in einem fremden Land zu starten sehr gering war. Personen, die über 60 Jahre alt waren, wanderten in
noch geringerem Maße aus. Auch hier durfte eine Ursache sein, daß man in
diesem Alter Veränderungen nicht mehr riskieren wollte und daß die Reise in ein fernes Land zu beschwerlich war. Ein weiterer Grund war die Erschwerung die Einreise von über 60 jährigen durch die Einwanderungsbehörde in New York. Der Schiffsmakler Carl J. Klingenberg warnte 1854:
“Außerdem haben die Newyorker Behörden, in Bezug auf die Zulassung von Auswandern, verschärfte Maßregeln erlassen, denen zufolge nun auch die folgenden Personen Schwierigkeiten wegen ihrer Aufnahme in Newyork gemacht werden, als Personen über 60 Jahre alt, Witwen mit Familie, Frauenzimmer ohne Ehemänner, welche Familie haben, Elternlose Kinder unter 13 Jahre [...]“22
Man kann an dieser Warnung auch sehen, daß der amerikanische Staat nur die
Emigranten einreisen lassen wollte, die in der Lage waren sich eine Zukunft
aufzubauen, und nicht sofort staatliche Unterstützung benötigten. Dies war wohl auch vielen Auswanderern bewußt, wie man aus der Altersstruktur ableiten kann.
b) Geschlecht:
In Diagramm 3 läßt sich die grobe Struktur der Auswanderer erkennen, man
sieht, daß im Durchschnitt mehr Männer als Frauen auswanderten. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war die Verteilung jedoch relativ ausgeglichen. Dies läßt sich damit erklären, daß zu diesem Zeitpunkt die Familienauswanderung einen Großteil der Wanderungsbewegung ausmachte. Als diese circa 1845, bzw. 1865 abnahm und mehr Einzelpersonen auswanderten stieg der Männeranteil erheblich an. Frauen verließen das Land meistens nicht ohne ihre Familie, so läßt sich der Männeranstieg damit erklären, daß diese eher dazu bereit waren alleine in ein neues Land zu gehen, als dies bei Frauen der Fall war. In Württemberg wanderten zwischen 1837 und 1843 mehr Frauen als Männer aus. Nach 1843 liegt der Männeranteil meist deutlich über dem der Frauen. 1843-46 kommen sogar 276 Männer auf 100 Frauen. 1855-58 und 1864-67 verließen abermals mehr weibliche Emigranten das Land23. Diese Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich erfolgte Gesamtauswanderung. Betrachtet man für die Zeiträume 1855-58 und 1864-67 nur die Ledigenauswanderung erhält man bezüglich der Geschlechterverteilung stark abweichende Zahlen.24 In dieser Gruppe überwiegt also der Männeranteil. Den Frauenüberschuß in der
Gesamtstatistik könnte man wie oben schon erwähnt damit erklären, daß der
Ehemann vorgereist war und die Frau nun nachreiste.
c) Beruf:
Bei der Ermittlung der Berufsstruktur tritt am deutlichsten die Problematik der statistischen Erfassung hervor. In der Literatur nehmen die Autoren verschiedenen Einteilung der Berufe vor, z.B. ist bei den handwerklichen Berufen die Zugehörigkeit der einzelnen Sparten nicht immer dieselbe, da manche auch zu den industriellen gezählt werden können. Somit wird es schwierig die einzelnen Angaben miteinander zu vergleichen. Berufsangaben finden sich in der behördlichen Erfassung recht oft, nur in 20% der erfaßten Fälle fehlt diese. Dieses Defizit bei der Erfasssung läßt sich damit erklären, daß junge Auswanderer noch keinen Beruf ausübten. Man kann aus den Angaben nicht erschließen, welcher Berufsstatus, ob Meister oder Lehrling, erreicht wurde und in der Regel wird nicht berücksichtigt, daß viele der Auswanderer gewerbliche und landwirtschaftliche Berufe gleichzeitig ausübten. Weiterhin wurden normalerweise nur bei Männern Berufe angegeben. Frauen werden in den Erfassungsbögen nur selten mit Beruf genannt. In den Hamburger Schiffslisten zum Beispiel ist nur bei 21 Frauen ein Beruf angegeben worden. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wanderten viele Landwirte aus, da diese von den Mißernten, Naturkatastrophen und Teuerungen am meisten betroffen waren. Gleichzeitig konnte diese Berufsgruppe durch Verkauf ihres Eigentums genug Geld für die Überfahrt aufbringen. Der Anteil der Landleute geht im Laufe der Jahre, besonders in Süd-West-Deutschland deutlich von 49.4% 1843 auf 20,3% 185725 zurück. Der Anteil der Tagelöhner steigt von 10,2% auf 22% an. Man kann dies damit erklären, daß diese Berufsgruppe erst auswandern konnte als die Wirtschaft relativ stabil war und sie so das nötige Reisegeld zusammensparen konnten. Diese Berufsgruppe war im Vergleich mit ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung der Pfalz ( 29,2% ) jedoch immer noch unterrepräsentiert.
Auch Handwerker verließen oft das Land. Besonders Textilhandwerker, die am meisten unter konjunkturellen Schwankungen zu leiden hatte, da sich in Zeiten der Armut die Bevölkerung keine neue Kleidung leisten konnte. Aber auch Bauhandwerker und solche die Geräte für den Haushalts- und
Landwirtschaftsbedarf herstellten wanderten aus. Diese Gruppe reiste jedoch
nicht aus, um wirtschaftlicher Not zu entgehen, sondern weil in Amerika
Angehörige ihres Berufstandes gesucht wurden. In der Nahrungs- und
Genußmittelbranche findet sich die geringste Anzahl der Auswanderer, da man hier Auswirkungen von Krisen am wenigsten spürte und die Angehörigen dieser Berufsgruppe meist zu den wohlhabenderen gehörten. In Württemberg machten die Berufe der Nahrungsmittelproduktion zwischen 1817 und 1860 18% des gewerblich-industriellen Sektors aus, und sind mit 11,3% an der Gesamtauswanderung in diesem Zeitraum vertreten26.
In Diagramm 5 kann man anhand des Beispiels Württemberg die allgemeine Tendenz bei der Berufsverteilung erkennen. Der Anteil der Landleute geht von 41,5% 1854 auf 29,7% 1871 zurück. Gewerbliche und industrielle Berufe bleiben trotz Schwankungen im Laufe der Jahre relativ gleichmäßig vertreten. Der Anteil von Handel, Transport und wissenschaftlichen Berufen vervierfacht sich zwar zwischen 1854 und 1871. Diese Berufsgruppen spielen jedoch mit 9,1% und 4,9 % eine untergeordnete Rolle bei der Gesamtauswanderung.
d) Vermögen:
Die Mehrzahl der deutschen Auswanderer gehörte nicht zu den Wohlhabenden. Zu diesem Schluß kommt man schon, wenn man sich die
Auswanderungsgründe ansieht. Die meisten verließen ihre Heimat aufgrund der allgemeinen und ihrer eigenen wirtschaftlichen und materiellen Not. Wer aus den ärmsten und von Katastrophen am meisten betroffenen Gebieten auswanderte hatte in der Regel auch am wenigsten Vermögen für den Neustart. Für Württemberg liegt recht ausführliches Zahlenmaterial zur Vermögensangabe vor. Man muß dieses jedoch mit Vorsicht bewerten, da:“ die Vermögenssubstanz eher über- als unterbewertet worden ist, denn sie unterlag keiner Nachsteuer...“27. Außerdem wird bei den behördlichen Verzeichnissen nicht angegeben, ob in dem genannten Vermögen auch das Reisegeld enthalten ist.
In Krisenzeiten war das Prokopfvermögen am niedrigsten28. Dies liegt jedoch
auch daran, daß in solchen Zeiten viele Familien auswanderten und durch die Einbeziehung der Kinder sich der Mittelwert verfälscht.
Allgemein läßt sich sagen, daß die Vermögensverhältnisse der ledigen
Auswanderer besser waren, als die der verheirateten. Im Durchschnitt nahmen sie zwischen 1817 -1860 397 Gulden mit und die verheirateten nur 204 Gulden. Wenn man die Spalte der männlichen ledigen Emigranten betrachtet, die nur ein Vermögen von 386 Gulden ins Ausland mitnahmen, läßt sich erkennen, daß die ausgewanderten ledigen Frauen am meisten Kapital mitnahmen. Dies bestätigt auch Tabelle 50 bei W. v. Hippel29. Dort nehmen ledige Frauen ohne Kind im gleichen Zeitraum 501 Gulden durchschnittlich mit. Fast 64% der Württemberger Auswanderer verfügten über ein Vermögen zwischen 50 und 249 Gulden30.
Im Vergleich dazu verdiente ein Maurermeister im Jahr 280, ein Maurergeselle 230 und ein Tagelöhner 210 Gulden. Maurer und Tagelöhner nehmen dann auch nur 123 bzw. 87 Gulden mit nach Amerika.31
e) Wahl des Schifftyps:
Mit der Einführung der Dampfschiffahrt 1807/181932 wird die Überfahrt nach
Amerika wesentlich schneller und ungefährlicher. Bremen führte das erste
Dampfschiff jedoch erst 1847 und Hamburg 1850 ein, und in beiden Häfen
verließen bis 1860 noch hauptsächlich Segelschiffe den Hafen.
Brauchte man mit dem Segelschiff im Schnitt 5-13 Wochen, erreichte man sein Ziel mit dem Dampfer in nur 9-13 Tagen. Die schnellere Reiseart verminderte Ansteckungsgefahren und damit auch die Todeszahlen auf der Überfahrt, da das Zwischendeck nun sauberer war und es größere und frischere Lebensmittelrationen gab.
Die Zahl der Emigranten, die mit dem Dampfschiff fuhren stieg von 30,8% 1858 auf 81,3% 187033. Die teurere Überfahrt wurde somit gern zugunsten von mehr Bequemlichkeit und geringerer Reisezeit in Kauf genommen. Die Reise von
Bremen nach New York kostete 1854 auf einem Segelschiff zwischen 30 und
40 Taler, auf einem Dampfschiff bezahlte man 40-50 Taler Gold. Die Überfahrt von Le Havre, Rotterdam und Amsterdam war noch etwas teurer. Diese Häfen wurden hauptsächlich von Auswanderern aus Süd-West-Deutschland genutzt.
6.) Zusammenfassung:
Die Deutsche Auswanderung im 19. Jahrhundert ist für den gesamten
deutschen Raum schwer zu fassen. Wenn man aber von den regionalen
Wanderungsbewegungen auf die für ganz Deutschland schließen will, kann man sagen, daß die Gründe für das Verlassen der Heimat in den meisten Fällen mit der wirtschaftlichen Situation zusammenhingen.
Durch das Bevölkerungsdefizit, daß durch die Auswanderung verursacht wurde, versuchten die einzelnen Kleinstaaten immer wieder die Auswanderung aus ihren Landkreisen durch Verbote und Strafen möglichst gering zu halten. Das ihnen dies nicht gelang, kann man an der Zahl von ca. 5 Millionen Auswanderern sehen.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Überseeauswanderung zunehmend von der Binnenwanderung abgelöst, die Familienwanderung war zuende und auch die Landnahme in Nordamerika abgeschlossen.
Die Untersuchung hat gezeigt, daß sich das Bild des Auswanderers im Laufe des 19. Jahrhunderts stark verändert vom emigrierenden Landwirt mit Familie zum ledigen männlichen Einzelauswanderer, der nicht mehr primär aus wirtschaftlicher Not seine Heimat verläßt. Verändert haben sich auch die Regionen aus denen die Auswanderer kamen. Verließen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch hauptsächlich die Menschen aus dem Süden und Westen Deutschlands das Land, wurden es in der letzten Hälfte mehr aus dem Norden und Osten des Reiches.
Man kann abschließend sagen, daß die Wanderungsbewegung sich zwar im Laufe der Jahre stark veränderte, daß sie dies jedoch nicht kontinuierlich tat. Sowohl die Strukturen des Alters, des Berufes, als auch des Geschlechts der Emigranten verändern sich. Wie man anhand der Diagrammen erkennen kann, ist diese strukturelle Veränderung Schwankungen unterworfen, die hauptsächlich von den oben erwähnten “push and pull“ Faktoren abhängig sind.
Deshalb verläuft die Veränderung der Wanderungsbewegung nicht linear.
Tendenzielle Entwicklungen lassen sich trotzdem erkennen.
7.) Literaturliste:
- Assion, Peter: Über Hamburg nach Amerika. Hessische Auswandernde in den Hamburger Schiffslisten 1855-1866. Eine Studie des Instituts für Europäische Ethnologie und Kulturforschung an der Universität Marburg. Marburg 1991.
- Faltin, Sigrid: Die Auswanderung aus der Pfalz nach Nordamerika im 19.
Jahrhundert. Unter Berücksichtigung des Landkommissariates Bergzabern. Frankfurt 1986.
- Friedrich Burgdörfer: Die Wanderung über die deutschen Reichsgrenzen im letzten Jahrhundert. In: Bevölkerungsgeschichte. Hrsg. v. Wolfgang Köllmann
u. Peter Marschalck. Köln 1972. S. 281-322.
- Heinz, Joachim: "Bleibe im Lande und nähre dich redlich !" Zur Geschichte der Pfälzischen Auswanderung vom Ende des 17. Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Kaiserslautern 1989 (Beiträge zur pfälzischen Geschichte,1).
- Hippel, Wolfgang von: Auswanderung aus Südwestdeutschland. Studien zur Württembergischen Auswanderung und Auswanderungspolitik im 18. Und 19. Jahrhundert. Stuttgart 1984 (Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne
Sozialgeschichte, 36).
- Marschalck, Peter: Deutsche Überseeauswanderung im 19. Jahrhundert. Stuttgart 1973.
- Marschalck, Peter: Bevölkerungsgeschichte Deutschlands im 19. Und 20. Jahrhundert. Frankfurt 1984.
- Mergen, Josef: Die Auswanderung aus den ehemals preußischen Teilen des Saarlandes im 19. Jahrhundert. 2 Bde. Saarbrücken 1973 (Veröffentlichungen des Instituts für Landeskunde des Saarlandes, 20).
- Paul, Roland: Auswanderung und Emigration aus der Pfalz vom 19. Bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Ders. (Hg.), Pfälzer in Amerika, S. 62-80.
- Schmahl, Helmut: Verpflanzt aber nicht entwurzelt. Die Auswanderung aus Hessen-Darmstadt ( Provinz Rheinhessen ) nach Wisconsin im 19. Jahrhundert. Frankfurt 2000.
8.) Anhang:
- Diagramm 1: Deutsche Bevölkerungszunahme. Vgl. Friedrich Burgdörfer, S. 282.
- Diagramm 2: Familien- und Einzelwanderung im Raum Alzey.
Vgl. Helmut Schmahl, Tabelle A24 S. 402 und Tabelle A25 S. 403.
- Diagramm 2a: Familienwanderung und -größe.
Vgl. Wolfgang von Hippel, Tabelle 35 S. 218.
- Diagramm 3: Württembergische Wohnbevölkerung 1861. Wolfgang von Hippel, Abbildung 36 S. 221.
- Diagramm 3a: Altersstruktur in den Hamburger Schiffslisten. Peter Assion, S. 69.
- Diagramm 4: Deutsche überseeische Auswanderung. Vgl. Friedrich Burgdörfer, S. 290.
- Diagramm 5: Berufsentwicklung der württembergischen Auswanderer Vgl. Wolfgang von Hippel, Tabelle 39 S. 227.
[...]
1 Wolfgang von Hippel hat in einer Tabelle die Auswanderungsfördernden und -hemmenden Faktoren aufgelistet. S. 124.
2 In der Pfalz gab es auch schon 1815 eine schlechte Getreideernte.
3 W. v. Hippel, S. 215.
4 R. Paul, S. 69.
5 J. Heinz, S. 195.
6 Grund dafür war, daß der Schweizer Bundesrat seine Asylgesetzgebung verschärfte und politische Flüchtlinge mit der Versprechung einer Teilamnestie wieder zurückschickte. J. Heinz, S. 199.
7 W. v. Hippel, S. 125.
8 W. v. Hippel, S. 215.
9 J. Heinz, S. 201.
10 J. Mergen, S. 68.
11 W. v. Hippel, S. 127.
12 S. Faltin, S. 152.
13 J. Heinz, S. 17.
14 F. Burgdörfer, S. 308.
15 S. Faltin, S.146.
16 R. Paul, S. 72.
17 P. Marschalck, Deutsche Überseeauswanderung, S. 38.
18 W. v. Hippel, S. 218.
19 Im Kreis Bergzabern sinkt die Familienauswanderung von 65,4% 1816-25 auf 11,8% 1886-95. In Rheinhessen von 92,79% 1842 auf 63,78% 1847.
20 W. v. Hippel, S. 220.
21 Vgl. J. Heinz, Tabelle A 19, S. 361.
22 P. Assion, S. 70.
23 W. v. Hippel, S. 139.
24
1855-58: 166,93 Männer auf 100 Frauen / 1864-67: 163,73 Männer auf 100 Frauen.
W. v. Hippel, S. 217.
25 S. Faltin, S. 159.
26 W. v. Hippel, S. 233.
27 W. v. Hippel, S. 237.
28 W. v. Hippel, S. 242.
29 W. v. Hippel, S. 242.
30 W. v. Hippel, S.243.
31 W. v. Hippel, S. 248/49.
32 1807: erstes Dampfschiff auf dem Hudson River 1819: Dampfsegelschiff überquert den Atlantik
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über die Auswanderung im 19. Jahrhundert?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Strukturen der Auswanderung im 19. Jahrhundert. Sie untersucht die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Faktoren, die die Auswanderung motivierten, und analysiert verschiedene Auswanderungswellen. Außerdem vergleicht sie allgemeine Tendenzen der Bevölkerungs- und Auswanderungsentwicklung und untersucht Formen der Auswanderung, wie Familien- und Einzelauswanderung, sowie Charakteristika der Auswanderer, wie Alter, Geschlecht, Beruf und Vermögen.
Welche "Push- und Pull-Faktoren" werden bei der Auswanderung untersucht?
Die Arbeit untersucht "Push-Faktoren", die Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, wie z.B. wirtschaftliche Notlagen (Missernten, Teuerungen) und politische oder religiöse Verfolgung. Außerdem werden "Pull-Faktoren" betrachtet, die das Zielland attraktiv machten, wie z.B. günstige Ansiedlungsbedingungen und wirtschaftliche Stabilität.
Welche wirtschaftlichen Faktoren trugen zur Auswanderung bei?
Wirtschaftliche Faktoren umfassten Missernten, Kälteeinbrüche, Unwetter, Teuerung der Lebensmittel, Bevölkerungswachstum, Besitzsplitterung und die Liberalisierung der gewerblichen Arbeitsverfassung, die Mechanisierung und den Ausbau des Fabrikwesens.
Spielt politische oder religiöse Verfolgung eine wichtige Rolle bei der Auswanderung?
Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass politische oder religiöse Verfolgung nicht der Hauptgrund für die Auswanderung war, obwohl es Fälle von Menschen gab, die aufgrund politischer Unruhen oder zur Vermeidung des Militärdienstes auswanderten. Religiöse Gründe spielten nur in bestimmten Regionen, wie Württemberg, eine gewisse Rolle.
Wie veränderte sich die Auswanderung im Laufe des 19. Jahrhunderts?
Im Laufe der Zeit verlagerte sich die Auswanderung von der Familien- zur Einzelauswanderung. Auch die Hauptgebiete der Auswanderung veränderten sich, wobei zunächst Südwestdeutschland und später Nordostdeutschland und Ostdeutschland an Bedeutung gewannen.
Wie unterschied sich die Altersstruktur der Auswanderer von der der Gesamtbevölkerung?
Die Altersstruktur der Auswanderer unterschied sich deutlich von der der deutschen Gesamtbevölkerung. Der größte Teil der Auswanderer war zwischen 20 und 35 Jahren alt, was darauf hindeutet, dass in diesem Alter die Chancen für einen beruflichen Neuanfang am größten waren. Die Alterstruktur der Emigranten weist eine Zwiebelform auf, während die der Gesamtbevölkerung eine Pyramidenstruktur hatte.
Wie war das Geschlechterverhältnis bei den Auswanderern?
Anfangs war das Geschlechterverhältnis bei den Auswanderern relativ ausgeglichen, da die Familienauswanderung einen großen Teil der Wanderungsbewegung ausmachte. Später, als mehr Einzelpersonen auswanderten, stieg der Männeranteil erheblich an.
Welche Berufe waren bei den Auswanderern vertreten?
Anfangs wanderten viele Landwirte aus, da diese am stärksten von Missernten und Teuerungen betroffen waren. Im Laufe der Zeit nahm der Anteil der Landleute ab und der Anteil der Tagelöhner zu. Auch Handwerker verließen oft das Land, insbesondere Textilhandwerker.
Wie viel Vermögen nahmen die Auswanderer mit?
Die Mehrzahl der deutschen Auswanderer gehörte nicht zu den Wohlhabenden. Die Vermögensverhältnisse der ledigen Auswanderer waren im Allgemeinen besser als die der verheirateten.
Wie veränderte die Dampfschifffahrt die Auswanderung?
Die Einführung der Dampfschifffahrt machte die Überfahrt nach Amerika wesentlich schneller und ungefährlicher. Die Zahl der Emigranten, die mit dem Dampfschiff fuhren, stieg im Laufe der Zeit.
Welche Probleme gibt es bei der statistischen Erfassung der Auswanderer?
Es gab bis weit ins 19. Jahrhundert kaum amtliche Statistiken, Akten wurden nicht immer ausführlich geführt und viele Ämter waren bemüht, die Auswandererzahlen möglichst niedrig erscheinen zu lassen. Es wurde auch meist keine Unterscheidung zwischen Übersee- und Binnenwanderung gemacht.
- Arbeit zitieren
- Christina Schleifenbaum (Autor:in), 2000, Struktur der Auswanderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98312