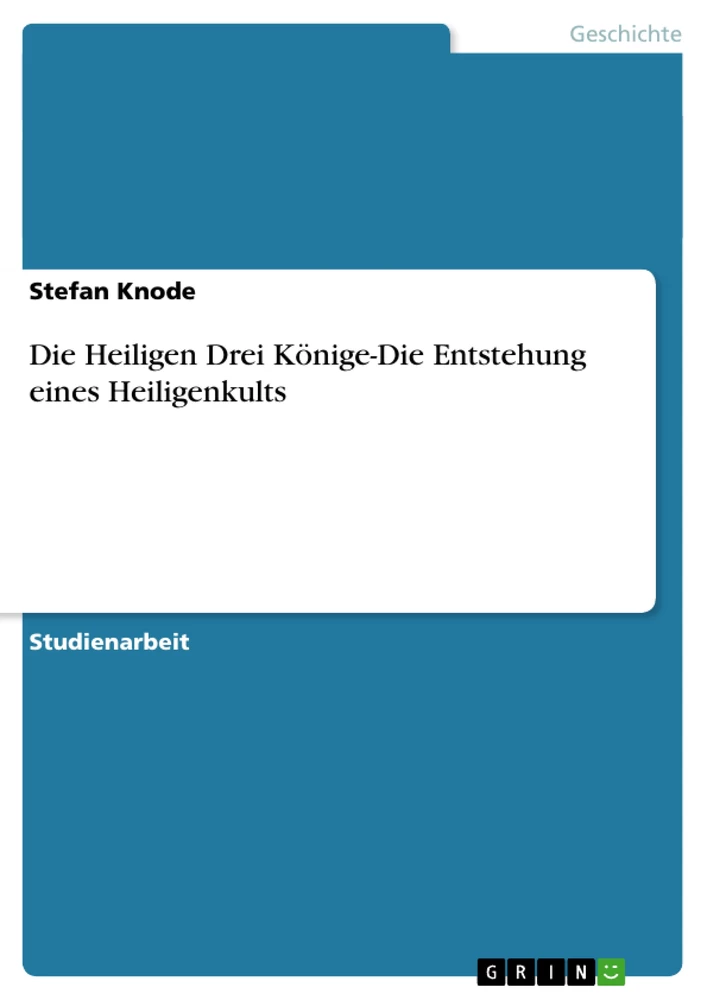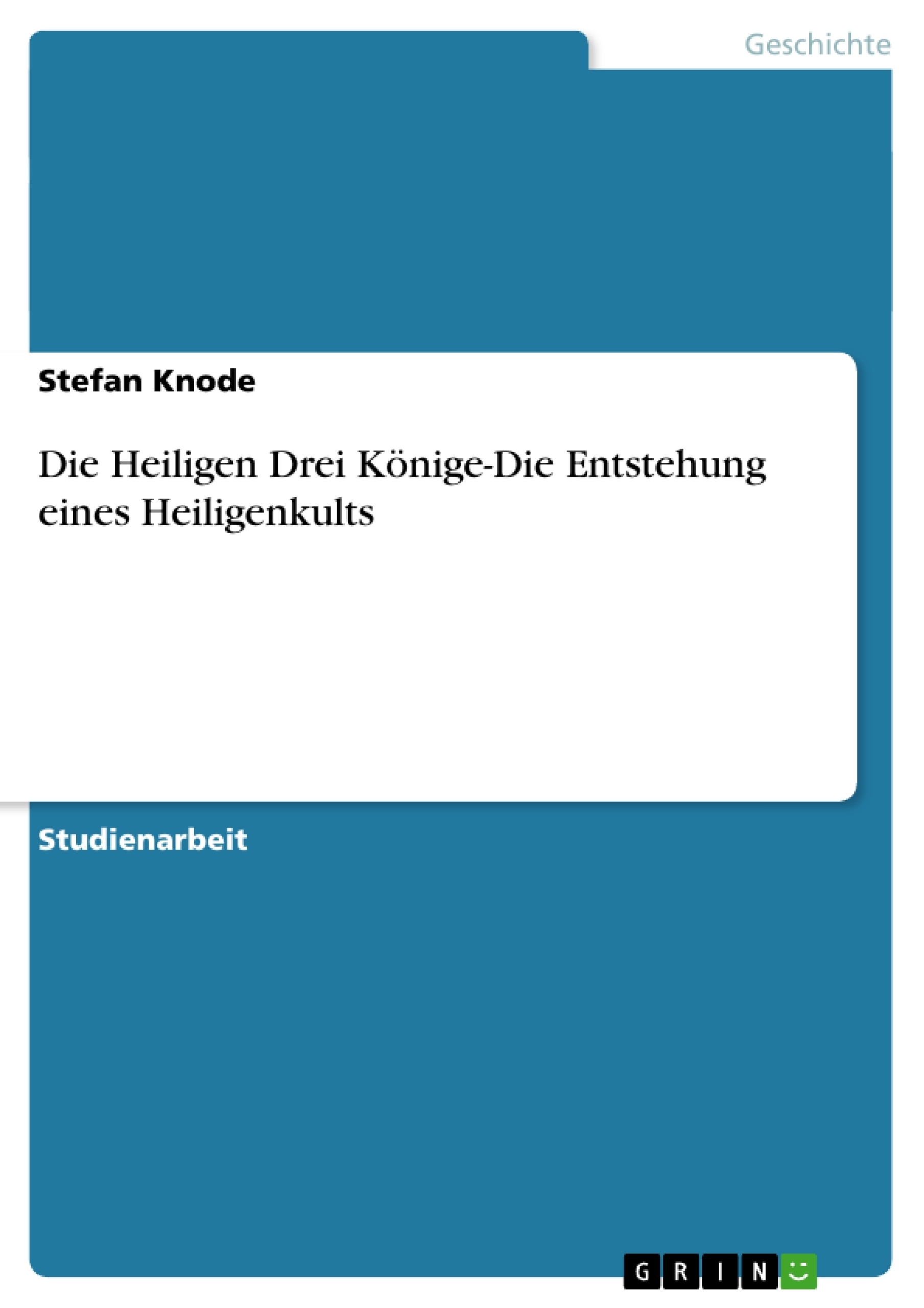1. Einleitung
,,Complex, fantastic, full of marvel, treasure, orientalism, glitter, colour, perfume, impossibility, symbolically full of meaning ..."1. So lauten einige der Attribute, die der Geschichte der Heiligen Drei Könige anhaften. Jedoch können diese Merkmale allein wohl nicht ausgereicht haben, um der Reliquie der Könige, die Christus in Betlehem angebetet und beschenkt haben, im Mittelalter eine zentrale Stellung in der abendländischen Heiligenverehrung zukommen zu lassen.
Daß sich vor allem die Kölner mit den Reliquie identifizieren konnten und immer noch können, läßt sich gut an ihrem heutigen zweiteiligen Stadtwappen erkennen. Die obere Hälfte wird von drei Kronen geziert, die die Gebeine der Heiligen Drei Könige symbolisieren sollen2. Schließlich befinden sich die sterblichen Überreste der Magier seit über 800 Jahren im Besitz der Kölner.
Doch nur der Besitz der Reliquie kann nicht ausgereicht haben, um eine Darstellung auf dem Stadtwappen zu erklären. Die Reliquie bescherte der Stadt seit dem Mittelalter einen nicht enden wollenden Pilgerstrom3. Entsprechend viel Geld floß in die Kassen der Bürger, der Stadt und auch des Klerus. Mehr noch, die Gebeine zeichnen auch noch direkt für das heutige Wahrzeichen der Stadt verantwortlich: durch eben diese Spenden der Pilger wurde der Bau des gotischen Doms finanziert, der schon von weitem sichtbar das Rheinufer ziert, und in welchem die Hll. Drei Könige seit dem Mittelalter ruhen.
Diese Arbeit soll die Geschichte der Reliqiue der Heiligen Drei Könige wiedergeben. Nach einer kurzen Einleitung, die den Weg der Gebeine von ihrer Fundstelle über Konstantinopel bis nach Mailand beinhaltet, möchte die Arbeit ihren Schwerpunkt auf die Barbarossazeit (1152-1190) legen, also der Zeit, in welcher die Reliqiue nach Köln gebracht wurde. Unter welchen Umständen kam sie nach Köln, welche Personen sind an dieser Translation beteiligt und welchen Nutzen konnte eine solche Überführung der Reliquie für diese Personen haben. Von besonderem Interesse ist die Frage nach dem Nuzten der Reliquie für den Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Welche Besonderheiten und Unstimmigkeiten kommen in der Geschichte der Hll. Drei Könige zu Tage?
Leider kann die Arbeit nicht all die ikonographischen Aspekte der Dreikönigsver-ehrung, die sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben, berücksichtigen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Auch die durchweg positiven Folgen, die diese Translation für die Stadt Köln hatte, können hier nicht näher behandelt werden, sind aber auch bei oberflächlicher Betrachtung erkennbar und leicht nachvollziehbar. Eine Erörterung der vieldiskutierten Echtheit der Reliquie bedürfte zu vieler Punkte, die zu berücksichtigen wären4, so daß sie an dieser Stelle nicht erbracht werden kann. Allerdings soll die Arbeit dem Leser ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu dieser Frage zu bilden.
2. Die Vorgeschichte
2.1. Die biblischen Magier
Wir erfahren aus dem Matthäus-Evangelium5, daß sich kurz nach der Geburt Christi Magier aus dem Morgenland auf den Weg nach Betlehem begeben, um das neugeborene Kind zu suchen. Von einem Stern geleitet, der ihnen den Weg weist, erreichen sie den Stall, in welchem Jesus in der Krippe liegt. Nachdem sie dort dem Christuskind huldigen und ihm Gaben (Gold, Weihrauch und Myrrhe) bringen, kehren sie über einen Umweg (ein Engel empfahl ihnen in einem Traum, dies zu tun, um die Pläne des Königs Herodes zu durchkreuzen) in ihre Heimat zurück.
Diese Fakten vorausgesetzt, fehlen uns einige Angaben, die unser heutiges Bild der Heiligen Drei Könige bestimmen. Zunächst einmal sagt Matthäus nichts über die Anzahl der Magier6. Ebenso wenig erfahren wir, woher genau die Magier stammen. Die Namen der Magier7 bleiben ebenso so unerwähnt wie die Tatsache, daß einer von ihnen schwarz war8. Viel wichtiger als all diese Punkte ist allerdings der, daß der Evangelist mit keinem Wort den Magiern den Rang von Königen zuteilt. Es handelt sich nach seiner Darstellung um Sterndeuter und Magier, nicht aber um Könige9.
2.2. Die erste Translation
Im 3. Jh. n. Chr.10 bricht Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, nach Persien und Palästina auf, um neben dem wahren Kreuz Christi auch die Gebeine der Magier zu suchen. Sie wird als eine tugendhafte und fromme Frau beschrieben11, die sich sehr für die christliche Sache eingesetzt hat. Die Kaisermutter findet die Gebeine der drei Magier12 und bringt sie nach Konstantinopel. Der genaue Ort und weitere Umstände der Wiederbestattung wird nicht beschrieben. Ob nach der Überführung der Gebeine eine Dreikönigsverehrung in Konstantinopel entwickelte, ist nicht bekannt.
2.3. Die zweite Translation
Die Vita Beati Eustorgii Confessoris berichtet uns von einem Ratgeber des Kaisers von Konstantinopel, der im 4. Jh. (vor der Amtszeit des Ambrosius, Kirchenvaters von Mailand, der zwischen 374 und 397 Bischof war) nach Mailand reist. Dieser Mann, Eustorgius, der aus einem griechischen Adelsgeschlecht stammte, wohlgesittet und hochgebildet war13, wird nach seiner Ankunft in Mailand eben wegen dieser Eigenschaften vom Volke einmütig zum Bischof gewählt.
Eustorgius war ob dieser Wahl so überrascht, daß er seine Zustimmung von der Billigung seines Kaisers abhängig machte. Dieser war hoch erfreut über die Wahl der Mailänder und erließ ihnen sämtliche Abgaben. Auf Bitten des Eustorgius sandte er außerdem noch die Gebeine der Hll. Drei Könige nach Mailand. Dort wurden sie in einer Kirche aufgebahrt, in welcher auch Eustorgius nach seinem Tod bestattet wurde und die seitdem seinen Namen trägt14.
Vergleicht man diese Vita allerdings mit historisch belegbaren Personen, so fallen schnell einige Unschlüssigkeiten auf. Zwar erwähnt Ambrosius in seinen Schriften, einen Eustorgius, den er auch mit Beinamen Confessor tituliert15, allerdings nennt er in keiner Stelle die Gebeine der Hll. Drei Könige16.
In der Mailänder Bischofsliste wird noch ein zweiter Eustorgius genannt, der allerdings entgegen der Vita zwischen 512 und 518 regierte, also weit nach der Amtszeit des Ambrosius. ,,Auch sonst steht das wenige, das wir von Eustorgius II. wissen, weder in Zusammenhang mit den Hll. Drei Königen, noch mit St. Eustorgio, ja er ist dort auch nicht begraben worden, sondern er ruht in St. Sisto, einer Kirche innerhalb Mailands. Daß er unter der Herrschaft Theoderichs des Großen eine Translation im Sinne der Vita durchführte, ist wohl sehr zweifelhaft."17
Da uns keinerlei Quellen aus Mailand berichten, daß sich eine Verehrung der Hll. Drei Könige entwickelte, oder in irgendeiner anderen Form die Reliquie erwähnen, liegt natürlich die Vermutung nahe, daß sich die Hll. Drei Könige weder im 4. noch im 6. Jh. in Mailand befunden haben.
Neuere Forschungen lassen uns wissen, daß die Vita des Eustorgius kurz nach der dritten Translation der Reliquie (1164) vermutlich in Köln entstanden ist. Von den vielen verschiedenen Versionen18 gehen alle auf ein Original zurück, das keinesfalls in Mailand und noch unwahrscheinlicher im 4. Jh. entstanden ist19.
3. Die Heiligen Drei Könige in der Barbarossazeit
3.1. Die Wiederauffindung
Es bestehen also berechtigte Zweifel an der Präsenz der Hll. Drei Könige ab dem 4. Jh. n. Chr. in Mailand, da sie in keiner Quelle Erwähnung finden. Es wird weder von ihrer Aufbewahrung in einer Mailänder Kirche, noch von einer Dreikönigsver- ehrung gesprochen, was höchst seltsam ist, wenn man den heutigen Rang der Reliquie in Betracht zieht. Nicht anders steht es um die Quellenlage bei der Wiederauffindung der Gebeine im Jahre 1158. Allerdings verlassen wir ab diesem Jahr den mit Spekulationen gepflasterten Weg der Legenden, und betreten einigermaßen sicheren Boden. Es muß Augenzeugen geben, die uns diese Wiederauffindung beschreiben. Doch leider verschweigen uns alle Mailänder Quellen dieses Ereignis. Nicht eine Zeile der sonst so zuverlässigen und beredten Annalen weiß von der Wiederauffindung der Gebeine der Hll. Drei Könige zu berichten. Nur Robert von Torigni (ca. 1110-1186), der Abt im Kloster auf dem Mont Saint Michel, läßt uns in seiner Chronik wissen:
,,Eodem anno inventa sunt corpora Trium Magorum, qui salvatorem nostrum infantem adoraverunt in Betleem, in quadam veteri capella iuxta urbem Mediolanum ..."20. Daß es sich bei der ,,capella" um St. Eustorguis handelt, ist leicht hinzu zu fügen21. Von einem Augenzeugen erfährt Robert22, daß bei der Öffnung des Sarkophags, in welchem die Hll. Drei Könige ruhten, drei Körper aufgefunden wurden, die äußerlich unbeschädigt waren23. Man schloß von den Gesichtern und den Händen, daß es sich um die Körper eines fünfzehn, eines dreißig und eines sechzig Jahre alten Mannes handele.
Wie uns der Abt ferner berichtet, steht zu dieser Zeit Kaiser Friedrich I. Barbarossa vor den Toren Mailands. ,, ... pro timore Frederici imperatoris Alemannorum, qui eandem urbem obsidere veniebat ..." , werden die Gebeine der Hll. Drei Könige gehoben und in eine Kirche (St. Giorgio) im Inneren der Stadt gebracht24.
Friedrich befand sich auf Feldzug, um seinen Machtanspruch in Italien geltend zu machen. Allerdings gab es vor allem in Lombardien erhebliche Widerstände gegen den Kaiser. Dieser Widerstand hatte sein Zentrum in Mailand. Die Differenzen wurden allerdings rasch bei Seite geschafft. Aus ihnen entstanden die Rechtsprechungen von Roncaglia, mit welchen der Kaiser seine Ansprüche auf verschiedenste Regalien geltend machte. Es handelte sich hierbei um Zölle und das Münzrecht.
3.2. Die Übergabe der Reliquie an Rainald von Dassel
Der Frieden, der seit den Beschlüssen von Roncaglia herrschte, hielt nicht lange vor. Schon im Jahre 1159 brechen die Widerstände gegen Kaiser Friedrich Barbarossa von neuem los. Im Jahre 1161 belagert Friedrich die Stadt ein weiteres Mal. Es dauert fast ein Jahr, bis sich die Mailänder schließlich am 1. März 1162 dem Kaiser auf Gnade oder Ungnade ergeben. Wenige Wochen (am 26. März) nach der Kapitulation Mailands marschiert Friedrich Barbarossa mit seinen Truppen in die Stadt ein. Es wird von Plünderungen und großer Zerstörung berichtet und einige Quellen behaupten sogar, daß die gesamte Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde25. Ob sich der Kaiser oder einer seiner Gefolgsleute schon bei dieser Gelegenheit der Gebeine der Hll. Drei Könige bemächtigt, ist nicht gewiß.
Sicher wissen wir allerdings, daß der Reichskanzler Barbarossas und Erzbischof von Köln, Rainald von Dassel, zwei Jahre später, am 9. Juni 1164, vom Kaiser ,, ... pro imensis et innumerabilis servitiis ..."26 mit reichen Ländereien (,, ... locum de Raga et villas ac castella in circuitu eiusdem ...") belohnt wurde. Als Krönung soll er zudem noch die Gebeine der Hll. Drei Könige erhalten haben. Leider verschweigt uns die Urkunde diese Tatsache. Sie beschreibt weitläufig, daß Rainald ein treuer Bediensteter sei, doch mit keinem Wort werden die Gebeine der Hll. Drei Könige genannt.
In der Forschung hat man sich lange Zeit gestritten, ob Rainald die Reliquie auf den Weg nach Köln schickte, bevor er den Kaiser um Erlaubnis fragte, oder ob er sie mit Wissen und Billigung Barbarossas in sein Erzbistum schickte27.
Bedenkt man aber die Reichhaltigkeit, mit welcher Rainald für seine treuen Dienste bedacht worden ist, fällt es schwer zu glauben, daß er seinen Kaiser derart hätte hintergehen können28. Auffällig bleibt aber trotzdem, daß die Gebeine in der kaiserlichen Schenkungsurkunde unerwähnt bleiben, wir aber aller Orten hören und annehmen, daß Rainald die Reliquie vom Kaiser hat geschenkt bekommen.
3.3. Die dritte Translation
Wie uns die Quellen berichten, macht sich Rainald am folgenden Tag, dem 10. Juni 1164, auf den Weg nach Köln. Haben wir von allen vorherigen Ereignissen nur Beschreibungen aus Viten und Legenden, die spärlich anzutreffen sind und von ihrem historischen Gehalt eher als zweifelhaft einzuschätzen sind, so sehen wir uns bei diesem Ereignis mit einer Flut von Meldungen konfrontiert. Der Aufbruch Rainalds scheint belanglos, allerdings ist das Gut, das der Erzbischof mit sich nach Köln nimmt, von unermeßlichem Wert. ,,Corpora trium magorum translata sunt Coloniam.29 " Es handelt sich um die Gebeine der Hll. Drei Könige. Die Nachricht dieser Begebenheit dringt bis in die entferntesten Gebiete Europas. Chroniken aus England30, Polen, ja sogar in Island31 berichten von dieser unglaublichen Begebenheit.
Doch damit nicht genug. Wir erfahren ferner, daß er noch weitere Reliquien mit nach Köln nimmt. Es sind die der Hll. Märtyrer Narbor und Felix, die sich in Mailand großer Verehrung erfreuten32. Die Mailänder Chroniken vermerken dieses Ereignis zwar, bedauern oder beklagen aber den Verlust der Reliquie nicht33.
Nachdem die Gebeine der Hll. Drei Könige bis zu ihrer Übergabe an Rainald von Dassel so gut wie nicht in Erscheinung getreten sind (von Darstellungen und Legenden abgesehen), rücken sie nun mit einem Schlag ins Interesse der gesamten europäischen Christenheit. Zu diesem Umstand hat Rainald durch seinen Brief, den er zwei Tage später aus Vercelli abschickt, prägend beigetragen.
Aber es gibt auch Zweifler. Eine Quelle meldet, daß Rainald neben den Märtyrern ,, .. tria alia corpora (...) que dicebantur esse Magorum Trium..."34 überführt. Der anonyme Mailänder Autor dieser Anmerkung stellt also die Echtheit der Reliquie in Frage.
3.4. Ein Brief aus Vercelli
Zwei Tage nach seinem Aufbruch, am 12. Juni 116435, erreicht Rainald von Dassel die ungefähr 60 km. von Mailand entfernte Stadt Vercelli. Von hier aus schickt er einen Boten mit einem Brief an ,,den Domprobst Hermann, den Domdechanten Philipp, die Prioren, den Klerus, die Lehnsleute, Ministerialen des Erzstifts und die Bürger von Köln"36. Er schreibt, daß er vom Kaiser beurlaubt worden sei, und daß er sich auf dem Heimweg nach Köln befinde, den er über Turin und den Mont Cenis noch am selben Tag antreten werde. Ferner würde er über Burgund und Frankreich reisen, da er das Gebiet seiner Feinde zu meiden gedenke.
Der Erzbischof muß schon zu jener Zeit gewußt haben, daß ihn Truppen des Papstes Alexander III. abzufangen versuchten. Daher ist es auch im Hinblick auf die Reiseroute gut möglich, daß er seinen Heimweg nur als Täuschung angegeben hat, um seine Feinde in die Irre zu locken37.
Er bestätigt weiterhin, daß er vom Kaiser reich beschenkt worden sei, nämlich mit den Leibern ,,... trium Magorum ac Regum ..." und denen der Märtyrer Narbor und Felix. Man möge für einen würdigen Empfang der Reliquien sorge tragen und für seine glückliche Heimkehr beten.
3.5. Die Bedeutung der Reliquie für den Kaiser
Spätestens hier wird die Bedeutung der Hll. Drei Könige auch für den Kaiser Friedrich Barbarossa ersichtlich. Um dies deutlicher zu machen bedarf es einiger kurzer Erläuterungen. Im Jahre 1159 kam es zum Bruch zwischen Kaiser Barbarossa und dem damaligen Papst Alexander III. Friedrich wollte gesichert wissen, daß auch sein Kaisertum eine von Gott gegebene Gnade, quasi ein göttliches Lehen ist. Er plazierte sich damit in der hierarchischen Rangfolge nicht mehr nach dem Papst, sondern direkt neben ihn. Es war allerdings üblich, daß nur der Papst als erster Vertreter Gottes auf Erden, seine Würde direkt von Gott erhielt. Da aber auch Friedrich seine Kaiserwürde unmittelbar von Gott gegeben sah (wie eine Unzahl von Urkunden dokumentieren: ,,...Deo gratia imperator..."), benötigte er nach dem Schisma mit Alexander III. Mittel, die diesen Anspruch stützen konnten.
Eben dies konnten die Hll. Drei Könige. Kraft ihrer Wirkungsmacht38 sind sie nicht in die Hände des Papstes, sondern in die des Reichskanzlers Rainald gelangt, der sie dann nach Köln überführt hat. Ab hier handelt es sich also um sogenannte ,,Reichsreliquien", die durch ihr biblisch verbürgtes Königtum39 (oder besser das Königtum, daß sie durch über tausend Jahre der Präsenz in Literatur und Kunst angenommen haben) den Anspruch Friedrichs auf Gottunmittelbarkeit seiner Kaiserwürde stützen konnten40. Selbst Rainald ist vom Königsrang der Reliquie überzeugt. Er tituliert die Gebeine als die der Drei Magier und Könige (,,...corpora insignia beatissimorum trium Magorum ac Regum..."41 ).
Doch um zu verstehen, was die Reliquie dem Kaiser nutzen konnte, bedarf es noch einer weiteren Anmerkung. Am 29. Dezember 1165, also anderthalb Jahre nach der Translation der Hll. Drei Könige, wird Kaiser Karl der Große im Aachener Münster heilig gesprochen. Es handelt sich bei diese Kanonisation um eine durch den kaiserlichen (Gegen-)Papst Paschalis III. delegierte Heiligsprechung, die keineswegs von geringerer Qualität ist, als wenn sie vom regulären Papst direkt vorgenommen worden wäre.
Dieser Heiligsprechung lag die persönliche Initiative Friedrich I. zugrunde. In verschiedensten Schriften erfahren wir, daß ,, ... es seit Anfang seiner Regierung sein Bestreben gewesen sei (Karl als formam vivendi atque subditos regendi nachzuahmen) und nach dessen (Karls des Großen) Vorbild er das Recht der Kirchen, die Unversehrtheit des Staates und die Integrität der Gesetze für sein gesamtes Reich wahren wolle, wenn weiterhin Karl als derjenige gerühmt wird, der durch die Verherrlichung des christlichen Glaubens und des Gesetzes, nach dem jeder leben solle, das römische Reich ziere ..."42.
Hier spielt die Vorstellung, daß ein auch zur Barbarossazeit schon legendärer Kaiser in den Kanon der Heiligenverehrung auf genommen wird, eine entscheidende Rolle. Es handelt sich um einen weltlichen Herrscher, der durch sein vorbildliches Verhalten göttliches Heil erlangt hat.
Beide Male sollte klargestellt sein, daß die Würde des weltlichen Herrschers (bei Karl leichter vorstellbar als bei den Hll. Drei Königen) gottunmittelbar war. Die Reliquien konnten Friedrich, der sich in eine Reihe mit den römischen Kaisern stellt und selbst zugibt, in Karl dem Großen sein Herrschervorbild gefunden zu haben, in seinem Anspruch stärken und stützen. Auch seine Herrschaft ist unnmittelbar von Gott gegeben.
3.6. Die Ankunft in Köln
Trotz der Bedrohung durch päpstliche Truppen trifft Rainald am 23 Juli 1164 mit den Gebeinen der Hll. Drei Könige in Köln ein. Er wird wie er sich dies schon in seinem Brief aus Vercelli gewünscht hat, mit großem Jubel vom Volk empfangen43. Welchen Weg Rainald genau genommen hat, um nach Köln zu gelangen, ist historisch nicht mehr nachvollziehbar. Die letzte nachweisbare Station auf seinem Weg ist Vienne, wo er gegen Ende Juli eingetroffen sein muß, ,, ... wo er auf einer Versammlung der burgundischen Großen vor allem Truppen für Italien und die Anerkennung Paschalis III. als Papst forderte."44
Ab hier wird der Weg Rainalds zur Spekulation. Sehr wahrscheinlich ist allerdings, daß Rainald doch wie im Brief angekündigt über Burgund und schließlich rheinabwärts gereist ist. Trotz des immensen Echos, das die Translation in europäischen Chroniken auslöste, sind fast alle Quellen kurz angebunden, was die Reiseroute und die Modalitäten45 der Translation angeht. Hier können uns nur Legenden46 weiterhelfen, die allerdings nicht oder nur vage historisch nachweisbar sind.
Die Gebeine wurden nach ihrer Ankunft in Köln in einer feierlichen Prozession in die Bischofskirche gebracht und dort auch beigesetzt. Seit jenen Tagen wird der 23. Juni in Kölner Gemeinden als Translationsfest gefeiert.
4. Kurze Zusammenfassung der nachfolgenden Ereignisse
4.1 Der Bau des Dreikönigsschreins
Am 14. August 1167 stirbt Rainald von Dassel in Italien47. Nachfolger im Bischofs- amt zu Köln wird Philipp von Heinsberg. Dieser sammelt in der Folgezeit Edelsteine und Gold. Er übergibt diese schließlich im Jahre 1181 an den Goldschmied Nikolaus von Verdun, der sich noch im gleichen Jahr an die Arbeit zum Dreikönigsschrein macht. Von der Meisterschaft des Nikolaus von Verdun können wir uns heute noch überzeugen, denn der Schrein, den er 1190 an den Kölner Erzbischof übergibt, hat auch nach über achthundert Jahren nichts von seinem beeindruckenden Erscheinungsbild verloren48. Im Jahre 1191 bettet Philipp die Gebeine der Hll. Drei Könige in den Schrein, in welchem sie seit dem ruhen. Offiziell fertiggestellt wurde der Schrein allerdings erst in den zwanziger Jahren des 13. Jh49.
4.2. Der Kölner Dom und die späte Reue der Mailänder
Nachdem sich die Kunde rasch verbreitet hat, daß sich die Gebeine der Hll. Drei Könige in Köln befinden, zieht die Stadt im Laufe der Jahre Reisende und Pilger an, die sich von den Reliquie Schutz und Fürsprache bei Gott erhoffen. Schon zu Beginn des 13. Jh. hat man gemerkt, daß die alte Bischofskirche dem Anspruch der Hll. Drei Könige und dem Ansturm der Pilger nicht mehr gewachsen war.
Bereits Bischof Engelbert II. hatte Pläne, die alte Kirche abzureißen, und sie gegen eine neue, prachtvollere und vor allem größe Kirche zu ersetzen. Er selbst sollte allerdings nicht mehr dazu kommen, da er 1225 ermordet wurde.
Der Grundstein für eine neue Kirche wurde schließlich am 15. August 1248 gelegt, der als letzte und endgültige Ruhestätte50 der Hll. Drei Könige sein sollte. Die Besonderheit an dieser Kirche war die, daß nicht der Altar im Mittelpunkt der Kirche und des Interesses der Pilger stand, sondern der Schrein der Hll. Drei Könige. Der Dom wurde allerdings erst im Jahre 1880 unter preußischer Herr-schaft fertiggestellt.
Haben sich die Mailänder bei der Translation 1164 nicht über den Verlust der Reliquie beklagt (und dies taten sie auch bis zum Jahre 128851 nicht), so haben sie sich seit Anfang des 14. Jh. stark um Rückgabe der Dreikönigsreliquie bemüht. Erst zu Beginn des 20. Jh. sollten kleinere Gebeine aus dem Dreikönigsschrein an Mailand zurück gehen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß sich Köln zum Zentrum der Dreikönigsverehrung entwickelte und dies auch bis heute noch ist.
5. Schlußwort
Es muß also eingestanden werden, daß vieles im Bezug auf die Geschichte der Hll. Drei Könige heute nicht mehr genau nachforschbar ist. Wir sehen uns mit einer Flut von Legenden konfrontiert, die im Laufe der Jahre und Jahrhunderte immer weiter ausgeschmückt, ergänzt und somit verfälscht wurden. Auch die Vielzahl von Meldungen in den Chroniken können uns aufgrund ihrer Kürze und Wortkargheit kein akkurates Bild der Geschichte der Reliquie geben.
Auch unser heutiges Bild, die Vorstellung, die wir von den Hll. Drei Königen haben, ist zum großen Teil durch mittelalterliche Einflüsse geprägt. Und trotzdem kann nichts darüber hinwegtäuschen, daß sich die Magier nicht nur in Köln, sondern beinahe überall bis zum heutigen Tage einer großen Verehrung erfreuen.
Ihr kurzes Erscheinen im Matthäus-Evangelium wird auch noch heute im Gedächtnis der Menschen bewahrt. Sie gelten als Schutzpatrone, an die sich die Menschen in der Not wenden können, als Fürsprecher bei Gott.
Stark bezweifelt werden darf allerdings die Präsenz der Gebeine in Mailand. Trotz eines Steinsarkophags52 mit der Aufschrift ,,sepulchrum trium regum" fällt es schwer zu glauben, daß sich die Reliquie jemals dort befunden hat. Es erscheint daher wenig logisch, daß die Mailänder zunächst bis ins 14. Jh. hinein den Verlust der Reliquie nicht beklagen, sich dann aber plötzlich inständig um Rückgabe der Reliquie bemühen. Dies wirkt aus heutiger Sicht schon ziemlich opportunistisch.
Aus diesem Punkt können wir schließen, daß es sich bei der Reliquienverehrung nicht immer nur um religiöse Interessen ging, sondern oftmals auch um wirtschaftliche. Wir können nicht mit absoluter Sicherheit behaupten, daß es sich wirklich um die sterblichen Überreste der drei Magier des Matthäus-Evangeliums handelt. Ebenso wird auch Rainald von Dassel gedacht haben, als er die Gebeine 1164 nach Köln überführte. Wir können aber mit großer Sicherheit behaupten, daß eben diese Gebeine der Stadt einen großen Reichtum beschert haben. Die ganze christliche Welt schaute nun auf die Stadt am Rhein, die zur endgültigen Ruhestätte der Hll. Drei Könige geworden war. Ob Rainald eben dies eingeplant hatte, bleibt sein Geheimnis.
[...]
1 GRIGSON, Geoffrey: The three Kings of Cologne, History Today 4 (1954), 793. Im weiteren Verlauf als: GRIGSON: Kings. angegeben.
2 LÄPPLE, Alfred: Reliquien. Verehrung, Geschichte, Kunst, Augsburg 1990, 88.
3 Siehe hierzu SCHULTEN, Walter: Der Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom, Köln 1975, 4. Im folgenden als SCHULTEN: Dreikönigsschrein. angegeben.
4 Eine chemische Analyse der Knochen im Dreikönigsschrein, die meines Wissens noch nicht stattgefunden hat, wäre dringend von Nöten, um das Alter der Knochen zu bestimmen. Allerdings empfiehlt es sich auch, auf den Glauben und die Pietät Rücksicht zu nehmen.
5 Mt 2, 1-12.
6 Sehr wahrscheinlich ist die Annahme, daß der Volksglaube die Anzahl der Gaben mit der der Magier gleichgesetzt hat. ,,Erst Origines spricht im 3. Jh. n. Chr. von drei Magiern, analog zur Anzahl der Geschenke ...". Siehe DICKE, Hans Joseph: Zur Entwicklung des Dreikönigsbildes. in: WIENAND, Adam (Hrsg.): Die Heiligen Drei Könige. Heilsgeschichtlich, kunsthistorisch, das religiöse Brauchtum, Köln 1974, 67. Dieser Sammelband wird im folgenden als WIENAND: Drei Könige. angegeben.
7,,Give a name and someone is created, he is at once distinct, he has an exsistence, a personality, a self ..."(GRIGSON: Kings, 795). Es kann davon ausgegangen werden, daß der Volksglaube den Magiern Namen gab. Zuerst wurden die Namen in einer ins 8. Jh. datierten Abschrift einer angeblich aus dem 6. Jh. stammenden Vorlage erwähnt. Die Excerpta latina babrari nennt die Namen Bithisarea, Melichior und Gathaspa. Siehe hierzu: HOFMANN, Hans: Die Heiligen Drei Könige. Zur Heiligenverehrung im kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben des Mittelalters (Rheinisches Archiv 94), Bonn 1975, 74. Im folgenden als HOFMANN: Könige. angegeben. Ferner MIESEN, Hans Jürgen: Die Dreikönigenverehrung in der Literatur, in WIENAND: Drei Könige, 63.
8 Der erste, der behauptet, daß Caspar ein Mohr sei, ist Johannes von Hildesheim. Er beschreibt dies in seiner Historia de translatione beatissimorum Trium Regum, die zwischen 1364 und 1375 abgefaßt und zu einem vielgelesenen und häufig reproduziertem Buch wurde. Siehe HOFMANN: Könige, 111. Ebenso MIESEN: a.a.O., 64.
9 Denn zu Königen wurden die biblischen Magier erst ab dem 6. Jh. n. Chr. Zwar erhob schon Tertullian (um 222) die Weisen in den königlichen Rang, jedoch wurden die Magier vor allem ab dem ab dem 10 Jh. bildlich mit Königskronen statt mit den üblichen phrygischen Mützen dargestellt. Siehe hierzu: HOFMANN: Könige, 74. ,,Wunschdenken verwandelte Magier in Könige." Vielfach wird hier auf den Psalm 72 (71), 10f. und auf Jesaia 60, 3. hin- gewiesen. In diesen Visionen ist von Königen aus östlich von Palästina liegenden Gegenden die Rede, die den Magiern des Matthäus-Evangeliums sehr ähnlich sind.
10 Diese Datierung paßt recht gut in den Anfang der christlichen Reliquienverehrung. Es war im römischen Reich unüblich, ja sogar verboten, die Gebeine von Verstorbenen zu heben und an anderer Stelle wieder zu begraben. Römische Herrscher verboten den ersten christlichen Gemeinden den Gottesdienst an den Gräbern von Märtyrern auszuüben. Damit sollte die Gruppe in einem Kernpunkt ihrer Glaubensausübung getroffen werden. Siehe hierzu KÖTTING, Hermann: Reliquienverehrung, ihre Entstehung und ihre Formen, Trierer theologische Zeitschrift 67 (1958), 321-334. Ferner ANGENENDT, Arnold: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München (2. Aufl.) 1997.
11 Aegidii Aureaevallensi Gesta Episcopocum Leodiensium L. III. (MGH SS 17, 107.): ,,Beata Helena, mater Constantini imperatoris, cum esset cunctis virtutibus ornata et circa religionem christianorum devotissima ...".
12 Wo genau, wird allerdings nicht beschrieben.
13 Auch dies wird beschrieben in: siehe Anmerkung 11
14 Capella St. Eustorgius
15 Epistola XXI (Migne PL 16, 860/ Sp. 1055.)
16 Ebenso wenig bestätigt Ambrosius die Präsenz der Gebeine in seinem Lukaskommentar (Expositionis in Evangelium secundum Lucam libri X., Migne PL 15, Sp. 1650-1652.), welcher in ausführlicher Weise von den Drei Königen handelt. Siehe dazu auch HOFMANN: Könige, 77.
17 HOFMANN: Könige, 79.
18 Zu denen auch die Gesta episcoporum Leodiensium gehört.
19 Siehe hierzu HOFMANN: Könige, 80-94. Hier finden wir auch eine detaillierte Auflistung der verschiedenen Versionen. Ferner GEARY, Patrick J.: Living with the dead in the middle ages, Ithaca & New York 1994, 246f. Im Folgenden als GEARY: Living. angegeben.
20 POTTHAST, August: Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, Bd. 2, Berlin 1896, 977. Im folgenden als POTTHAST: Wegweiser. angegeben. Bei HOFMANN: Könige, 76. Bei GEARY: Living, 248f.
21 Diese Annahme wird gestützt durch Annales Mediolanenses minores (MGH SS 18, 395): ,, ... Magi erant ad Sanctum Eustorgium."
22 Im Gegensatz zu HOFMANN stellt GEARY die These auf, daß Robert von Torigni all diese Nachrichten erst nach der Translation der Hll. Drei Könige nach Köln erfahren habe. Niemand geringerer als Rainald von Dassel selbst soll ihm diese Informationen gegeben haben. GEARY: Living, 247-251. Würde sich diese Anname als Tatsache bestätigen lassen, hieße das, daß Rainald von Dassel die ganze Geschichte frei erfunden hätte.
23 Bei GEARY: Living, 248f. ,, ... integra exterius ...". Ein wichtiges Zeichen für die Heiligkeit der aufgefundenen Gebeine. Für eingehendere Befassung mit diesem Thema: ANGENENDT, Arnold: Corpus incoruptum. Eine Leitidee der mittelalterlichen Reliquienverehrung, Saeculum 42 (1991), 320-348.
24 Vgl.: Ex Wilhemini Neuburgensis historia anglicana (MGH SS 27, 229.): ,, ... in urbem transtulerunt: trium (...) magorum corpora ..."
25 Siehe Anmerkung 21: ,,Aggressus ergo Mediolanenses, defectu omnium sociorum ...".
26 MGH Diplomata regum et imperatorum germaniae, 10, 445.
27 Dieser Umstand wurde durch die Legenden geschürt, die sich um die Überführung der Reliquie ranken. Die Annales S. Disibodi (MGH SS 17, 30.) lassen verlauten, daß Rainald die Reliquie heimlich in einzelnen Särgen nach Köln überführte. Die legendarischen Annales Egmundani (MGH SS 16, 465.), die aus dem 13. Jh. stammen, berichten gar von einem Verrat der Mailänder. Auch hier soll Rainald die Reliquie hinter dem Rücken des Kaisers nach Köln geschafft haben.
28 Vgl. HOFMANN: Könige, 100.
29 Annales Aquenses (MGH SS 16, 686); Annales Sancti Perti Erphesfurdenses (MGH SS 16, 23.). Diese mögen durch ihre Kürze repräsentativ für die Vielzahl der Einträge in Annalen und Chroniken stehen, da sich viele im Wortlaut nur geringfügig unterscheiden.
30 E Radulfi Nigri chronica anglico (MGH SS 27, 343.): ,,Tres Magi illi qui Dominum requisierunt Coloniam asportati sunt a Mediolano sub Frederico imperatore."
31 Ex annalibus Islandicis (MGH SS 29, 259.): Rainoldus erchibuskup af Colni flutti likhami konunga Mediolanoborg i Colni.".
32 Rainald selbst bestätigt diese Tatsache, in seinem Brief vom 12. Juni an seine Gemeinde (MANSI, Joannes Dominicus: Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, 21, 865f. Im folgenden als MANSI: Collectio. angegeben.). Vgl. ferner HOFMANN: Könige, 99f.
33 Der erste, der überhaupt beginnt, den Verlust der Hll. Drei Könige zu beklagen, ist Bovesin da la Riva in seinem Buch De magnalibus urbis Mediolani. Siehe hierzu POTTHAST: Wegweiser, Bd. 1, 488f. Ferner HOFMANN: Könige, 115.
34 Gesta Frederici I. Imperatoris in Lombardia (MGH SS rer. Germ. in us. Schol. 42, 58.).
35 Rainald stützt dieses Datum durch die Angabe ,, ... II Idus Junii ...".
36 KNIPPING, Richard: Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter , Bd. II., Bonn 1901, 131. Im folgenden als KNIPPING: Erzbischöfe. angegeben.
37 HOFMANN: Könige, 103.
38 Reliquien wurde jederzeit eine Wirkungsmacht, sowohl positiv als auch negativ, zugesprochen. Daß heißt, daß die Heiligen durch ihr Ableben bei Gott, durch ihre Überreste aber auch bei den sie verehrenden Menschen zugegen waren. Man muß daher annehmen, daß die Translation nach Köln dem Willen der Hll. Drei Könige Willen entsprach, vielleicht weil sie sich in Mailand nicht genügend verehrt fühlten. Vgl. hierzu LEGNER, Anton: Reliquien in Kunst und Kult, Darmstadt 1995, 37-44.
39 Diesem Gedanken folgend, ist es nicht verwunderlich, daß wir im Seitenschiff des Kölner Doms auf ein kunstvoll bemaltes Fenster treffen, daß uns die Hll. Drei Könige bei der Anbetung des Christuskindes zeigt, das auf dem Schoß seiner Mutter sitz. Vor ihrem Thron hat einer der Könige seine Herrschaftsinsignien abgelegt. Die Könige tragen also laut dieser Darstellung eine durch Christus legitimierte Königswürde.
40 ENGELS Odilio: Dreikönige. Reichsheilige, Lexikon für Kirche und Theologie 3 (1995), 366f. Ferner Ders.: Drei Könige. Verehrung, Lexikon des Mitelalters 3 (1986), 1388. Außerdem TORSY, Jacob: Achthundert Jahre Dreikönigenverehrung in Köln, Kölner Domblatt 23/24 (1964), 26-35.
41 Siehe MANSI: Collectio, 865
42 PETERSOHN, Jürgen: Kaisertum und Kultakt in de Stauferzeit. in: ders. (Hrsg.): Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter (Vorträge und Forschungen 42), Sigmaringen 1994, 109/143.
43 Balduini Ninovensis Chronicon. (MGH SS 25, 535.): ,, ... et cum magno gaudio et exultatione totius provincie processione mirabiliter ordinata nec simili omnibus retro seculis visa vel audita civitati Coloniensi illata et in ecclesia s. Petri reposita sunt."
44 HOFMANN: Könige, 102.
45 So ist heute nicht mehr rekonstruierbar, wie die Gebeine der Hll. Drei Könige transportiert wurden oder in welchen Behältnissen sie sich während der Reise befunden haben. Nur durch Legenden können wir uns ein Bild davon machen. Ebd., 100.
46 Wie die schon in Anmerkung 8 erwähnte Historia de translatione beatissimorum Trium Regum des Johannes von Hildesheim.
47 Er soll einer Seuche erlegen sein, aber um welche es sich dabei handelt, ist umstritten. Siehe auch KNIPPING: Erzbischöfe, 140.
48 Für Bildmaterial siehe SCHULTEN: Dreikönigsschrein, 9, 35 und 43. Ferner LEGNER: Reliquien. Außerdem: BLOCH, Peter: Der Dreikönigsschrein. in: WIENAND: Drei Könige 23.
49 Man bedenke, daß Otto IV. nach seiner Königswahl 1198 die Frontseite des Schreines stiftet. Die aus reinem Gold verarbeitete Platte zeigt ihn selbst an der Anbetung des Christuskindes durch die Hll. Drei Könige teilnehmend, als vierten König. Wahrscheinlich aber ist, daß 1191 der erhaltene Holzkern des Schreins bereits vollendet war. Siehe dazu LAUER, Rolf: Dreikönigenschrein, Lexikon des Mittelalters 3 (1986), 1389.
50 Sie sind drei Könige, die dem Christuskind drei Gaben schenken. Drei Mal wurden sie gehoben und überführt. Ein Kreislauf, der in Köln seinen Endpunkt finden sollte.
51 Siehe GEARY: Living, 245f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über die Heiligen Drei Könige?
Die Arbeit behandelt die Geschichte der Reliquie der Heiligen Drei Könige. Sie beginnt mit einer kurzen Einleitung über den Weg der Gebeine von ihrer Fundstelle über Konstantinopel nach Mailand. Der Schwerpunkt liegt auf der Barbarossazeit (1152-1190), insbesondere auf den Umständen, unter denen die Reliquie nach Köln gebracht wurde, den beteiligten Personen und dem Nutzen dieser Translation, besonders für Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Die Arbeit untersucht auch Besonderheiten und Unstimmigkeiten in der Geschichte der Heiligen Drei Könige.
Was sagt die Bibel über die Magier, die später als Heilige Drei Könige bekannt wurden?
Das Matthäus-Evangelium berichtet von Magiern aus dem Morgenland, die kurz nach der Geburt Christi nach Betlehem kamen, um das neugeborene Kind zu suchen. Sie wurden von einem Stern geleitet und huldigten Jesus mit Gaben (Gold, Weihrauch und Myrrhe). Matthäus erwähnt jedoch weder die Anzahl der Magier, noch ihre Herkunft oder ihre Namen. Er bezeichnet sie als Sterndeuter und Magier, aber nicht als Könige.
Wie kamen die Gebeine der Magier nach Konstantinopel und Mailand?
Im 3. Jh. n. Chr. soll Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, die Gebeine der Magier in Persien und Palästina gefunden und nach Konstantinopel gebracht haben. Im 4. Jh. soll Eustorgius, ein Ratgeber des Kaisers von Konstantinopel, die Gebeine nach Mailand überführt haben, wo sie in einer Kirche aufbewahrt wurden.
Gibt es Beweise für die Verehrung der Heiligen Drei Könige in Mailand?
Es gibt nur wenige oder keine Quellen aus Mailand, die von einer Dreikönigsverehrung oder von der Existenz der Reliquie in Mailand berichten. Dies wirft Zweifel an der Präsenz der Gebeine in Mailand auf.
Wie wurden die Gebeine in Mailand wiedergefunden?
Die Gebeine sollen im Jahr 1158 in einer alten Kapelle in der Nähe von Mailand wiedergefunden worden sein. Robert von Torigni berichtet, dass bei der Öffnung des Sarkophags drei Körper gefunden wurden, die äußerlich unbeschädigt waren.
Wie kamen die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln?
Nach der Belagerung Mailands im Jahr 1162 schenkte Kaiser Friedrich I. Barbarossa dem Reichskanzler und Erzbischof von Köln, Rainald von Dassel, die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Rainald überführte die Reliquie im Jahr 1164 nach Köln.
Welche Bedeutung hatte die Reliquie für Kaiser Friedrich Barbarossa?
Die Reliquie der Heiligen Drei Könige diente Kaiser Friedrich Barbarossa als Mittel zur Stärkung seines Anspruchs auf eine von Gott gegebene Kaiserwürde. Da Friedrich sich nicht mehr nach dem Papst, sondern direkt neben ihn in der hierarchischen Rangfolge sah, benötigte er Beweise, die diesen Anspruch stützen konnten. Durch die Gebeine, die er aus Mailand holte, konnte er seine Reichsmacht demonstrieren.
Wie wurden die Gebeine in Köln empfangen?
Rainald von Dassel traf am 23. Juli 1164 mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige in Köln ein und wurde vom Volk mit großem Jubel empfangen. Die Gebeine wurden in einer feierlichen Prozession in die Bischofskirche gebracht.
Was geschah nach der Translation der Reliquie nach Köln?
Nach dem Tod Rainalds von Dassel wurde Philipp von Heinsberg Erzbischof von Köln. Er beauftragte den Goldschmied Nikolaus von Verdun mit der Anfertigung des Dreikönigsschreins, in dem die Gebeine im Jahr 1191 beigesetzt wurden. Der Kölner Dom wurde ab 1248 als letzte Ruhestätte der Heiligen Drei Könige erbaut.
Haben die Mailänder versucht, die Reliquie zurückzubekommen?
Obwohl die Mailänder den Verlust der Reliquie zunächst nicht beklagten, bemühten sie sich seit dem 14. Jh. um die Rückgabe der Dreikönigsreliquie. Erst zu Beginn des 20. Jh. gingen kleinere Gebeine aus dem Dreikönigsschrein an Mailand zurück.
- Arbeit zitieren
- Stefan Knode (Autor:in), 2000, Die Heiligen Drei Könige-Die Entstehung eines Heiligenkults, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98286