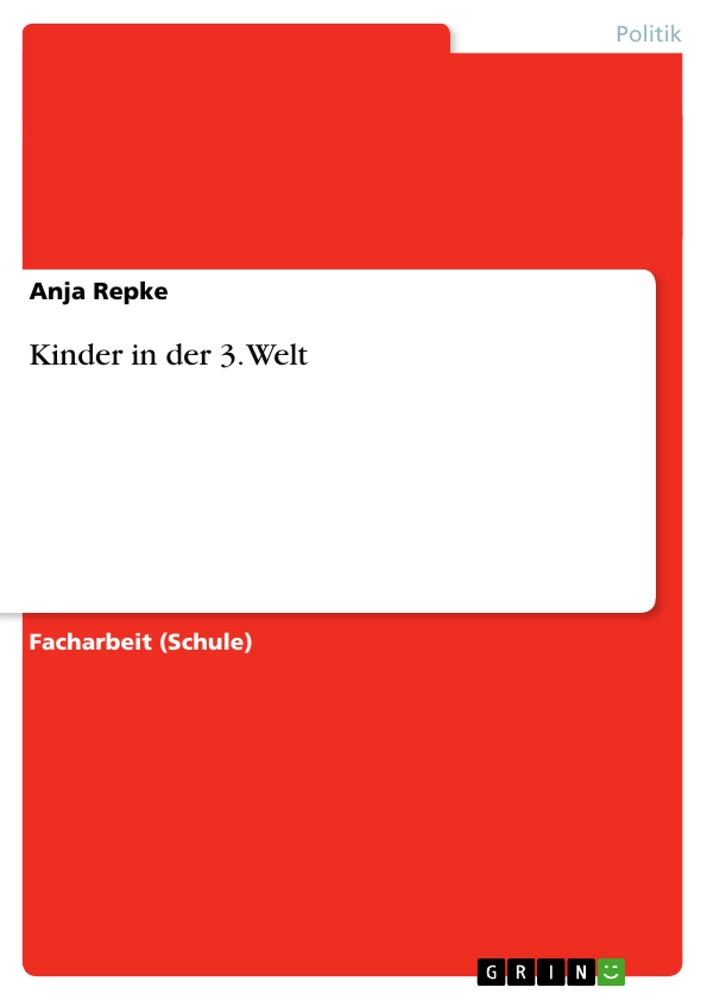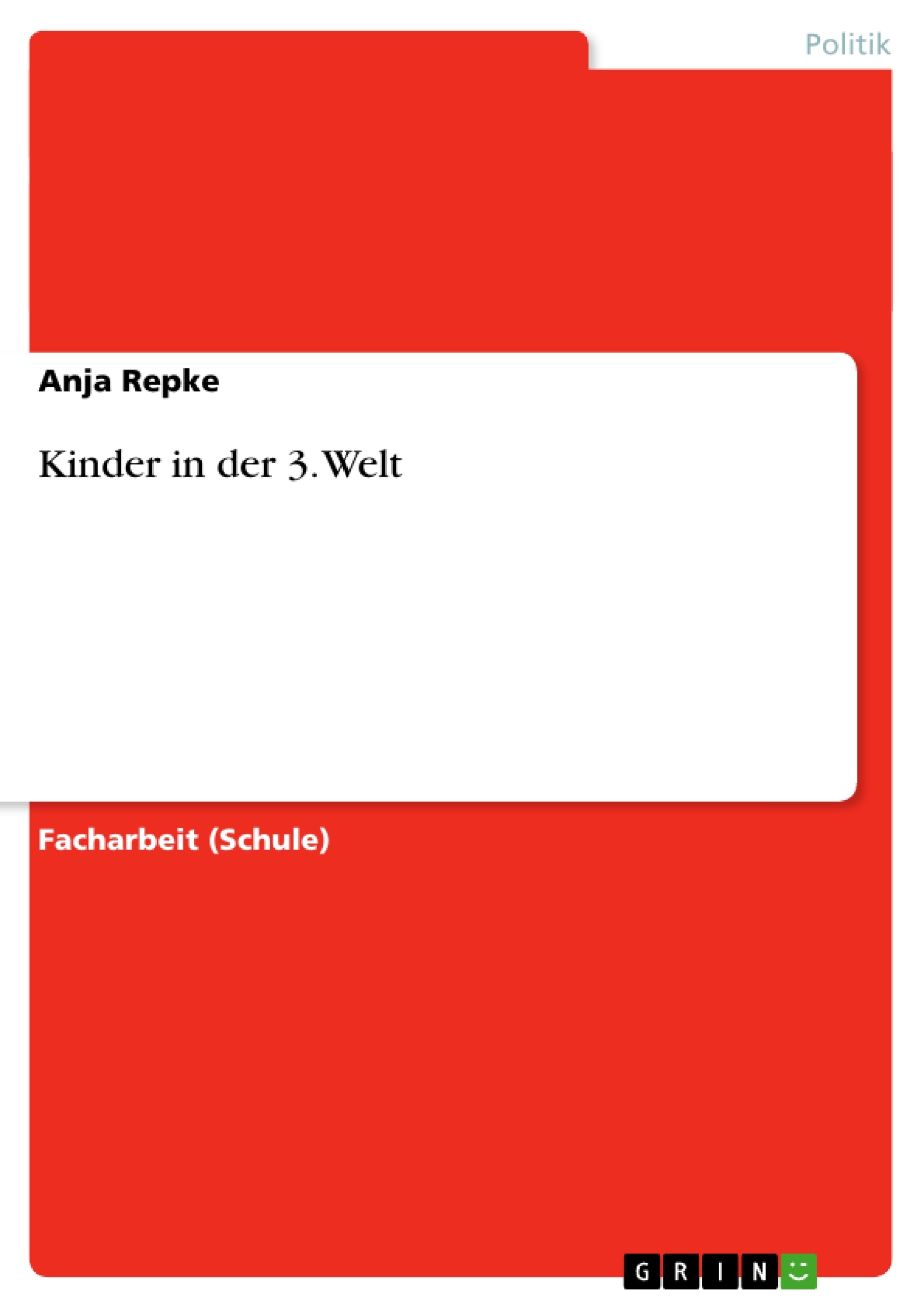Gliederung
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition:
2.1. Dritte Welt
2.2. Entwicklungsländer
3. Merkmale der Entwicklungsländer
3.1. Bruttosozialprodukt / Pro - Kopf - Einkommen
3.2. differenzierter Merkmalskatalog
3.2.1. ungünstige klimatische Bedingungen
3.2.2. ökonomische Probleme
3.2.3. demographische Merkmale
3.2.4. soziale Probleme
3.2.5. ökologische Probleme
3.2.6. kulturelle Probleme
3.2.7. politische Situation
4. „Auch Kinder haben Rechte“
4.1. Die Konvention über die Rechte des Kindes
4.2. Die Rechte der Kinder
4.3. konkrete Bedeutung der Rechte anhand von sechs Beispielen
5. Kinderarbeit in der Dritten Welt
5.1. Ist es so schlimm, wenn Kinder arbeiten?
5.2. Hat es nicht immer Kinderarbeit gegeben? - Zur Geschichte der Kinderarbeit.
5.3. Formen der Kinderarbeit - Methoden der Ausbeutung
5.4. Warum müssen Kinder arbeiten?
5.5. Kinderarbeit am Anfang einer internationalen Handelskette - Der Weg eines indischen Teppichs
5.6. Die Mitverantwortlichkeit des Endverbrauchers am weltweiten Geschäft mit der Kinderarbeit
6. Resümee
1. Einleitung
In allen Entwicklungsländern trifft man auf Menschen, die in Armut leben. Sie leiden unter der unbefriedigenden ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Situation.
Am meisten betroffen sind aber die Schwächsten und, meiner Meinung nach, auch Unschuldigsten: Die Kinder.
Aufgrund ihrer naturgegebenen „Schwäche“ und ebenso ihrer kindlichen Unerfahrenheit aber auch der miserablen Situation ihrer Familien stellen sie die idealen „Missbrauchsobjekte“ dar.
Unter Missbrauch verstehe ich in diesem Zusammenhang aber nicht nur den sexuellen Missbrauch, sondern eigentlich jede Form von Ausbeutung. Dabei spielt es für mich keine Rolle, ob es sich um körperliche oder seelische handelt. In den nun folgenden Seiten möchte ich zuerst auf die vielfältigsten Probleme in den Entwicklungsländern hinweisen, um so anschaulich zu verdeutlichen, warum Kinder zum Arbeiten gezwungen sind. Des weiteren sollen auch die Methoden der Ausbeutung von Kinderarbeit aufgezeigt werden.
Auch durch eine vorherige Erläuterung der Kinderrechte sollte es dem interessierten Leser dann möglich sein, sich über das Problem von Kinderarbeit in der dritten Welt im klaren zu sein, und sich darüber eine eigene Meinung bilden zu können. Diese sollte aber nicht nur auf rein subjektiven Empfindungen, sondern auf Tatsachen beruhen. Und dies sollte mit der vorliegenden Belegarbeit durchaus möglich sein.
2. Begriffsdefinition:
2.1. Die Dritte Welt
Allgemein werden die Länder der Welt in vier Gruppen eingeteilt. Diese werden mit 1., 2., 3. bzw. 4. Welt bezeichnet.
Unter der 1. Welt versteht man dabei die westlichen Industrieländer einschließlich Japans.
Mit dem Begriff 2. Welt werden die Staaten in Mittel - und Osteuropa sowie Asien, die bis Ende der 80er Jahre eine sozialistische Zentralverwaltungswirtschaft hatten und sich bis dahin weit gehend an der Entwicklung der Sowjetunion ausrichten mussten, zusammengefasst.
Die sogenannte 3. Welt umfasst die ärmsten Länder der Welt - allgemein gesagt also die, welche ebenso als Entwicklungsländer bezeichnet werden.
Von der 4. Welt ist die Rede, wenn von den ärmeren Entwicklungsländern die Rede ist, deren Lage sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert hat. Diese sind als am wenigsten entwickelte Länder auf die Hilfe der anderen angewiesen. Zu dieser Gruppe zählen derzeit 48 Länder. Die meisten davon liegen in Afrika.
2.2. Entwicklungsländer
Südlich der meisten Industrieländer gibt es auf der Weltkarte einen Gürtel von Ländern, in denen die Mehrzahl der Menschen unter armen und größtenteils auch ärmsten Bedingungen leben.
Diese Länder haben an der Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht teilgenommen. Also genau jene Jahrzehnte, die den Menschen in den westlichen Industrieländern, d.h. in Europa, Nordamerika, und Ostasien ( Japan ), einen hohen Lebensstandard, soziale Sicherheit bei Krankheit und im Alter sowie ein breites Angebot an Schulen und Arbeitsplätzen gebracht hat.
Obwohl der Begriff „Entwicklungsländer“ eigentlich vortäuscht, dass die damit bezeichneten Länder sich entwickeln, wird dieser Ausdruck in der Praxis verwendet. Doch in Wirklichkeit trifft diese Eigenschaft nur auf einen verschwindend geringen Anteil der Entwicklungsländern zu.
3. Merkmale der Entwicklungsländer
3.1. Bruttosozialprodukt / Pro - Kopf - Einkommen
Die einfachste Bestimmung der EL1 und ihre Einordnung in die „Welt - Einkommenspyramide“ erfolgt nach dem Bruttosozialprodukt ( BSP )2, dem Bruttoinlandsprodukt ( BIP )3 oder dem Pro - Kopf - Einkommen.
Allerdings ist diese Einteilung allein nicht umfassend, weil dabei viele Gesichtspunkte, die typisch für EL sind und bei denen die Versuche zur Überwindung der Unterentwicklung ansetzen müssen, nicht berücksichtigt werden.
3.2. differenzierter Merkmalskatalog
3.2.1. ungünstige klimatische Bedingungen
Die Entwicklungsländer liegen entweder in der tropischen Klimazone ( tropischer Regenwald und Feuchtsavanne ) oder der trockenen Klimazone ( Trockensavanne und Wüsten ).
Die ungünstigen klimatischen Bedingungen in diesen beiden Klimazonen sind durch die Abhängigkeit von der Regenzeit gegeben: So kennt die Feuchtsavanne meist nur eine Trockenzeit. Die Trockensavanne hingegen zeichnet sich durch große Temperaturunterschiede der einzelnen Monate aus. In ihr gibt es außerdem nur eine kurze Regenzeit von höchstens drei Monaten.
Diese ungünstigen klimatischen Bedingungen wirken sich dann auf die Effektivität der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion aus. Denn bleiben die Regenzeiten aus, oder sind zeitlich zu stark verkürzt, so kommt es ( z. B. in den Savannengebieten Afrikas oder in den asiatischen Monsungebieten ) zu Versorgungsschwierigkeiten und Hungersnöten.
3.2.2. ökonomische Probleme
Die ökonomischen Probleme in den Entwicklungsländern sind hauptsächlich durch ein extrem niedriges Pro - Kopf - Einkommen gekennzeichnet.
Deshalb ist auch die zunehmende Verarmung der breiten Unterschicht in vielen El trotz der oft hohen Wachstumsraten nicht zu leugnen.
Ebenso typisch für EL ist die dualistische Wirtschaftsstruktur: Man unterscheidet eigentlich nur zwischen dem traditionell landwirtschaftlichen Sektor, in dem die große Mehrheit der Bevölkerung arbeitet, und einem sich entwickelnden Industriesektor.
Eine große Arbeitslosigkeit, Kapitalmangel und ein Mangel an technischen „Know - how“ sind ebenso charakteristische Merkmale wie die geringe Sparund Investitionsrate und die hohen Schulden bei den IL4.
Des weiteren ist auffällig, dass die EL entweder Monokulturen5 anbauen oder hauptsächlich einen oder einige wenige Rohstoffe ( z. B. Kupfer ) exportieren. Daraus ergibt sich die Gefahr der Abhängigkeit gegenüber den Schwankungen des Weltmarktpreises, welcher wiederum von den IL beeinflusst wird. Aus diesem Grund st ein Aufbau der Infrastruktur nicht möglich.
Zudem besitzen sie die EL keine oder nur eine gering entwickelte weiterverarbeitende Industrie im Land selbst.
3.2.3. demographische Merkmale
Das weltweite Bevölkerungswachstum hat sich in den letzten Jahrzehnten stark beschleunigt ( 1994: 1,5% ). So lag das Wachstum 1992 in den IL bei 0,6% und in den EL bei 2,1%.
Im Jahr 1992 betrug die Weltbevölkerungszahl noch 5,48 Mrd. Menschen. Doch schon zwei Jahre später, also 1994, ist diese Zahl auf 5,6Milliarden angewachsen.
Davon lebt der größte Anteil - über 4 Milliarden Menschen - in den EL. Man geht aufgrund dieser Tatsachen für das Jahr 2050 von einer Weltbevölkerung in Höhe von 11,6 Milliarden aus.
Nach Schätzungen der UNO werden die Bevölkerungszahlen sich bereits 2025 wie folgt verteilen: 1596,9 Millionen Menschen in Afrika, 332 Menschen in Nordamerika, 4,912 Milliarden Menschen in Asien, 515,1 Millionen Menschen in Europa, 38,2 Millionen Menschen in Ozeanien und schließlich noch 757,4 Millionen Menschen in Lateinamerika.
3.2.4. soziale Probleme
Zu den sozialen Problemen in den Entwicklungsländern gehören unter anderem die wachsende soziale Kluft innerhalb eines Landes und eine besonders starke Orientierung auf die Primärgruppen ( Stamm, Familie etc. ), die eine Herausbildung von Loyalität gegenüber übergeordneten Institutionen ( dem Nationalstaat, der regionalen Verwaltung etc. ) erschwert.
3.2.5. ökologische Probleme
Ebenfalls wie in den IL, sind auch die ökologischen Probleme der EL als Folgen der Industrialisierung, der Verstädterung und der chemiegestützten Landwirtschaft anzusehen.
Als besondere Probleme sind dabei die fortschreitende Desertifikation6 und Entwaldung - besonders des tropischen Regenwaldes - anzusehen. Diese Probleme verschlechtern aber nicht nur die Lage der EL, sondern aller Länder der Erde, denn sie tragen in erheblichem Maß zur Veränderung des Weltklimas bei. Man kann also ebenfalls sagen, dass an dieser Stelle die unmittelbare Betroffenheit des Nordens von der Unterentwicklung des Südens verdeutlicht wird.
3.2.6. kulturelle Probleme
Neben der hohen Analphabetenquote werden dazu auch solche Werthaltungen gerechnet, die eine Begrenzung der Bevölkerungsentwicklung verhindern. So wird in den EL eine hohe Kinderzahl neben der Sicherung der Überlebensmöglichkeiten für die Eltern im Alter auch als Auszeichnung angesehen.
Zudem wird die Verwendung von Empfängnisverhütungsmitteln oft aus religiösen Gründen abgelehnt.
3.2.7. politische Probleme
Die politischen Probleme und Merkmale der Entwicklungsländer sind sehr vielschichtig.
Gemeinsamkeiten lassen sich in der mangelnden Durchsetzungsfähigkeit bei der sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwicklung und in einem allgemein akzeptierten System der Korruption feststellen.
Oft wird eine soziale, ökonomische und politische Entwicklung durch Stammesfehden und zahlreiche Bürgerkriege verhindert.
4. „Auch Kinder haben Rechte“
4.1 Die Konvention über die Rechte des Kindes
Die Menschen haben Rechte, die Arbeiter haben Rechte und auch Frauen haben bestimmte Rechte. Und Kinder? - Auch Kinder haben Rechte! Diese sind in der Konvention über die Rechte des Kindes festgelegt und weltweit anerkannt.
Auch die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, den Rechten der Kinder nachzukommen, d.h. sie zu verwirklichen.
Doch leider besteht zwischen Wunsch und Wirklichkeit, nicht nur in den Entwicklungsländern, ein großer Unterschied:
- An jedem Tag sterben weltweit 35.000 Kinder, überwiegend an leicht zu behandelnden Krankheiten.
- Millionen von Kindern leben auf der Straße.
- Millionen von Kindern arbeiten unter katastrophalen und gesundheitsschädlichen Bedingungen.
- Millionen von Kindern werden als Dienstmädchen, Prostituierte oder Kindersoldaten ausgebeutet.
4.2. Die Rechte der Kinder
1. Gleichheit
2. Gesundheit
3. Bildung
4. Spiel und Freizeit
5. freie Meinungsäußerung, Information und Gehör
6. gewaltfreie Erziehung
7. Schutz in Krieg und auf der Flucht
8. Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung
9. elterliche Fürsorge
10. Betreuung bei Behinderung
4.3. konkrete Bedeutung der Rechte: Sechs Beispiele
- Recht auf Gleichbehandlung ( Chancen für Mädchen ): Nach Schätzungen von UNICEF sterben jedes Jahr weltweit 1,5 Millionen Mädchen, nur weil sie Mädchen sind. Sie sterben, weil sie schlechter ernährt und medizinisch versorgt werden als ihre Brüder. So werden bsw. weltweit über zwei Millionen Mädchen als Prostituierte ausgebeutet. - Maßnahmen zum Schutz und zur Gleichstellung von Mädchen müssen also ganz oben auf der politischen Tagesordnung in allen Ländern rund um den Globus stehen. Dazu zählen u. a. Bildungsprogramme speziell für Mädchen, ein Verbot von Kinderhandel, die internationale Strafverfolgung von Sextouristen und Rehabilitationsangebote für minderjährige Opfer sexueller Gewalt.
-Recht auf soziale Sicherheit: Viel zu viele Menschen unter 18 Jahren müssen in Armut leben. Allein in Deutschland sind es 2,2 von insgesamt 15,8 Millionen Kindern. Diese Kinder leiden besonders unter einem Mangel an kulturellen Angeboten und sozialen Dienstleistungen. Sie sind schlecht ernährt und ihre Gesundheitsvorsorge ist mangelhaft. Sie erkranken folglich häufiger und werden von Gleichaltrigen diskriminiert. Zudem beeinflusst die Armut das Leben in den Familien. Die tägliche Not führt häufig zu strengeren Erziehungsmethoden. Die betroffenen Familien brauchen endlich finanzielle Unterstützung, besondere Förderungsmaßnahmen für die Kinder durch Kindertagesstätten, Freizeit- und Berufsangebote und mehr Ganztagsschulen.
-Recht auf Gesundheit ( Zugang zu Wasser und Basisgesundheits- diensten ): Jedes Jahr streben in den Entwicklungsländern über drei Millionen Kinder an Durchfall. Viele von ihnen haben verschmutztes Wasser getrunken. - Wenn Kinder nur deshalb sterben müssen, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser und Basismedizin haben, dann verletzt dies ihr Recht auf Gesundheit. Auch Deutschland trägt eine Weltweite Mitverantwortung für die Rechte der Kinder. Doch nur 0,32 Prozent des deutschen BSP fließen in die Entwicklungshilfe. Dabei hat die Bundesregierung immer wieder versprochen, ihre internationale Verantwortung ernst zu nehmen und 0,7 Prozent des BSP für die Armen dieser Welt bereit zu stellen.
-Recht auf Spiel und Freizeit ( kindgerechter Lebensraum ): Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in der nähe der Wohnung sind für eine gesunde Entwicklung unabdingbar. Beim Spielen und bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten regen Kinder ihre Phantasie an und und lernen den sozialen Umgang miteinander. Doch die Vorraussetzungen hierfür sind denkbar ungünstig. Allein in Deutschland müssen rund eine halbe Million Kinder in schlechten Wohnungen oder Obdachlosenheimen leben. Und die Wege außerhalb der Wohnung sind gefährlich: 500 Kinder werden jedes Jahr im Straßenverkehr getötet, 50.000 verletzt.
Doch Kinder haben ein Recht auf sicheren und kindgerechten Lebensraum.
-Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht ( Hilfe für Kriegsflüchtlinge ): Nie haben so viele Kinder unter Kriegen gelitten, wie in unserem Jahrhundert. Rund die Hälfte der Kriegsflüchtlinge sind heute unter 18 Jahre alt - das sind 28 Millionen Kinder und Jugendliche auf der Erde. Militärische Gewalt verletzt die Kinder nicht nur körperlich. Weit über zehn Millionen Kinder haben in den vergangenen Jahren tiefe seelische Verletzungen durch Kriege und Flucht erlitten. Diese Kinder haben oft grauenvolles erlebt: die Trennung oder den Tod von Eltern, Lagerleben, Folter, Vergewaltigungen. Alpträume, Weinkrämpfe und Depressionen sind nur einige Folgen. Viele Flüchtlingskinder, die sich jetzt in Deutschland aufhalten, leiden unter ähnlichen Symptomen, ohne dass sie ausreichende Hilfe erhalten. Im Gegenteil: Flüchtlingskinder werden ausgegrenzt. Sie werden nicht kindgerecht behandelt und untergebracht.
-Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung ( Bekämpfung der Kinderarbeit ): Über 100 Millionen Kinder müssen weltweit arbeiten. Allein in der Teppichindustrie in Indien, Nepal und Pakistan arbeiten zwischen 750.000 und einer Million Kinder. Die meisten sind zwischen 12 und 14 Jahren alt, manche auch jünger. Sie arbeiten 10 bis 16 Stunden am Tag ohne Ruhezeiten an beengten und staubigen Webstühlen für geringen Lohn. Zeit für den Besuch einer Schule bleibt ihnen nicht, die Arbeit führt zu bleibenden Gesundheitsschäden. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Kinderarbeit in der Teppichindustrie ist die Einführung des Warenzeichens „Rugmark“ für indische Teppiche, die nicht von Kindern geknüpft wurden.
5. Kinderarbeit in der Dritten Welt:
5.1. Ist es so schlimm, wenn Kinder arbeiten?
Arbeit kann den Kindern neue Möglichkeiten eröffnen. Sie kann den Horizont erweitern. Sie kann zur Selbstverwirklichung beitragen; sie kann Sinn und Befriedigung geben und Anerkennung bringen. Sie kann frei machen. Sie kann das alles - muss es aber nicht.
Oft wird sie geradezu dazu eingesetzt, das Gegenteil von alledem zu verwirklichen, auch und ganz besonders bei Kindern.
Von genau dieser Arbeit soll nun im folgenden die Rede sein:
Von einer Arbeit, welche die Kinder in ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung hemmt.
Von einer Arbeit, die ihnen die Chance zum Schulbesuch nimmt.
Von einer ausbeuterischen Arbeit, die das Leben und die Zukunft von Kindern zerstört und anderen Profit bringt.
Das Arbeit auch durchaus sinnvoll sein kann, Kinder durch Arbeit viel für das Leben lernen können, soll das folgende Beispiel aus Afrika zeigen:
In der ziemlich traditionellen Erziehung der Bariba7 in Benin8 hat jedes Familienmitglied bestimmte Pflichten zu erfüllen.
So beaufsichtigen die größeren Kinder das Kleinkind, wenn die Mutter nicht zu Hause ist.
Die älteren Frauen bringen den jungen Mädchen bei, wie man Hirse zerreibt, Maniok stampft, Yams kocht, den Wasserkrug auf dem Kopf trägt und welche Blätter sich für eine gute Soße eignen.
Die Männer hingegen kümmern sich um die Weiterbildung der Jungen. Sie lernen, wie man rodet, mit Hacke und Pflug umgeht, welche Feldfrüchte zu welcher Zeit gesät und geerntet werden, wie man Baumwollfelder behandelt und wie gedüngt wird. Sie lernen außerdem, wie man Häuser baut und das zähe Elefantengras für die Matten zusammenbindet.
Aber die Grenzen zwischen sinnvoller und schädlicher Arbeit werden dann überschritten, wenn die Kinder zum Profit anderer ausgebeutet und zu körperlich schweren oder langen Arbeiten gezwungen werden, die sie in ihrer körperlichen, geistigen und emotionalen Entwicklung hemmen, wie es auch erst schon erläutert worden ist.
5.2. Hat es nicht immer Kinderarbeit gegeben? - Zur Geschichte der Kinderarbeit
In der gesamten geschichtlichen Entwicklung hat es immer und überall Kinderarbeit gegeben. Eine „arbeitsfreie Kindheit“ kannten über Jahrtausende nur Kinder von Adeligen, Patriziern, reichen Kaufleuten, hohen Beamten und Geistlichen.
Man kann also schlussfolgern, dass Kinderarbeit bisher immer eine „Klassenfrage“ war, und es auch in Zukunft bleiben wird. Bauern, Pächter, kleine Handwerker und Händler, Diener, Tagelöhner und Bettler konnten ihre Kinder nur durchbringen, wenn sich diese so früh wie möglich am Broterwerb beteiligten. Schulen gab es für diese Kinder nicht. Wer „unten“ geboren wurde, blieb auch meistens „unten“ und setzte auch wieder Kinder in diese Welt „da unten“ ( von denen sehr viele äußerst früh sterben mussten ).
Kinderarbeit war also immer üblich in Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Später, in den Zeiten der Früh- und Hochindustrialisierung, auch in Manufakturen, Arbeits- und Waisenhäusern, Fabriken und Bergwerken. Es ist also feststellbar, dass die Kinderarbeit immer eine Folge von Massenarmut ist. - Dabei mussten die zahlreichen Tagelöhner froh sein, überhaupt irgendeine Arbeit zu finden, die zumindest ein notdürftiges Überleben sicherte. Zudem kann man sagen, dass der Grad der Ausbildung von Kindern von der Art des herrschenden Systems und dem technischen Entwicklungsstand einer Gesellschaft abhängig sind.
So kann man dem Kapitalismus nicht den Vorwurf ersparen, dass er sich auch durch die Ausbeutung von Kinderarbeit entwickelt hat.
Momentan entwickelt sich auch der periphere Kapitalismus auf dem gekrümmten Rücken von vielen Millionen Kindern.
Die kämpferische Pädagogin und Politikerin CLARA ZETKIN ( 1857 - 1933 ) hat in einer flammenden Anklagerede die Ausbeutung des „proletarischen Kindes“ durch den Kapitalismus verurteilt:
„Unter den vielen schweren Verbrechen des Kapitalismus, über welche die Geschichte zu Gericht sitzen wird, ist keines brutaler, grausiger, verhängnisvoller, wahnwitziger, mit einem Worte: himmelschreiender als die Ausbeutung der proletarischen Kinder durch das Kapital, was besagt das anderes als Raub und Vernichtung, begangen an der Schwächsten, Wehrlosesten und Schutzbedürftigsten aller Gesellschaftsmitglieder. Der Kapitalismus packt mit harter Faust das proletarische Kind, das schon vor seiner Geburt durch die rücksichtslose Ausbeutung von Mutter und Vater bedroht und geschädigt wurde. Er peitschte es mittels der Not oder der Ungewissheit der Eltern in die Fabrik, in die Werkstatt, in die Ziegelhütte, zum Straßenhandel, zum Rübenziehen und Viehhüten, zum Kegelaufsetzen und Wareaustragen oder in die mörderische Hausindustrie. Hier gliedert er es seiner Profitmühle ein, die auspresst, was von Muskel- und Nervenkraft in Gold verwandelt werden kann, und die ein armseliges, körperlich und geistig zermalmtes Geschöpf entlässt. So hat die kapitalistische Ausbeutung der kindlichen Arbeitskraft Geschlechter auf Geschlechter dem Verkümmern überliefert.“
Der in der Bundesrepublik und in anderen westlich - kapitalistischen Staaten aufgebaute Sozialstaat hat zusammen mit der Lage der Eltern auch die Lage der Kinder deutlich verbessert. Überall wurde Kinderarbeit verboten. Die Vereinten Nationen, ihre Hilfsorganisation für Kinder UNICEF und das internationale Arbeitsamt haben auf dem Papier von Resolutionen und Konventionen den Schutz für Kinder in der ganzen Welt weit ausgebaut. Heutzutage ist Kinderarbeit ein Folgeproblem der „internationalen sozialen Frage“. Sie ist ein Folgeproblem der globalen Apartheid des Nord - Süd - Gegensatzes geworden:
Was in unseren sozialen und wirtschaftlichen Breitengraden schon weitgehend Geschichte ist, die möglichst verdrängte Geschichte von Massenelend und Ausbeutung von Eltern und ihren Kindern, ist in großen Teilen der Dritten Welt noch Gegenwart und tagtägliche Wirklichkeit.
Und wieder erweist sich Kinderarbeit als eine Klassenfrage. Und diese Frage kann nur mit einer grundlegenden Veränderung der Klassen- und Herrschaftsverhältnisse beantwortet werden.
5.3. Formen der Kinderarbeit - Methoden der Ausbeutung
Kinderarbeit spielt sich auf dem Land vor allem unter Kleinbauern und landlosen Landarbeitern, in den Städten im sogenannten informellen Sektor ab. Dieser informelle Sektor bezeichnet jenen Bereich der wirtschaft, der von geringer Produktivität und niedrigen Verdienstmöglichkeiten, von fehlender gewerkschaftlicher Organisation und hoher sozialer Unsicherheit geprägt wird. Er umfasst kleine Werkstätten, Heimindustrie, Reparaturbetriebe, Wäschereien, den Klein- und Straßenhandel und eine Fülle von Dienstleistungen. Dieser Sektor ist aus der Verlagerung der ländlichen Armut in die Städte entstanden, wo die meist unqualifizierten und analphabetischen Landflüchtigen keinen Arbeitsplatz im formellen Sektor finden können.
Da der informelle Sektor dem formellen Sektor als ständige Reservearmee von Lohnarbeitern zur Verfügung steht, erlaubt dies den Unternehmen die löhne niedrig zu halten und selbst die festgesetzten Mindestlöhne ( die sowieso schon kaum das Existenzminimum decken ) zu unterlaufen. Denn es gibt ja genügend Menschen - vor allem auch Kinder - die zum Überleben fast jede Arbeit annehmen.
Die Kinderarbeit spielt sich, abgesehen von den Scharen an Zeitungs-, Los-, Zigaretten- oder Kaugummiverkäufern, Schuhputzern oder Laufburschen auf den Strassen absieht, im Verborgenen ab..
Die Betriebe, in denen die Kinder arbeiten, sind meist in Slums und Hinterhöfen versteckt. Und was dort alles vor sich geht, sieht man nicht.
Zwar gibt es in fast allen Staaten Gesetze gegen Kinderarbeit, aber diese greifen nicht, wo extreme Armut herrscht und Kinder außerhalb des formellen Sektors Arbeit suchen.
Außerdem wagt es ein Polizist auf dem Land nicht, gegen den Großgrundbesitzer vorzugehen. Und der kleine Polizist oder Inspektor des Arbeitsministeriums in der Stadt lässt sich in der Regel die Chance nicht entgehen, für sein Schweigen ein kleines Zubrot zu kassieren.
Unter einer Vielfalt von Kinderarbeit, sind die folgenden Hauptformen vorhanden:
- am weitesten verbreitetste Form ist die Arbeit im eigenen Haushalt; Beispiele: Verrichten harter Feldarbeit, Hüten von Tieren ( Hirtenkinder ), Erstellen von Teppichen und Wollwaren → keine Zeit zum Schulbesuch → Verlust der Lebenschancen, denn als Analphabet besteht ( fast ) keine Möglichkeit aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen
-es gibt eine Art von selbstständiger Kinderarbeit; dazu zählen eine Fülle von Tätigkeiten: Schuhputzer, Zeitungsverkäufer, Altmetallsammler, Lastenträger, Autowäscher, Aufpasser auf Parkplätzen, Bauchladenhändler; man kann auch Betteln und Kinderprostitution zurechnen, obwohl die Prostitution meist von Zuhältern organisiert ist; → häufig Organisation in Banden ( = Familienersatz ), um sich gegenseitig zu helfen und im Konkurrenzkampf auf der Straße besser zu bestehen
-lohnabhängige Kinderarbeit in Haushalten ( als Hausmädchen ), Werkstätten und Kleinbetrieben, also im informellen Sektor; in der Regel nur Bruchteil des gesetzlichen Mindestlohnes um durch Ausbeutung der Kinderarbeit konkurrenzfähig zu bleiben
-auch im formellen Sektor gibt es Kinderarbeit; z.B. in Bergwerken, Steinbrüchen oder auf Plantagen; Kinder müssen härteste Akkordarbeit leisten; allerdings kommt sie eher am Rand des Produktionsgeschehens vor, da Maschinen bereits die einfachsten Handgriffe übernommen haben; außerdem sind die Gewerkschaften besser organisiert und können Kinderarbeit aus Sorge um eigene Arbeitsplätze eher verhindern
-Kindersklaverei; Sklaverei meint extreme Ausbeutung und Abhängigkeit, die in Leibeigenschaft übergeht; existiert auch heute noch in Form der Schuldknechtschaft, besonders in Indien: die Arbeitskraft eines Kindes wird dabei einem Kreditmakler als eine Art Sicherheit für einen Kredit überlassen; das Kind wird erst dann wieder entlassen, wenn der Kredit mit Zins und Zinseszinsen zurückgezahlt oder durch Arbeit abgeleistet worden ist;
Begriff der Sklaverei auch angebracht, wenn die Kinder wie Tiere in Käfigen gehalten werden, gar keinen oder nur sehr geringen Lohn erhalten und von Arbeitsvermittlern geschachert, vermietet und verkauft werden; dies ist besonders im Geschäft mit der Kinderprostitution anzutreffen
5.4. Warum müssen Kinder arbeiten?
Obwohl diese Frage schon beantwortet worden ist, möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz darauf eingehen:
Der Grund für die Kinderarbeit liegt in der Massenarmut. Weil die Armut in den Entwicklungsländern nicht kleiner sondern größer wird, wächst auch der Zwang zur Kinderarbeit.
Die Entwicklungshilfe hat dieses „Verelendungswachstum“ nicht aufhalten können, weil sie - entgegen allen vorherigen Absichtserklärungen - keinen gezielten Kampf gegen die Massenarmut führte und ihre Gelder und Hilfsmaßnahmen nicht jene Schichten erreichten, in denen Kinderarbeit ein notwendiges Mittel im Kampf ums Überleben ist.
Und diese absolute Armut, zu der rund 800 Millionen Menschen verurteilt sind, bedeutet, zum Leben zu wenig und zum Sterben zuviel zu haben.
Und an dieser stelle setzt auch die eigentliche Ursache für die Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern ein: Arme Eltern setzten möglichst viele Kinder in die Welt, damit ihnen die überlebenden Kinder das eigene Überleben ermöglichen und vor allem so etwas wie eine Altersicherung verschaffen.
Und je größer die Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Armut in einem Land sind, desto mehr Kinderarbeit gibt es.
Diese ganze Verelendung, deren Opfer Erwachsene und Kinder sind, hat zunächst einmal mit den ungerechten Sozialstrukturen und politischen Gewaltverhältnissen in den Ländern der Dritten Welt zu tun.
Sie hat aber auch mit der Entwicklungspolitik der IL zu tun. Diese fördern bsw. eine Modernisierung, die Kleinbauern vom Land vertreibt und diese dann massenhaft in die Arbeitslosigkeit und die Elendsviertel der Städte wirft.
5.5. Kinderarbeit am Anfang einer internationalen Handelskette - Der Weg eines indischen Teppichs
Der Teppichhandel in Indien liegt in den Händen von etwa 500 Exportagenturen und Zwischenhändlern, welche die im Mirzapur -Bhadohi - Gürtel konzentrierte Teppichproduktion auf der Basis von Heim- und Gelegenheitsarbeit organisieren.
Bei dem Weiterverkauf der fertigen Produkte gibt es einen heftigen Konkurrenzkampf, weil die Aufkäufer der europäischen und nordamerikanischen Handelsketten bei einem weltweiten Überangebot auf die Preise drücken können.
Die Handelsagenturen setzten die Zwischenhändler unter Druck, diese wiederum die Webstuhlbesitzer.
Bekanntlich trifft es immer die letzten am schwersten, und dies sind vor allem die Kinder, welche die Teppiche knüpfen. Denn die Unternehmer setzen etwa zur Hälfte Kinder an den Webstühlen ein. Dabei ist es egal, ob es sich im die eigenen oder fremde handelt, denn Kinder sind die billigeren Arbeitskräfte und ihre Hände sind beim Teppichknüpfen geschickter. Und diese Arbeit bedeutet für die Kinder eine äußerst geringe Entlohnung, gesundheitliche Schäden, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten und keinerlei Schulbildung. Bevor der fertige Teppich nun beispielsweise in ein deutsches Wohnzimmer gelangt, muss er einen weiten Weg zurücklegen, und an diesem Weg stehen viele, die mit an dem Teppich verdienen wollen...
5.6. Die Mitverantwortlichkeit des Endverbrauchers am weltweiten Geschäft mit der Kinderarbeit
Der deutsche Endverbraucher ist in vielfacher Weise Nutznießer der Kinderarbeit, ohne es überhaupt zu wissen:
- Kinderhände in Marokko knüpfen die in deutschen Wohnzimmern so beliebten Berberteppiche, die auch für spielende Kinder eine so weiche und bunte Unterlage bilden.
- Kinderhände in Indien weben preiswerte Teppiche für deutsche Kaufhäuser und ziehen Goldfäden in die original handgewebten Sari - Tücher.
- Kinderhände in Thailand schleifen Edelsteine, die dann in den Prospekten von Schleifereien in Pforzheim und Idar - Oberstein als „deutsche Wertarbeit zum Sonderpreis“ auftauchen.
- Deutsche Unternehmen nutzen das günstige Lohnniveau in den sogenannten Billiglohnländern. Auch wenn sie in ihren Zweigbetrieben nicht selbst Kinder beschäftigen, profitieren sie von dem durch Kinderarbeit gedrückten Lohnniveau.
- Deutsche Reiseunternehmen und Fluggesellschaften profitieren vom Sex - Tourismus in die Dritte Welt, den allenfalls die Angst vor Aids, aber nicht Moral einzudämmen vermag. Diese Tourismusform wird durch den Kinder - Sex besonders attraktiv und widerlich zugleich. Touristen verstärken die Nachfrage: Je jünger, desto besser!
- Kinderhände pflücken die Bananen, die Baumwolle, den Tee und Kaffee, also Südfrüchte und Kolonialwaren aller Art, die bei uns billiger wurden, weil unter dem Druck der Verschuldungskrise immer mehr Entwicklungsländer in das Geschäft eingestiegen sind oder -wieder mit Hilfe von Entwicklungshilfe - ihre Anbauflächen vergrößert haben, aber auch deshalb, weil die Produktions- und Arbeitskosten niedrig sind. Auch hier sind es wieder Kinder, welche die Arbeitskosten drücken helfen.
6. Resümee
Abschließend kann man also zusammenfassen, dass es sich bei dem Problem der Kinderarbeit in der Dritten Welt wohl um eines der zentralsten überhaupt handelt.
Meiner Meinung nach verdient deshalb diese Thematik besondere Beachtung. Vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass den Kinder durch Kinderarbeit die Chance auf das Lernen und damit auf Bildung genommen wird. Denn ein Kind, welches den ganzen Tag an verstaubten Webstühlen verbringt, hat keine Zeit die Schule zu besuchen.
Da aber Bildung wohl mittel- und langfristig gesehen die einzigste Möglichkeit für die Entwicklungsländer ist, sich aus eigener Kraft aus dem ewigen Teufelskreis der Arbeitslosigkeit und Armut zu befreien, denke ich, dass EL und IL zusammen versuchen sollten, eine Lösung zu finden, um das unschätzbare Potential durch Jugend und Bildung endlich nutzbar zu machen.
Quellenangabe
1. „Leitfragen Politik“: Horst Becker, Jürgen Feick, Herbert Uhl. Ernst Klett Verlag. 2. Auflage 1998.
2. „Nakosi - Mädchen in der Dritten Welt“ Ein Terre des Hommes Buch: Renate Giesleer, Hans - Martin Große Oetringhaus. Signalverlag, 1. Auflage.
3. „Kinderhände - Kinderarbeit in der Dritten Welt“ ein Terre des Hommes Buch: Franz Muschler, Hans - Martin Große Oetringhausen. Signalverlag, 1. Auflage.
4. „Handbuch Entwicklungsländer“: Autorenkollektiv. Verlag die Wirtschaft.
5. außerdem wurden noch zahlreiche Prospekte von UNICEF und Terre des Hommes verwendet
[...]
1 Abkürzung für Entwicklungsländer
2 BSP = alle in einem Jahr produzierten Güter und Dienstleistungen der Inländer im In- und Ausland
3 BIP = derjenige Teil der wirtschaftlichen Leistungen einer Volkswirtschaft, der während eines bestimmten Zeitraumes innerhalb der Landesgrenzen erbracht wird
4 Abkürzung für Industrieländer
5 Anbau eines oder einiger weniger landwirtschaftlicher Produkte ( z. B. Kaffee, Kakao )
6 Verwüstung
7 afrikanischer Stamm
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Situation in Entwicklungsländern, insbesondere mit Kinderarbeit. Sie definiert Begriffe wie "Dritte Welt" und "Entwicklungsländer", beschreibt Merkmale von Entwicklungsländern und diskutiert die Rechte von Kindern. Der Schwerpunkt liegt auf den Ursachen, Formen und Auswirkungen von Kinderarbeit in der Dritten Welt, sowie der Mitverantwortlichkeit der Konsumenten.
Wie werden Entwicklungsländer definiert?
Entwicklungsländer sind Länder, in denen ein Großteil der Bevölkerung unter armen Bedingungen lebt und die nicht an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der letzten Jahrzehnte teilgenommen haben. Oftmals haben sie ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen und weisen eine dualistische Wirtschaftsstruktur auf.
Welche Merkmale kennzeichnen Entwicklungsländer?
Entwicklungsländer sind durch ungünstige klimatische Bedingungen, ökonomische Probleme (niedriges Pro-Kopf-Einkommen, dualistische Wirtschaft, Kapitalmangel, hohe Schulden), demographische Merkmale (hohes Bevölkerungswachstum), soziale Probleme (wachsende soziale Kluft), ökologische Probleme (Desertifikation, Entwaldung), kulturelle Probleme (hohe Analphabetenquote) und politische Probleme (Korruption, Stammesfehden) gekennzeichnet.
Welche Kinderrechte werden in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit thematisiert die Kinderrechte auf Gleichheit, Gesundheit, Bildung, Spiel und Freizeit, freie Meinungsäußerung, gewaltfreie Erziehung, Schutz in Krieg und auf der Flucht, Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung, elterliche Fürsorge und Betreuung bei Behinderung.
Was sind die Ursachen für Kinderarbeit in der Dritten Welt?
Die Hauptursache für Kinderarbeit ist die Massenarmut. Arme Familien sind oft gezwungen, ihre Kinder zum Arbeiten zu schicken, um das Überleben der Familie zu sichern. Zudem spielen ungerechte Sozialstrukturen, politische Gewaltverhältnisse und die Entwicklungspolitik der Industrieländer eine Rolle.
Welche Formen von Kinderarbeit werden unterschieden?
Es werden verschiedene Formen von Kinderarbeit unterschieden: Arbeit im eigenen Haushalt (Feldarbeit, Tierhüten, Teppichherstellung), selbstständige Kinderarbeit (Schuhputzer, Zeitungsverkäufer, Betteln), lohnabhängige Kinderarbeit (Hausmädchen, Werkstätten, Kleinbetriebe) und Kinderarbeit im formellen Sektor (Bergwerke, Steinbrüche, Plantagen). Auch Kindersklaverei wird erwähnt.
Welche Rolle spielt der Konsument im Zusammenhang mit Kinderarbeit?
Der Endverbraucher in Industrieländern profitiert oft unwissentlich von Kinderarbeit, da viele Produkte (Teppiche, Textilien, Edelsteine, landwirtschaftliche Produkte) in Entwicklungsländern unter Ausbeutung von Kindern hergestellt werden. Der Konsument trägt somit eine Mitverantwortung und kann durch bewussten Konsum und Unterstützung von Initiativen gegen Kinderarbeit einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt vor, dass Entwicklungs- und Industrieländer zusammenarbeiten sollten, um das Problem der Kinderarbeit zu lösen. Bildung wird als langfristige Möglichkeit gesehen, um Kinder aus dem Teufelskreis der Armut zu befreien. Bewusster Konsum und die Unterstützung von Initiativen gegen Kinderarbeit durch Endverbraucher werden ebenfalls als wichtige Beiträge genannt.
- Citar trabajo
- Anja Repke (Autor), 2000, Kinder in der 3. Welt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98271