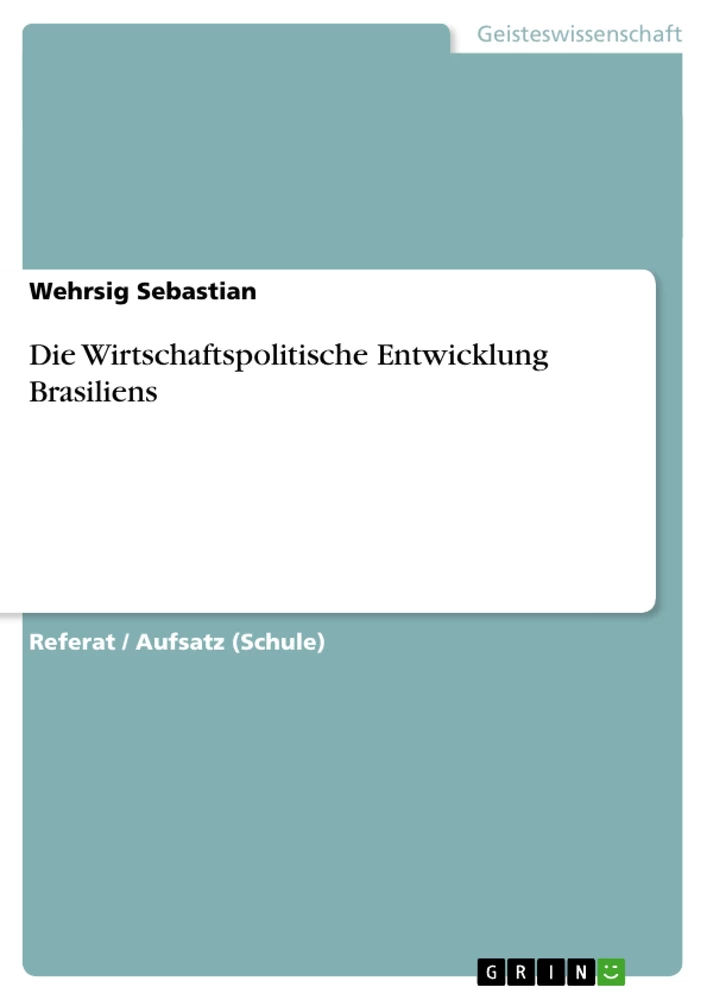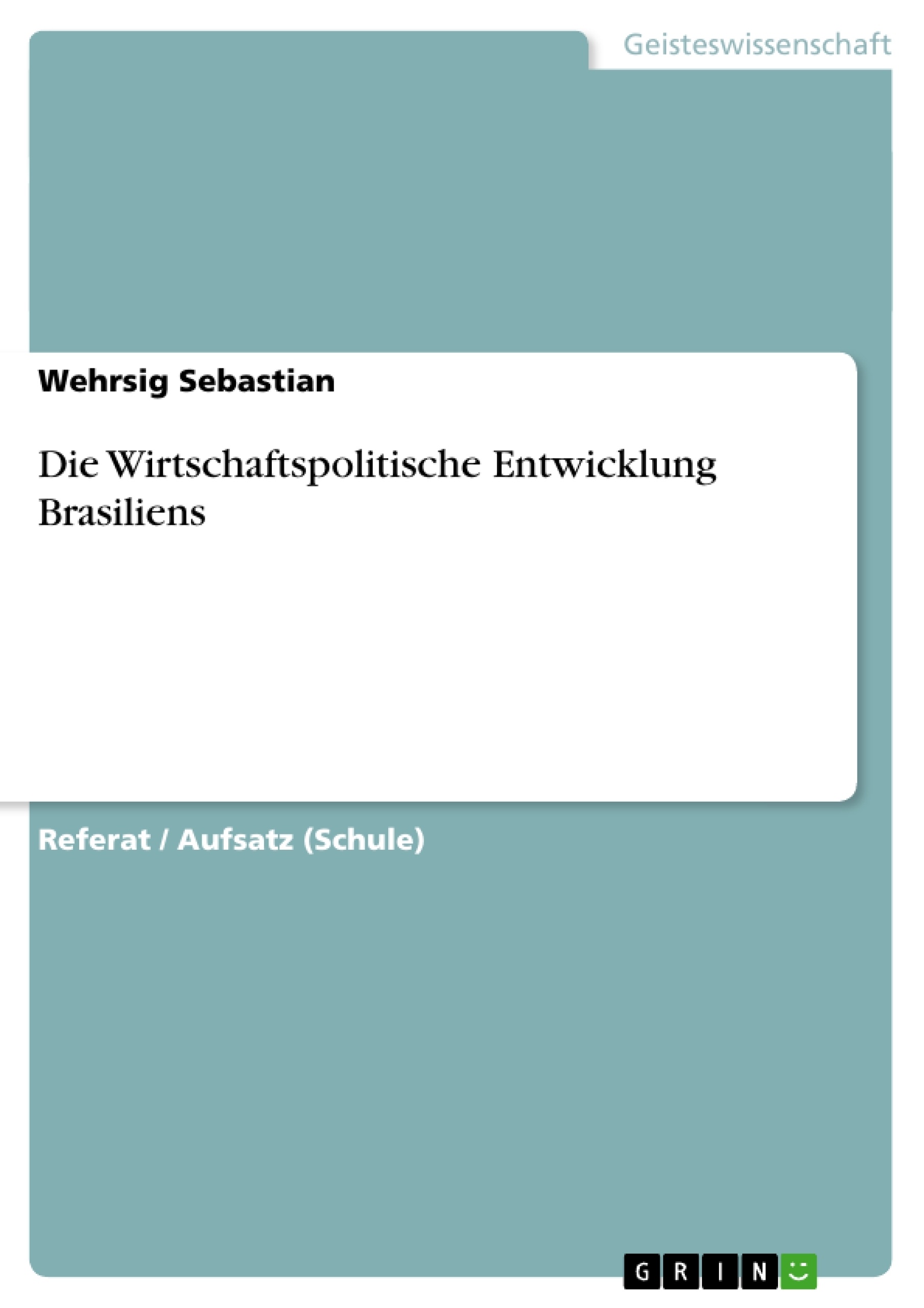Inhalt
Einführung
Die wirtschaftspolitische Entwicklung zwischen 1930 und 1998
Die Situation in den Jahren 1998 und 1999
Ziele für die zukünftige Entwicklung
Der ,,Plano Real"
Beurteilung der konjunkturellen Situation Brasiliens
Wirtschaftskennzahlen Brasiliens zwischen 1995 und 1999
Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens
Herangezogene Quellen
Einführung
Brasilien ist eines derjenigen Entwicklungsländer, denen innerhalb der letzten Jahrzehnte wiederholt zugetraut wurde, den Rückstand zu den Industrienationen aufzuholen. Insbesondere zur Zeit des ,,Milagro brasiliero", des brasilianischen Wirtschaftswunders zwischen 1965 und 1975, verlief der Aufschwung des größten Landes Lateinamerikas sehr positiv. Verbunden mit schweren Rückschlägen in den 80er Jahren, welche die enormen sozialen Kosten der brasilianischen Entwicklungspolitik offenbarten, wurde das bis dato als nachahmenswertes Modell geltende Land zum entwicklungspolitischen Problemfall. Erst Mitte der 90er Jahr gab es seitens der Regierung wieder erfolgreiche Bestrebungen, die industrielle Entwicklung voranzutreiben. Doch bereits Ende dieses Jahrzehntes sieht sich der aufstrebende brasilianische Markt erneut mit enormen wirtschaftlichen und sozialen Problemen konfrontiert.
Die wirtschaftspolitische Entwicklung zwischen 1930 und 1998
Vor den dreißiger Jahren war Brasilien durch Export von Rohstoffen und Import von Fertigwaren in den Weltmarkt integriert. Somit war das Land extrem abhängig von der Weltnachfrage nach brasilianischen Exportgütern, wie beispielsweise Kaffee. Mitte der dreißiger änderte sich die wirtschaftliche Einstellung und man begann mit dem Aufbau einer eigenen Industrie für einfache Konsumgüter; diese wurde vom Staat durch protektionistische Maßnahmen vor ausländischen Produkten geschützt (Importsubstitution). In den Fünfzigern wurde die bisherige Binnenmarktorientierung aufgegeben; Ziel war die Schaffung neuer Arbeitsplätze, was mit Hilfe ausländischen Kapitals sowie dem Export teurer Konsumgüter ( z.b. Autos) erreicht werden sollte.
Nach einem Militärputsch 1964 galt es nunmehr, einen modernen Industriestaat aufzubauen, hierbei stand die Förderung der Exportindustrie an erster Stelle. Nach Vorstellung der Machthaber sollte dies einen ,,trickle down"-Prozess (Durchsickerungsprozess) zur Folge haben, mit dem Ziel, den Wachstumsprozess auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen. Grundlage dafür bildete der Ausbau der Infrastruktur sowie die Anleihe von Auslandskrediten (>Verschuldung). Zudem wurde versucht ausländische Investoren zu gewinnen, indem man ihnen neben Steuersenkungen und Zollvergünstigungen auch die Senkung der Reallöhne sowie ein Streikverbot einräumte.
Die Zahlungsunfähigkeit Brasiliens 1982 ist zurückzuführen auf diverse Probleme seit Anfang der 70er Jahre. Ausschlaggebend hierbei waren: die Ölpreisexplosion, hohe USZinsen, sinkende Auslandsnachfrage und fallende Rohstoffpreise.
Nach Wiedereinführung der Demokratie 1985 machten sich weitere negative Folgeerscheinungen der Militärdiktatur bemerkbar. Weitreichendster Aspekt war sicherlich die hohe Auslandsverschuldung, doch auch die ungleiche Einkommensverteilung, hervorgerufen durch den nicht eingetretenen ,,trickle down"-Effekt, machten sich negativ bemerkbar. Des weiteren stellt die Landflucht, basierend auf der Vernachlässigung der ländlichen Entwicklung, ein massives Problem dar.
Letztendlich spiegeln sich die Auswirkungen des von den Diktatoren einseitig geförderten Wachstums der hochtechnologischen Industrie, insofern in der Folgezeit wider, als dass Grundbedürfnisse kaum befriedigt werden konnten, da die hierzu nötig Industrie vernachlässigt wurde.
Nachdem die Anfangsjahre der jungen Republik weitgehend ungenutzt blieben, kam es erst mit der Einführung des ,,Plano Real" (siehe auch Tabelle ,,Der Plano Real" Seite 4) unter Fernando Cardoso zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Brasiliens. Cardoso, Präsident seit 1994, hatte sich zum primären Ziel gesetzt, die Hyperinflation drastisch zu senken. Dies sollte erreicht werden, indem die hohen Einfuhrzölle gesenkt und somit eine Bindung zum Binnenmarkt wieder ermöglicht würde. Die Wirtschaftspolitik Cardosos stieß auf durchweg positive Resonanz, sowohl bei renommierten Wirtschaftsinstituten, als auch im eigenen Volk, welches dieses mit der Wiederwahl im Oktober 1998 honorierte. Aufgrund dieser positiven Einschätzung und der Bindung der neuen Währung (Real) an den US-Dollar, fühlten sich viele ausländische Firmen dazu veranlasst, auf dem brasilianischen Markt Kapital zu investieren.
Vor dem Hintergrund rasant ansteigender Arbeitslosenzahlen, einer Verdopplung des Staatsdefizits sowie einer zunehmend defizitären Handelsbilanz, die zu Diskussionen über die Stabilität des Reals und einer daraus resultierenden Kapitalflucht führte, zeichnete sich bereits vor den Präsidentschaftswahlen der Beginn einer neuen Krise ab. Diese negative Entwicklung wurde durch die Asienkrise im Spätsommer 1998 und die Russlandkrise deutlich verstärkt. Viele Ursachen für die finanzielle Misere werden heute als ,,hausgemacht" betrachtet, so zum Beispiel die deutlich verfrühte Öffnung zum Binnenmarkt, die zur Folge hatte, dass viele einheimische Betriebe zu Grunde gingen, weshalb Millionen Brasilianer ihren Arbeitsplatz verloren. Auch die ungleiche Besitzverteilung sowie die Abhängigkeit von ausländischem Kapital stellen ein schwerwiegendes Problem für Brasilien dar.
(Siehe auch ,,Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung" Seite 8)
Die Situation in den Jahren 1998 und 1999
Als Reaktion auf die, vor allem durch den massiven Kapitalabzug hervorgerufene Krise im Sommer 1998, wurde von Präsident Cardoso die Umsetzung tiefgreifender Reformen bei Renten, Steuern und in der Verwaltung vorangetrieben, die das Staatsdefizit senken und die Abhängigkeit von ausländischem Kapital reduzieren sollten. Trotz der schnellen Reaktion, konnte ein massiver Kapitalabfluss nicht verhindert werden und Brasilien war auf die Unterstützung des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen.
Im Januar 1999 zeichneten sich neuerliche Probleme ab: Als die brasilianischen Bundesstaaten Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Zentralregieung nicht nachzukommen drohten, geriet der Real unter starken Druck. Die Regierung beschloss daraufhin die strikte Wechselkurskontrolle zu lockern und den Real freizugeben. Außerdem wurden die Zinsen drastisch erhöht, um neues Kapital ins Land zu ziehen und die Inflationsgefahr zu bannen. Diese Maßnahmen brachten auch die Stabilisierung des Reals mit sich.
Im Verlauf des Jahrs 1999 entwickelte sich die brasilianische Wirtschaft entgegen den pessimistischen Vorrausagen positiv. Neben dem Rückgang der Rezession konnte nur geringer Rückgang des Bruttoinlandproduktes von 1% und eine Inflationsrate von 8% verzeichnet werden. Auch das Leistungsbilanzdefizit fiel gegenüber dem Vorjahr mit über 20 Milliarden Dollar deutlich niedriger aus.
(Siehe ,,die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens zwischen 1995 und 1999" Seite 7)
Ziele für die zukünftige Entwicklung
Im Mittelpunkt der Bemühungen der brasilianischen Regierung stehen im Jahr 2000, die Forcierung der wirtschaftlichen Erholung und auf dieser Grundlage das Vorantreiben sozialer Verbesserungen im Bereich des Arbeitsmarktes, der Bildung, der Gesundheit und der sozialen Sicherheit. Die Durchsetzung dieser Reformen stellt sich insofern als problematisch dar, als dass gleichzeitig ein strikter Sparkurs weitergeführt werden muss; da nur ausgeglichene öffentliche Haushalte, als Vorraussetzung für wirtschaftliche Stabilität, das Vertrauen ausländischer Investoren stärken, die wiederum das nötige Kapital für Investitionen auch im Sozialbereich mit sich bringen.
Neben dem Erfolg des Reformprogramms der Regierung hängt die weitere Entwicklung des lateinamerikanischen Landes auch von der weltwirtschaftlichen Lage ab und in wie weit brasilianischen Exporten Zugang zu den internationalen Märkten gewährt wird. Dies könnte über eine Liberalisierung der Agrarmärkte, vor allem des europäischen, geschehen. Für den Zeitraum zwischen 2000 und 2003 hat die brasilianische Regierung ein Wirtschaftsprogramm unter dem Motto ,,Avanca Brasil", in dessen Mittelpunkt Entwicklungen im sozialen Bereich, Infrastrukturmaßnahmen und eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Produktivsektors stehen, angestrebt. Durch das R$ 100 Milliarden schwere Reformprogramm erhofft sich der Staat die Schaffung von rund 8 Millionen Arbeitsplätzen, ein deutlich über 4% liegendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitigem Rückgang des öffentlichen Defizits unter 3% des Bruttoinlandproduktes und eine jährliche Inflationsrate, die geringer als 2,5% ist.
Der Plano Real
- Währungsreform: Der Real wurde am 1.7.1994 als neue Währung im Verhältnis eins zu eins zum Dollar eingeführt.
- Zollabbau: Liberalisierung des Binnenmarktes durch Senkung der Importzölle. Bisher war der brasilianische Markt weithin vor ausländischer Konkurrenz abgeschottet.
- Haushaltskonsolidierung : Kürzung der Staatsausgaben mit dem Ziel, den Staatshaushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.
- Privatisierung: Die oft ineffizient arbeitenden Staatsunternehmen -auch in den staatlichen Monopolbereichen Bergbau, Energie und Telekommunikation- sollten rasch international zum Verkauf angeboten werden.
- Investitionen: Bewerbungsmöglichkeit ausländischer Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen
- Mittelfristige Reformen: Kostensparende Sozialversicherungs-, Steuer- und Verwaltungsreform.
(nach: dpa 06.09.1994, AP 07.09.1994, dpa 08.10.1994, dpa 05.02.1995)
Beurteilung der konjunkturellen Situation Brasiliens
Konjunktur in Brasilien floriert
Skeptiker sehen Risiken / Reformkurs stößt auf Widerstand
rey BRASILIA. Brasiliens Wirtschaft kommt allmählich wieder in Schwung.
Rund anderthalb Jahre nach der riesigen Abwertung scheint sich die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas von dem Schlag zu erholen. Verschiedene Daten stützen indes den Verdacht, dass der Gigant noch nicht auf sicheren Beinen steht. Anlass zur Sorge gibt zur Zeit vor allem ein plötzlicher Anstieg der Teuerungsrate.
Die Händler atmen in São Paulo und anderen Städten des Landes auf. Ihre Verbände berichten von zehn Prozent mehr Umsatz im ersten Halbjahr. Die Kauflust erfasst inzwischen weite Teile der Bevölkerung, dabei steigt vor allem die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern. Fernsehgeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke, Gasherde und kleine Autos gehen mancherorts wieder weg wie frische Semmeln.
Die Industrieproduktion kommt generell wieder auf Touren. Die Landwirtschaft boomt sogar. Das Kreditgewerbe verzeichnet - dank immer noch horrend hoher Zinsen - ohnehin seit mehreren Jahren Rekordgewinne. Insgesamt hat die Produktion von Gütern und Dienstleistungen seit Januar um 3,8 Prozent zugenommen. Der Aufschwung führt auch zu einem langsamen Abbau der Arbeitslosigkeit und verstärkt damit die Tendenz zu erhöhtem Konsum.
Die Regierung des Soziologen Fernando Henrique Cardoso hat es entgegen der Prognosen fast aller Experten verstanden, Brasilien vor dem Abgleiten in die Rezession zu bewahren. Nur vorübergehend schrumpfte die gesamtwirtschaftliche Leistung im vorigen Jahr. Gelungen ist es auch, das Haushaltsdefizit etwa in dem Rahmen zu halten, der mit dem Internationalen Währungsfonds vereinbart worden ist, und den Wechselkurs des Real zum US-Dollar bei etwa 1,80 zu stabilisieren.
Doch an diesem Punkt haken die Skeptiker ein. Der Real lässt sich offensichtlich nur mit Hilfe ständiger Stützungskäufe der Zentralbank vor einer Abwertung bewahren. Die Devisenreserven schmelzen trotz des massiven Zustroms ausländischer Investitionsmittel jeden Monat um etwa eine Milliarde Dollar und betragen gegenwärtig gerade noch 30 Milliarden. Dabei lassen die Zahlen des Außenhandels klar erkennen, dass die lokale Währung bei einem Kurs von 1,80 Real zum US-Dollar überbewertet ist. Auch dieses Jahr wird
Brasilien demzufolge das Ziel eines größeren Überschusses in der Handelsbilanz erneut verfehlen. Die Exporte von Eisenerz, Stahl, Aluminium, Sojaöl und Zellstoff fallen durchweg niedriger aus als geplant.
Warnlampen leuchten indes auch in der Teuerungsstatistik auf. Im Juli sind die Verbraucherpreise um rund zwei Prozent geklettert - ein Sprung, der das Ziel einer Inflation von sechs Prozent im laufenden Jahr gefährdet und den wichtigsten "Anker" bei der Sanierung der Finanzen auszureißen droht. Außerdem nähren politische Faktoren Zweifel, ob die geplanten Strukturreformen tatsächlich umgesetzt werden. "Es ist fraglich, ob Brasiliens Geld- und Steuerpolitik unter den herrschenden Bedingungen genügend lange durchgehalten werden kann", meint der frühere Zentralbankpräsident Carlos Langoni. Zu den Unwägbarkeiten zählt er die Standfestigkeit der Notenbank und den Widerstand im Parlament gegen Korrekturen der Steuer- und Sozialgesetze.
(aus: Frankfurter Rundschau vom 25.08.2000)
Wirtschaftskennzahlen Brasiliens zwischen 1995 und 1999
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(aus: http://www.brasilien.de , Copyright K.K. Naumann 1999/2000) Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Zusammengestellt aus: Lateinamerika Jahrbuch 1997, Hrsg. Klaus Bodemer, Verveurt Verlag Frankfurt/Main 1997, S. 169-171; FAZ vom 29.12.1997; World Development Report 1998/99, S.198)
Herangezogene Quellen:
- Mensch und Politik S II, Friedenserhaltung Friedenstgestaltung
- http://www.brasilien.de
- dpa
- Frankfurter Rundschau
- Lateinamerika Jahrbuch 1997
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments über Brasilien?
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die wirtschaftspolitische Entwicklung Brasiliens von 1930 bis 1999, einschließlich der Herausforderungen, Ziele und Reformen, die das Land erlebt hat.
Welche wichtigen wirtschaftlichen Ereignisse werden in dem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Zeit vor den 1930er Jahren, die durch Rohstoffexporte und Fertigwarenimporte gekennzeichnet war, die Importsubstitution in den 1930er Jahren, das brasilianische Wirtschaftswunder ("Milagro brasiliero") zwischen 1965 und 1975, die Schuldenkrise in den 1980er Jahren, die Einführung des "Plano Real" in den 1990er Jahren und die wirtschaftliche Krise Ende der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Asienkrise und der Russlandkrise.
Was war der "Plano Real" und welche Ziele wurden damit verfolgt?
Der "Plano Real" war ein wirtschaftlicher Stabilisierungsplan, der 1994 unter Präsident Fernando Cardoso eingeführt wurde. Zu den Hauptzielen gehörten die Senkung der Hyperinflation, die Liberalisierung des Binnenmarktes durch Senkung der Importzölle, die Haushaltskonsolidierung, die Privatisierung staatlicher Unternehmen und die Förderung ausländischer Investitionen.
Welche Probleme und Herausforderungen werden für die brasilianische Wirtschaft identifiziert?
Das Dokument identifiziert mehrere Probleme, darunter eine hohe Auslandsverschuldung, eine ungleiche Einkommensverteilung, Landflucht, Abhängigkeit von ausländischem Kapital, Arbeitslosigkeit und ein Staatsdefizit.
Welche Ziele verfolgt die brasilianische Regierung für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung?
Die brasilianische Regierung konzentriert sich auf die Forcierung der wirtschaftlichen Erholung, die Verbesserung des Arbeitsmarktes, der Bildung, der Gesundheit und der sozialen Sicherheit. Ziel ist es auch, das Vertrauen ausländischer Investoren durch einen strikten Sparkurs und ausgeglichene öffentliche Haushalte zu stärken.
Was ist "Avanca Brasil"?
„Avanca Brasil“ ist ein Wirtschaftsprogramm der brasilianischen Regierung für den Zeitraum 2000-2003, das sich auf Entwicklungen im sozialen Bereich, Infrastrukturmaßnahmen und eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Produktivsektors konzentriert. Das Programm zielt auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, ein Wirtschaftswachstum von über 4%, einen Rückgang des öffentlichen Defizits unter 3% des Bruttoinlandproduktes und eine jährliche Inflationsrate von unter 2,5% ab.
Welche Quellen werden in dem Dokument genannt?
Das Dokument nennt unter anderem "Mensch und Politik S II", http://www.brasilien.de, dpa, Frankfurter Rundschau, Lateinamerika Jahrbuch 1997, Frankfurter Allgemeine Zeitung und World Development Report 1998/1999 als Quellen.
- Quote paper
- Wehrsig Sebastian (Author), 2000, Die Wirtschaftspolitische Entwicklung Brasiliens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98269