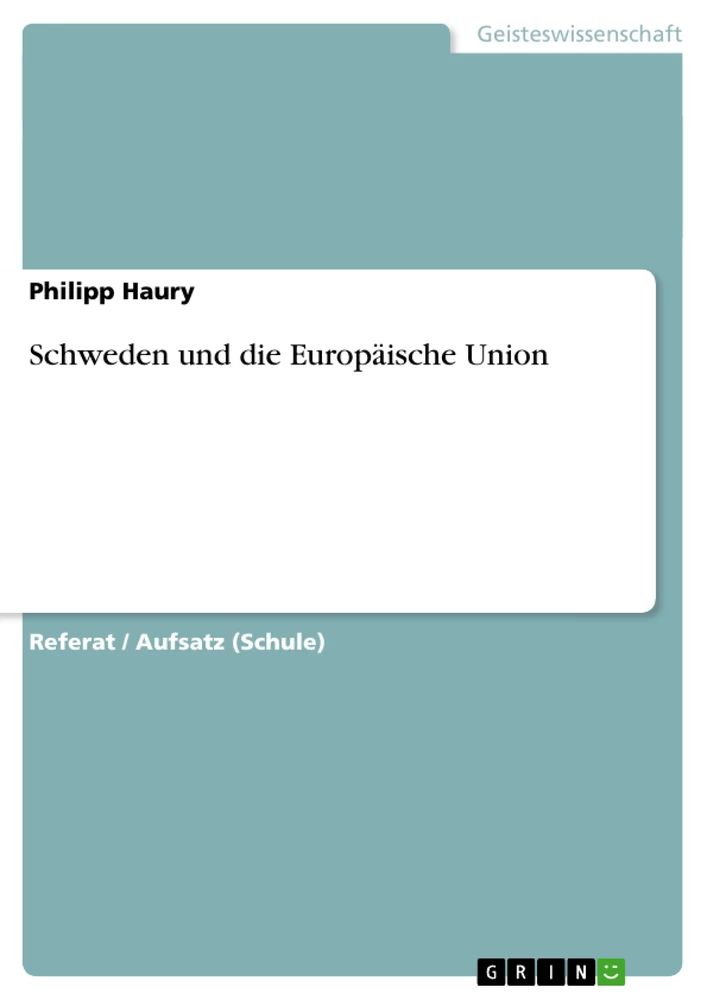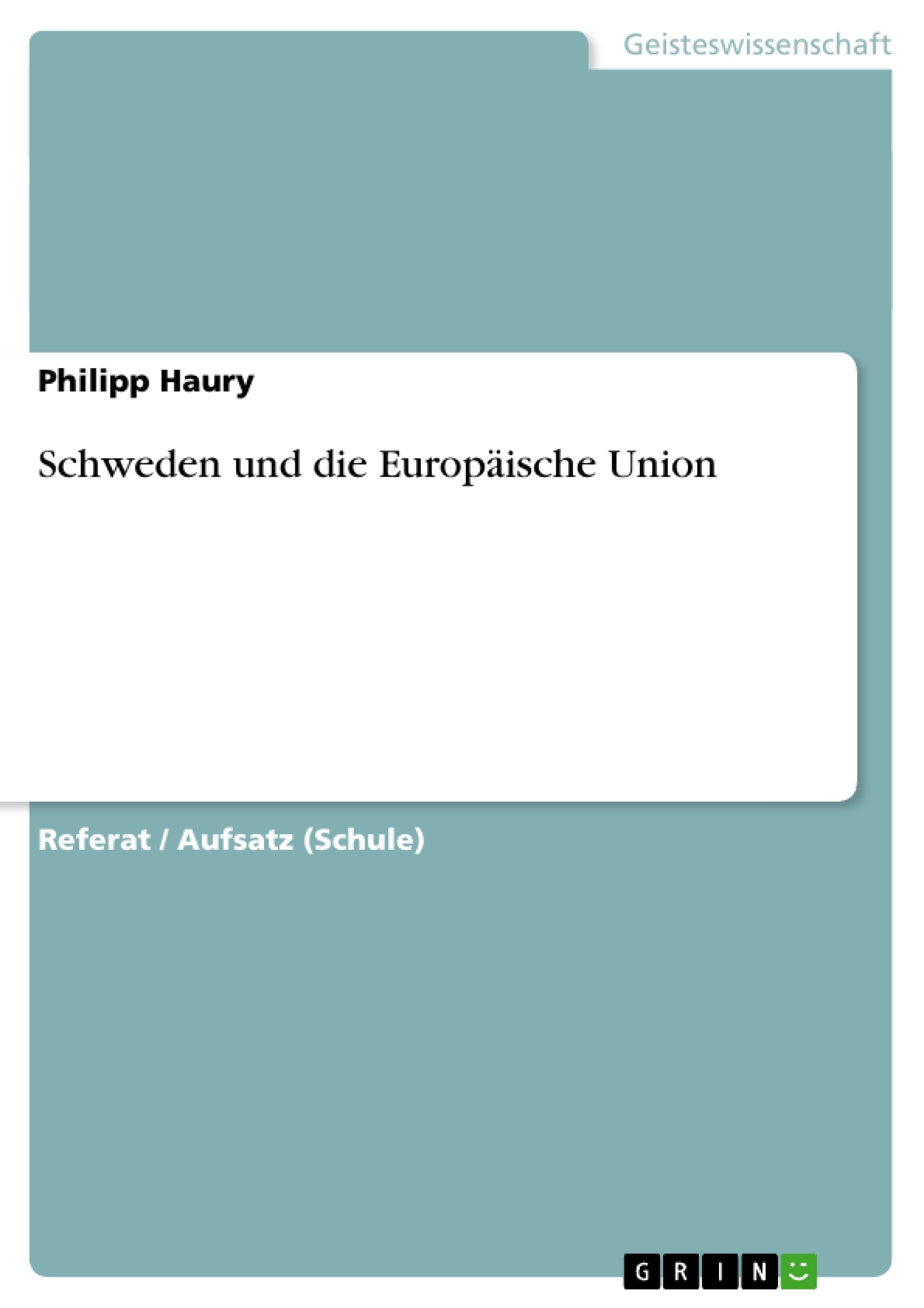Inhalt
1. Daten
2. Wirtschaft
3. Geschichte Schwedens
4. Schweden und Europa
1. Daten
- Größe: 449.964 km² (fünftgrößtes Land Europas)
- Hauptstadt: Stockholm, Großraum 1,6 Mio Einwohner
- Bevölkerung: ca. 8.860.000 Einwohner
- Minderheiten: 30.000 Finnischsprachige im Nordosten entlang der finnischen Grenze und 17.000 Lappen (Samen) in Nordschweden
- Ausländer und Auslandsstämmige (1. Einwanderergeneration): ca. 1.061.000 (12 % von Gesamtbevölkerung); größter Anteil aus FIN 225.000, JUG 76.000, BOS 54.000, Iran 52.000, N 50.000, PL 42.000, D 41.000, Irak 41.000, TR 36.000, aus Afrika 56.000, davon 15.000 aus Somalia; aus Südamerika 50.000, davon 27.000 aus Chile
- Landessprache: Schwedisch
- Religion: 88 % Protestanten (Lutheraner), sonst Katholiken, Mohammedaner, Juden, Orthodoxe
- Unabhängigkeit: seit dem 16. Jahrhundert
- Staatsform: Parlamentarische Demokratie; König als Staatsoberhaupt Zentralistischer Staatsaufbau
- Staatsoberhaupt: Seine Majestät König Carl XVI.Gustaf, seit 1973. Vertreter Prinzessin Victoria (Thronfolgerin)
- Regierungsparteien: Sozialdemokratische Arbeiterpartei; stellte seit dem Krieg mit Ausnahme der Zeit von 1976 bis 1982 und von 1991 bis 1994 alle Regierungen. Im Oktober 1998 bildeten sie erneut eine Minderheitsregierung. Formelle Zusammenarbeitsabsprachen wurden mit Grünen und Linkspartei getroffen. Linkspartei Umweltpartei/Grüne
Opposition: Moderate Sammlungspartei, Zentrumspartei, Volkspartei, Christdemokraten
Gewerkschaften: Organisationsgrad 85%. Größte Gewerkschaften LO (Dachverband der Arbeitergewerkschaften)
- Verwaltungsstruktur: Zentralverwaltung, Selbstverwaltung der 21 Bezirke/Provinzen und Kommunen mit eigener Steuerhoheit
- Mitgliedschaften in internationalen Organisationen: Gründungsmitglied bei Europarat, Mitglied bei EU, VN, VN-Sonderorganisationen, OECD, OSZE, ESA, keine NATOMitgliedschaft, nur Beobachter bei WEU
2. Wirtschaft
Bei nur 8,8 Mio. Einwohnern ist der Binnenmarkt begrenzt. Schwedens Wirtschaft ist stark exportorientiert. Die wichtigsten Industriezweige sind Metall- und metallverarbeitende Produktion, Holzverarbeitung, chemische, pharmazeutische und Textilindustrie.
Seit 1995 ist Schweden EU-Mitglied, erfüllt auch die Kriterien des Maastrichter Vertrages, will jedoch - wie Großbritannien - 1999 noch nicht an der Währungsunion teilnehmen.
BIP: 1.738,9 Mrd. skr = 229,5 Mrd. US$. Zuwachsrate 1,8 %.
BIP/Kopf: 150.258 skr = 19.831 US$. Anteil am BIP (1994): Landwirtschaft 2,0 %, Industrie 28 %, Dienstleistungen 71 %.
Arbeitslosigkeit: 10,2 %.
Inflationsrate: 0,9 %.
Staatseinnahmen: 1.076 Mrd. skr = 138,67 Mrd. US$.
Staatsausgaben: 1.121 Mrd. skr = 144,47 Mrd. US$.
Zahlungsbilanz: 40,553 Mrd. skr = 5,892 Mrd. US$.
Auslandsverbindlichkeiten: 352,787 Mrd. US$.
Auslandsvermögen: 248,58 Mrd. US$.
Devisenreserven: 10,824 Mrd. US$. Innerhalb der EU zählt Schweden zu den Geberländern und zahlte per Saldo 1,137 Mrd. Ecu = 2,247 Mrd. DM mehr in die Kassen der Gemeinschaft, als es von der EU erhielt. Auch bei der Entwicklungshilfe gehört Schweden mit Gesamtleistungen von 1,672 Mrd. US$ zu den Geberländern.
Ausländische Direktinvestitionen: 5,492 Mrd. US$.
Energie: Der Energiebedarf wird hauptsächlich durch Kernkraft (47 %, 12 Reaktoren) und Wasserkraft (34 %) gedeckt. Nach einem Referendum von 1980 ist der Ausstieg aus der Kernenergie bis 2010 geplant. Die erste Abschaltung eines Reaktors sollte 1998 erfolgen, was jedoch am Widerstand der Industrie scheiterte.
Landwirtschaft: Obwohl nur ein kleiner Teil des Landes landwirtschaftlich genutzt wird, kann Schweden rund 80 % des Nahrungsmittelbedarfs selbst decken.
Landwirtschaftliche Nutzfläche: 8 % der Landesfläche, von der Anbaufläche bewässert: 3,1 %. Bewaldete Fläche 244.000 km2, jährliche Rodung 24 km2.
Industrie: Nach leichten Produktionsrückgängen Ende der 80er Jahre kam 1994 die Wende, die Produktion stieg um über 10 %. Dieser Trend setzte sich in den Folgejahren fort.
Rohstoffe: Eisenerz, Kupfererz, Zink und Blei, große Uranlager vor allem in Mittelschweden (15 % des weltweiten Vorkommens).
Außenwirtschaft:
Handelsbilanz: 132 Mrd. skr = 17,28 Mrd. US$. Export: 631,56 Mrd. skr = 82,68 Mrd. US$.
Hauptausfuhrprodukte (1995): Maschinen und Transportmittel (46 %), industrielle Vorprodukte (24 %), Chemikalien (9 %). Hauptausfuhrländer sind Deutschland (13 %), Großbritannien (9 %), Norwegen (8 %). Import: 499,56 Mrd. skr = 65,40 Mrd. US$, vor allem Maschinen und Transportmittel (41 %), industrielle Vorprodukte (17 %), Fertigwaren (14 %). Hauptlieferländer sind Deutschland (20 %), Großbritannien (9 %) und Norwegen (7 %).
3. Geschichte Schwedens
Schwedische Geschichte
Vor 14 000 Jahren war das gesamte heutige Schweden von Eis bedeckt. Als sich das Inlandeis allmählich zurückzog, rückten die Menschen nach, und die älteste bekannte Siedlung, die im südlichen Schweden gefunden wurde, stammt aus der Zeit um 10 000 v.Chr. Von 8000 bis 6000 v.Chr. wurde das ganze Land nach und nach von Stämmen besiedelt, die von Jagd und Fischfang lebten und einfache Geräte aus Stein benutzten. Die Steinzeit, in der die Geräte verfeinert wurden und aus der sich Siedlungen und Gräber in immer größerer Anzahl erhalten haben, wurde um 1800 v.Chr. im Norden von der Bronzezeit abgelöst, die sich bis 500 v.Chr. erstreckte. Ihr Name leitet sich von den Waffen und Kultgegenständen ab, die für die Funde aus dieser Periode charakteristisch sind, auch wenn die Steingeräte weiterhin das tägliche Leben prägten. Im Norden — vor allem in Dänemark, aber auch in Schweden — ist die Bronzezeit von einer hochstehenden Kultur gekennzeichnet, die u.a. reiche Grabfunde hinterlassen hat. Ab ca. 500 v.Chr. nehmen die Funde ab, während gleichzeitig das Eisen allgemein in Gebrauch kommt. Während der älteren Eisenzeit (500 v.Chr.-400 n.Chr.), der Völkerwanderungszeit (400-550) und der sich anschließenden Vendelzeit (550-800), so benannt nach den prächtigen Bootgräbern in Vendel in Uppland, wurde die Bevölkerung in Schweden endgültig seßhaft, und der Ackerbau bildete danach die Grundlage für Wirtschaftsform und Gesellschaft.
Wikingerzeit und Christianisierung
Die Wikingerzeit (800-1050) ist von einer starken Expansion geprägt. Von Schweden aus gingen die Wikingerzüge vor allem nach Osten. In einer Mischung aus Raubzügen und Handelsexpeditionen entlang der Ostseeküsten und Flüsse fuhren die schwedischen Wikinger bis weit in das heutige Rußland hinein, wo sie Handelsstationen und kurzlebige Reiche, wie das Ruriks in Nowgorod, gründeten, und weiter bis zum Schwarzen und zum Kaspischen Meer, wo sie Handelsverbindungen mit Byzanz und der arabischen Welt errichteten. Gleichzeitig erreichte Schweden die christliche Mission mit dem Mönch Ansgar, der im 9. Jahrhundert aus dem Frankenreich kam. Doch erst im 11. Jahrhundert wurde Schweden christianisiert, wobei sich das Heidentum mit der alten nordischen Götterlehre bis weit in das 12. Jahrhundert hielt. Erst im Jahr 1164 erhielt Schweden einen eigenen Erzbischof. Die Expansion nach Osten während des 12. und 13. Jahrhunderts führte dazu, daß Finnland nach mehreren Kreuzzügen dem schwedischen Reich einverleibt wurde.
Die Gründung des Königreichs
Die früher selbständigen Landschaften gingen um das Jahr 1000 in einer neuen Einheit auf, deren Schwerpunkt einerseits in Väster- und Östergötland, andererseits in den Mälarprovinzen mit Uppland im Zentrum lag. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts tobte der Kampf um die weltliche Macht in diesem Reich zwischen den Geschlechtern Sverkers und Eriks, die zwischen 1160 und 1250 abwechselnd die Königsmacht innehatten. Noch zu dieser Zeit waren die einzelnen Landschaften jedoch die administrativen Einheiten mit eigenem Thing, Rechtskundigen und Gesetzen. Erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gewann der König verstärkten Einfluß und konnte mit dem Bau königlicher Burgen und der Einführung der Provinzialverwaltung die Interessen der Zentralmacht ernsthaft geltend machen und für das ganze Reich gültige Gesetze und Verordnungen durchsetzen. Im Jahr 1280 erließ Magnus Ladulås (1275-90) ein Dekret, das die Entstehung eines weltlichen Adelsstandes sowie die Organisation der Gesellschaft nach feudalem Muster ermöglichte. Dem König zur Seite trat ein Rat mit Vertretern der Aristokratie und der Kirche. Während der Regierungszeit von Magnus Eriksson (1319-64) wurden die einzelnen Landschaftsgesetze 1350 von einem im ganzen Reich geltenden Landesgesetz abgelöst.
Die Hansezeit
Im 14. Jahrhundert wuchs der Handel vor allem mit den deutschen Städten, die sich unter der Führung Lübecks in der Hanse zusammengeschlossen hatten. Während der folgenden 200 Jahre, bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts, beherrschte die Hanse den Handel in Schweden, in dessen Gefolge eine große Anzahl von Städten gegründet wurde. Die Landwirtschaft, die weiterhin die Grundlage des ökonomischen Lebens bildete, entwickelte sich gleichzeitig durch die Einführung der Dreifelderwirtschaft sowie verbesserte Arbeitsgeräte. Die Pest, die Schweden 1350 erreichte, führte allerdings zu einer langandauernden wirtschaftlichen Depression mit einem starken Bevölkerungsrückgang und vielen entvölkerten Höfen. Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts war die Krise endgültig überwunden, zu einer Zeit, als die Eisenhütten in Mittelschweden eine immer größere Rolle für die Wirtschaft des Landes zu spielen begannen.
Die Kalmarer Union
Im Jahr 1389 wurde die Königsmacht in Dänemark, Norwegen und Schweden durch Erbschaften und Heiraten in einer Hand unter der Regentschaft der dänischen Königin Margarete vereinigt. Unter ihrer Führung wurde 1397 ein Bund geschlossen, die sog. Kalmarer Union, in der die drei skandinavischen Länder denselben König anerkannten. Die gesamte Unionszeit von 1397 bis 1521 war jedoch von Kämpfen zwischen königlicher Zentralmacht und Hochadel sowie zeitweilig aufständischen Bauern und Bürgern gekennzeichnet. Die Konflikte, die mit den Bestrebungen verknüpft waren, die nationale Einheit Schwedens und seine an die Hanse gekoppelten wirtschaftlichen Interessen zu sichern, mündeten in das Stockholmer Blutbad von 1520, bei dem der dänische Unionskönig Christian II. mehr als 80 der führenden schwedischen Männer hinrichten ließ. Darauf brach ein Aufstand aus, der 1521 zur Absetzung Christians II. und zur Machtergreifung durch den schwedischen Adligen Gustav Wasa führte, welcher 1523 zum schwedischen König gewählt wurde.
Die Wasazeit
Unter der Regierung von Gustav Wasa (1523-60) wurden die Grundlagen des schwedischen Nationalstaats gelegt. Die Kirche wurde nationalisiert, ihre Güter verstaatlicht und sukzessiv die protestantische Reformation durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung nach deutschem Vorbild organisiert und die Macht auf den König konzentriert. Statt der bis dahin geltenden Wahlmonarchie, bei der die Aristokratie bei jedem Thronwechsel ihren Einfluß geltend machen konnte, wurde in Schweden 1544 die Erblichkeit der Königsmacht durchgesetzt. Trotz der Versuche des Hochadels, die Macht des Reichsrates unter den Regierungen von Erik XIV. (1560-68), Johan III. (1568-92) und Sigismund (1592-99) wiederherzustellen, behielt der König seine Stellung und stärkte sie weiter unter den Regierungen von Karl IX. (1599-1611) und Gustav II. Adolf (1611-32). Nach dem Tod Gustav II. Adolfs in der Schlacht bei Lützen im Jahr 1632 gelang es dem Hochadel, 1634 eine neue Regierungsform durchzusetzen, die die Macht den gleichzeitig eingerichteten zentralen Verwaltungsbehörden übertrug. Allerdings blieb diese Regierungsform an die Vormundschaftsregierungen geknüpft — zunächst während der Unmündigkeit von Königin Kristina und später von Karl XI. — und wurde ganz außer Kraft gesetzt, als König Karl XI. 1680 eine umfassende Reduktion der Güter des Adels durchführte und ihn so endgültig in einen Beamtenadel verwandelte, der in allen Belangen dem König unterstand.
Von der Großmachtpolitik zur Neutralität
Außenpolitisch hatte Schweden seit dem Bruch der Union mit Dänemark und Norwegen darauf hingearbeitet, die Vorherrschaft im Ostseeraum zu erlangen. Daraus ergaben sich seit den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts wiederholt Kriege mit Dänemark. Nachdem Schweden 1630 mit großem Erfolg auf seiten der Protestanten in den Dreißigjährigen Krieg eingegriffen hatte und Gustav II. Adolf zu einem der führenden Monarchen in Europa geworden war, wurde Dänemark in zwei Kriegen 1643- 45 und 1657-58 besiegt, wodurch Skåne, Halland, Blekinge und die Insel Gotland, die früher zu Dänemark gehört hatten, an Schweden fielen und es außerdem Bohuslän, Jämtland und Härjedalen von Norwegen erhielt. Da Schweden auch Finnland sowie eine Reihe von Provinzen im Baltikum und Datum: 20.10.’00 4 GM-Referat: „Schweden und die EU“ P.Haury in Norddeutschland umfaßte, war es damit nach dem Westfälischen Frieden von 1648 und dem Frieden mit Dänemark in Roskilde 1658 zur führenden Großmacht im nördlichen Europa geworden. Schweden fehlte es allerdings an der Wirtschaftskraft, um seine Stellung als Großmacht auf die Dauer behaupten zu können, da es mit Ausnahme einiger weniger Eisenhütten und der Kupfergrube in Falun ein reines Agrarland mit ausgeprägter Naturalwirtschaft war. Nach den Niederlagen im Großen Nordischen Krieg (1700-21) gegen Dänemark, Polen und Rußland verlor Schweden den größten Teil seiner Provinzen jenseits der Ostsee und wurde weitgehend auf die Gebiete des heutigen Schweden und Finnland reduziert. Während der Napoleonischen Kriege gingen schließlich Finnland (an Rußland) sowie die letzten Besitzungen in Norddeutschland (Vorpommern mit Rügen) verloren. Als Ersatz für diese Verluste gelang es dem 1810 gewählten Thronfolger und späteren König Karl XIV. Johan, Norwegen zu erwerben, das 1814 zu einer Union mit Schweden gezwungen wurde. Trotz vieler innerer Konflikte hielt diese Union bis ins Jahr 1905, als sie in friedlichen Formen wieder aufgelöst wurde. Seit einer kurzen militärischen Auseinandersetzung mit Norwegen im Zusammenhang mit der Entstehung der Union 1814 hat Schweden an keinem Krieg mehr teilgenommen und seit dem Ersten Weltkrieg die dezidierte außenpolitische Linie verfolgt, im Frieden allianzfrei und im Krieg neutral zu bleiben, wobei es seine Sicherheit auf eine starke Gesamtverteidigung außerhalb der Bündnisse gründete. Gleichzeitig schloß sich Schweden allerdings 1920 dem Völkerbund und 1946 den Vereinten Nationen an und hat sich unter dem Dach dieser Organisationen an verschiedenen internationalen Aktionen zur Sicherung des Friedens beteiligt.
Das Ende des Kalten Krieges und der politischen Teilung Europas hat neue Perspektiven für die schwedische Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen — und neue Möglichkeiten für Schweden, am Prozeß der westeuropäischen Integration teilzunehmen. Im Juli 1991 beantragte Schweden auch die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft und trat nach einer Volksabstimmung im November 1994 zum 1. Januar 1995 der Europäischen Union (EU) bei. Schweden zog es vor, sich der Währungsunion der EU (EMU), die am 1. Januar 1999 in Kraft trat, nicht anzuschließen. Möglicherweise wird es jedoch nach einer neuen Volksabstimmung oder einer Reichstagswahl, bei der die EMU eines der Hauptthemen sein wird, später der Währungsunion beitreten. Was die Verteidigung anbelangt, bestätigte die Regierung ebenfalls Anfang 1999 die schwedische Politik der Bündnisfreiheit.
4. Schweden und Europa
Schweden hat seine Bewerbung um die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft im Juli 1991 formell eingereicht. Ein erster Schritt hin zum Beitritt war durch das Übereinkommen über den europäischen Wirtschaftsraum EWR gemacht worden, durch das der Binnenmarkt der Gemeinschaft auf die meisten EFTA-Staaten ausgeweitet wurde. In einer Volksabstimmung über den Beitritt Schwedens zur Europäischen Union im November 1994 sprachen sich die Schweden für die Mitgliedschaft aus (52,3% dafür und 46,8% dagegen).
Der Beitritt Schwedens zur Europäischen Union hat keine (direkten) Auswirkungen auf die schwedischen Vorschriften zum Sozialschutz, denn die Vorschriften des Vertrages zur Sozialpolitik in den Artikeln 117 bis 122 sowie das Protokoll Nr. 14 zur Sozialpolitik, die im Zusammenhang mit dem Maastricht-Vertrag angenommen wurden, geben der Gemeinschaft keiner lei Kompetenz, Rechtsakte anzunehmen, durch die der materielle Inhalt der Sozialgesetzgebung der Mitgliedstaaten z.B. hinsichtlich der Höhe von Leistungen harmonisiert wird. Dasselbe gilt auch für Bildung und Ausbildung, denn auch wenn der EG-Vertrag ein Kapitel über allgemeine und berufliche Bildung und Jugend enthält, so heißt es im Artikel 126 ausdrücklich, daß die Mitgliedstaaten die volle Verantwortung "für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems" behalten.
Das allgemeine Prinzip der Nichtdiskriminierung sowie die detaillierten Vorschriften in der Verordnung 1408/71 über Sozialversicherungsleistungen haben jedoch dazu geführt, daß einige der schwedischen Vorschriften, durch die bestimmte Rechte und Leistungen für schwedische Staats angehörige oder für in Schweden ansässige Personen reserviert waren, geändert wurden.
Der EG-Vertrag und das Sozialprotokoll im Anhang des Maastricht-Vertrags geben der Gemeinschaft die Kompetenz, Rechtsvorschriften betreffend Beschäftigungsfragen anzunehmen, aber aufgrund des hohen Schutzniveaus, das die Arbeiter in Schweden allgemein genießen, und in Anbetracht der recht fortschrittlichen Vorschriften zur Chancengleichheit brauchte Schweden in seinem Arbeitsrecht nur geringe Veränderungen vorzunehmen, um bestehende Rechtsakte der Gemeinschaft einzuhalten. Sehr wahrscheinlich wird Schweden seine Tradition, den Arbeitsmarkt durch Tarifverträge zu regeln, beibehalten können, denn die Kommission sagte dem Land im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt zu, daß das Sozialprotokoll zum Vertrag über die Europäische Union in keiner Weise eine Änderung der bestehenden schwedischen Praxis in Beschäftigungsfragen und insbesondere seines Systems der Tarifübereinkünfte zwischen den Sozialpartnern erfordern werde.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Eckdaten zu Schweden?
Schweden ist mit 449.964 km² das fünftgrößte Land Europas. Die Hauptstadt ist Stockholm mit einem Großraum von 1,6 Millionen Einwohnern. Die Bevölkerung beträgt ca. 8.860.000 Einwohner. Es gibt Minderheiten wie Finnischsprachige und Lappen (Samen). Der Ausländeranteil beträgt ca. 12%. Die Landessprache ist Schwedisch und die Hauptreligion ist Protestantisch (Lutherisch). Schweden ist seit dem 16. Jahrhundert unabhängig und eine parlamentarische Demokratie mit einem König als Staatsoberhaupt.
Wie ist die politische Landschaft Schwedens strukturiert?
Schweden ist eine parlamentarische Demokratie mit König Carl XVI. Gustaf als Staatsoberhaupt. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei stellt seit dem Krieg die meisten Regierungen. Es gibt eine Opposition bestehend aus der Moderaten Sammlungspartei, Zentrumspartei, Volkspartei und Christdemokraten. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist hoch (85%), mit LO als größtem Dachverband. Die Verwaltungsstruktur ist zentralistisch mit Selbstverwaltung in Bezirken und Kommunen.
Welche Rolle spielt Schweden in internationalen Organisationen?
Schweden ist Gründungsmitglied des Europarats, Mitglied der EU, VN, VN-Sonderorganisationen, OECD, OSZE, ESA. Es ist kein NATO-Mitglied, sondern nur Beobachter bei WEU.
Wie ist die schwedische Wirtschaft charakterisiert?
Die schwedische Wirtschaft ist stark exportorientiert, da der Binnenmarkt mit nur 8,8 Millionen Einwohnern begrenzt ist. Wichtige Industriezweige sind die Metall- und metallverarbeitende Produktion, Holzverarbeitung, chemische, pharmazeutische und Textilindustrie.
Wie ist Schweden in die Europäische Union integriert?
Schweden ist seit 1995 EU-Mitglied, erfüllt die Kriterien des Maastrichter Vertrages, hat aber 1999 nicht an der Währungsunion teilgenommen. Das BIP beträgt 1.738,9 Mrd. skr, mit einer Zuwachsrate von 1,8%. Die Arbeitslosigkeit beträgt 10,2% und die Inflationsrate 0,9%. Schweden gehört innerhalb der EU zu den Geberländern.
Wie sieht die Energieversorgung in Schweden aus?
Der Energiebedarf wird hauptsächlich durch Kernkraft (47%) und Wasserkraft (34%) gedeckt. Es gibt einen geplanten Ausstieg aus der Kernenergie bis 2010, der jedoch am Widerstand der Industrie scheitert.
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in Schweden?
Obwohl nur ein kleiner Teil des Landes landwirtschaftlich genutzt wird, kann Schweden rund 80% des Nahrungsmittelbedarfs selbst decken.
Welche Rohstoffe sind in Schweden vorhanden?
Schweden verfügt über Rohstoffe wie Eisenerz, Kupfererz, Zink und Blei sowie große Uranlager vor allem in Mittelschweden.
Wie ist die schwedische Handelsbilanz?
Die Handelsbilanz beträgt 132 Mrd. skr. Hauptexportprodukte sind Maschinen und Transportmittel. Hauptausfuhrländer sind Deutschland, Großbritannien und Norwegen. Hauptlieferländer sind ebenfalls Deutschland, Großbritannien und Norwegen.
Was sind wichtige Aspekte der Geschichte Schwedens?
Die Geschichte Schwedens reicht bis in die Steinzeit zurück. Die Wikingerzeit war von Expansion geprägt, vor allem nach Osten. Die Christianisierung erfolgte im 11. Jahrhundert. Finnland wurde im 12. und 13. Jahrhundert dem schwedischen Reich einverleibt. Die Kalmarer Union vereinte Dänemark, Norwegen und Schweden unter einem König. Unter Gustav Wasa wurden die Grundlagen des schwedischen Nationalstaats gelegt. Schweden war im 17. Jahrhundert eine Großmacht, verlor aber später Gebiete und verfolgt seit dem Ersten Weltkrieg eine Neutralitätspolitik.
Welche Rolle spielt Schweden in Bezug auf Europa?
Schweden beantragte 1991 die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft und trat 1995 der Europäischen Union bei. Schweden zog es vor, sich der Währungsunion der EU (EMU) nicht anzuschließen, befürwortet aber einen späteren Beitritt. Schweden wird im ersten Halbjahr 2001 die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernehmen.
Hat der EU-Beitritt Auswirkungen auf den Sozialschutz in Schweden?
Der Beitritt Schwedens zur Europäischen Union hat keine (direkten) Auswirkungen auf die schwedischen Vorschriften zum Sozialschutz. Die Mitgliedstaaten behalten die volle Verantwortung "für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems". Allerdings haben die Vorschriften zur Nichtdiskriminierung dazu geführt, dass einige schwedische Vorschriften geändert wurden, die bestimmte Rechte und Leistungen für schwedische Staatsangehörige oder in Schweden ansässige Personen reserviert waren.
- Quote paper
- Philipp Haury (Author), 2000, Schweden und die Europäische Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98268