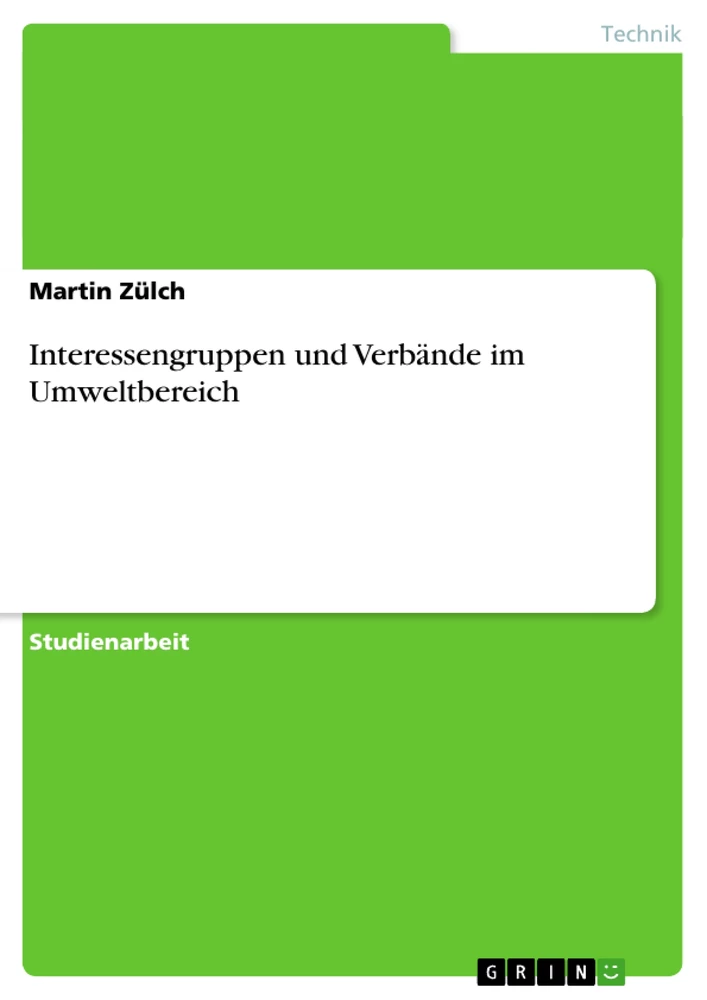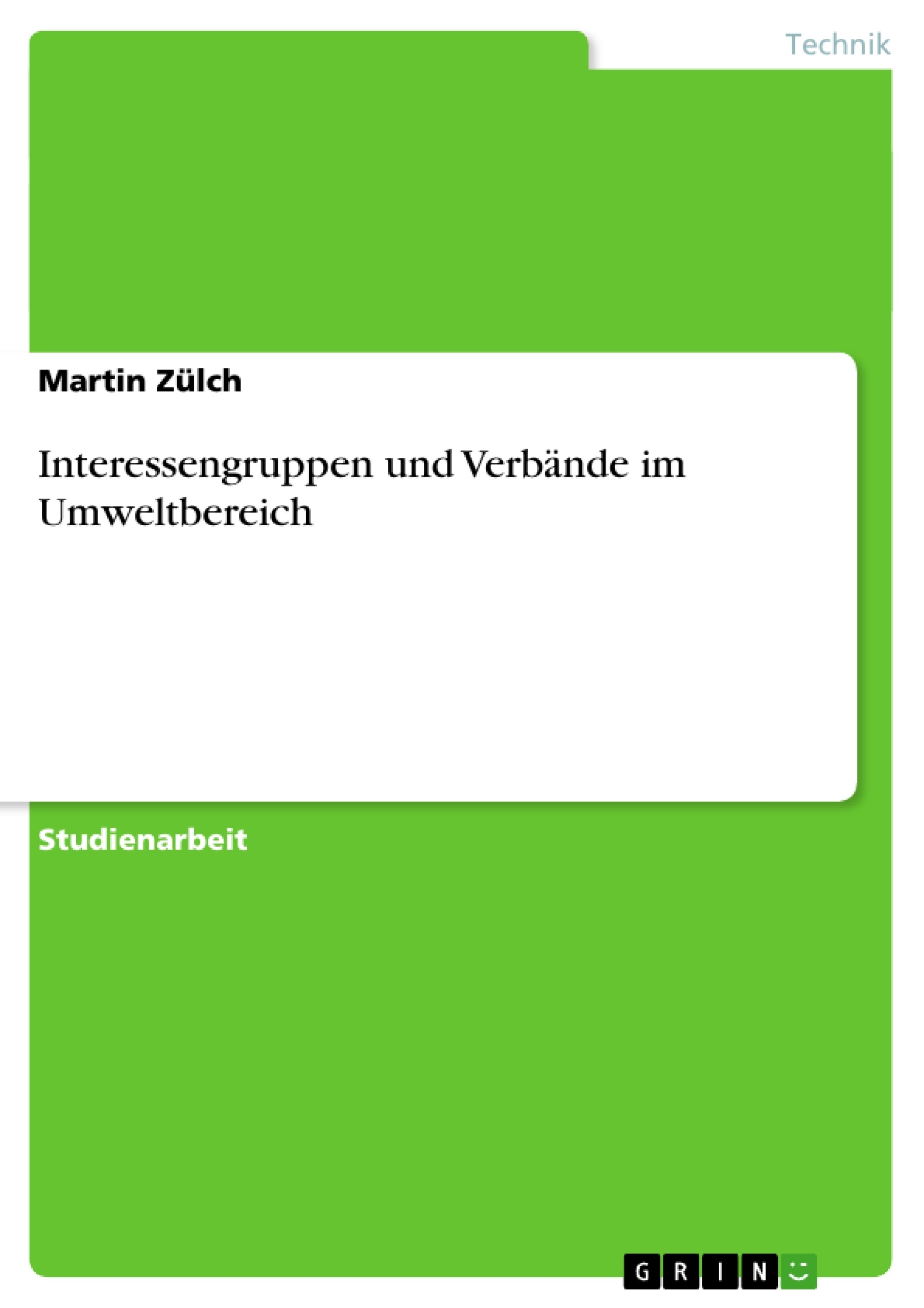Gliederung
0. Abbildungsverzeichnis
1. Abgrenzung der Themenstellung
2. Geschichte des Umweltschutzes
2.1. Entstehung erster Umweltschutzorganisationen
2.2. Verschiedene Organisationen zum Schutz der Umwelt
3. Vorstellung der Organisationen BUND, NABU, GNOR
3.1. BUND
3.1.1. Geschichte
3.1.2. Struktur/Organisation
3.1.3. Zielsetzung
3.1.4. Programm /Aktionen
3.2. NABU
3.2.1. Geschichte
3.2.2. Struktur/Organisation
3.2.3. Zielsetzung
3.2.4. Programm /Aktionen
3.3. GNOR
3.3.1. Geschichte
3.3.2. Struktur/Organisation
3.3.3. Zielsetzung
3.3.4. Programm /Aktionen
4. Vergleich der Organisationen
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
0. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Gliederung, S. 20
Abb. 2: Struktur BUND, S. 21
Abb. 3: Struktur NABU, S. 22
Abb. 4: Naturschutzgebiete, aus: Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) (Hrsg.): Umwelt - global: dritter Bericht zur Umweltsituation, Bonn 1992, S. 23
Abb. 5: Struktur GNOR, S. 24
Abb. 6: Vom Aussterben bedrohte Arten,aus: Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) (Hrsg.): Umwelt - global: dritter Bericht zur Umweltsituation, Bonn 1992, S. 25
Abb. 7: Strukturübersicht BUND, NABU, GNOR, S. 26
1. Abgrenzung der Themenstellung
Der Umweltschutz ist ein Thema, das in den letzten Jahrzehnten in alle Bereiche des menschlichen Lebens vorgedrungen ist. Es gibt heutzutage kaum noch ein Produkt, bei dessen Produktion oder Konsum nicht verstärkt auf die Umweltverträglichkeit Wert gelegt wird.
Beispielsweise müssen Fabriken, die umweltbelastende Abgase ausstoßen, mit aufwendigen Filteranlagen ausgestattet werden. Ein Neuwagen ohne Katalysator ist inzwischen undenkbar geworden, und im privaten Eigenheim wird schon bei Planung und Bau, sowie in fast allen Bereichen des täglichen Lebens auf Umweltschutzaspekte und Energiesparmaßnahmen geachtet.
Leider war dies nicht immer so, sondern dieses umweltbewußte Verhalten entstand bei vielen erst, als sie überhaupt von einer Art "Umweltproblematik" hörten. Darauf aufmerksam machten in den Anfängen vor allem private Einrichtungen, die die möglichen Gefahren einer zunehmenden Umweltverschmutzung erkannten.
Eine der ersten großen Organisationen war die 1972 entstandene GruppeGreenpeace1, die durch spektakuläre Aktionen einerseits ein Umweltbewußtsein in der Bevölkerung schaffen wollten, andererseits Druck auf die Verantwortlichen ausüben wollten.
Drei weniger bekannte Interessengruppen, die ebenfalls auf dem Gebiet des Umweltschutzes tätig sind, sollen in dieser Arbeit näher betrachtet werden. Hierbei handelt es sich um den"Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" (BUND),den"Naturschutzbund Deutschland" (NABU)und die"Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland- Pfalz" (GNOR).
2 .Geschichte des Umweltschutzes
2.1. Entstehung erster Umweltschutzorganisationen
Der Begriff "Umweltschutz" ist erst seit 1970 als deutsche Übersetzung des englischen Begriffs "environmental protection" in den deutschen Sprachgebrauch übernommen worden. Seit dieser Zeit sind Begriffe wie "Umweltschutz", "Naturschutz" oder "Ökologie" zu Modewörtern geworden. Einzelne Umweltschutzmaßnahmen sind aber schon aus dem Mittelalter bekannt, als beispielsweise 1301 in London der Verbrauch von Kohle als Heizmittel gesetzlich beschränkt wurde, um die Abgase zu reduzieren.2
Ein organisierter Schutz der Umwelt entstand allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich erste Interessengruppen bildeten, von denen sich die meisten noch mit dem Schutz der Vogelwelt befaßten. Im Zuge der Industrialisierung wurde die Umweltproblematik immer komplexer, so daß sich die Tätigkeitsbereiche bestehender Organisationen erweiterten, und sich ständig neue Gruppen mit neuen Zielsetzungen bildeten.
Eine erste Koordination auf bundesweiter Ebene fand 1950 mit der Bildung desDeutschen Naturschutzring (DNR)als Dachverband von damals über 100 Vereinigungen statt, zu denen neben organisierten Gruppen auch z.B. Jäger, Angler, Wanderer oder Reiter gehörten.3
Einzug in die Politik fand der Umweltschutz 1972 mit der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm. Ein Umweltschutz-Programm wurde entwickelt, welches von allen politischen Parteien, den Industrieverbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen angenommen wurde.
2.2. Verschiedene Organisationen zum Schutz der Umwelt
Der Umweltschutz ist heute auf verschiedenen Ebenen organisiert. Auf politischer Ebene ist das seit 1986 existierende Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu nennen, welches aus Anlaß der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gebildet wurde.4 Weiter sind Parteien, wie z.B. "Die Grünen" oder die ÖDP zu nennen, die den Umweltschutz zu einem Hauptbestandteil ihres politischen Programms gemacht haben.
Die wichtigsten Organisationen auf nichtpolitischer Ebene sind Greenpeace, deren Tätigkeitsfeld alle Bereiche des Umweltschutzes umfaßt und derWWF, der sich hauptsächlich auf den Artenschutz konzentriert.
Auch auf privater Ebene, in der Bevölkerung, fand in den letzten Jahren ein Wandel der Einstellung gegenüber der Umwelt statt, was z.B. das Konsumverhalten umweltgerechter gestaltete. So werden verstärkt Recycling-Produkte gekauft, Mehrwegflaschen für Getränke verwendet, oder ganz allgemein die Produkte bevorzugt, für die mit Umweltfreundlichkeit oder dem Prädikat "Bio" geworben wird.5
3. Vorstellung der Organisationen BUND, NABU, GNOR
3.1. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
3.1.1. Geschichte
Die Ursprünge desBUNDgehen auf das Jahr 1970 zurück. Damals wollte der Europarat durch die Einberufung einer Naturschutzkonferenz auf die Notwendigkeit des Schutzes der Umwelt aufmerksam machen, da die Gefährdung der Natur, die vom Menschen ausgeht bis dahin noch nicht in das Bewußtsein der Bevölkerung vorgedrungen war. Somit wurde allmählich ein Umweltbewußtsein entwickelt, was unter anderem zu der Gründung desBUNDführte.
1972 überreichte eine Gruppe von Ökologen, die sich aus namhaften Naturwissenschaftlern und Journalisten, wie z.B. Bernhard Grzimek und dem jetzigen Bundesvorsitzenden Hubert Weinzierl zusammensetzte, ein Thesenpapier, in dem das bisherige Wachstumsdenken der Wirtschaft kritisiert wurde, und die alternative Betrachtungsweise des Wirtschaftssystems als Kreislaufprozess, ähnlich derer in der Natur, dargestellt wurde.
Die Mitglieder dieser Gruppe sahen imDeutschen Naturschutzring (DNR)kein ausreichendes Forum für den Naturschutzgedanken, da die Interessen bestimmter Gruppen, wie Jäger oder Sportfischer, dem Grundgedanken des Naturschutzes entgegenstanden.6
Mitglieder des damals schon existierendenBund Naturschutz Bayern (BN)betrachteten denDNRals zu unkritisch, was seine Haltung gegenüber bestimmten brisanten Themen, wie z.B. der Kernenergie, betraf und entschlossen sich, 1975 gemeinsam mit derGruppe Ökologie einen bundesweit operierenden Naturschutzverband zu gründen, der jeweils aus einem Landesverband für je ein Bundesland bestehen sollte. Auch damals existierten schon verschiedene Natur- und Umweltschutzverbände neben Bayern in Baden-Württemberg, Niedersachsen, dem Saarland, Berlin und Bremen, die jedoch nur regional arbeiteten.
Zwischen 1983 und 1989 stieg die Mitgliederzahl sprunghaft von bisher 80.000 auf nunmehr 160.000 Personen.7 Zur Zeit beträgt sie etwa 220.000.8
1984 entstand dieBUND-Jugenddurch die Initiative einiger Delegierter von damals schon bestehenden Jugendorganisationen innerhalb verschiedener Landesverbände.
Im Laufe der Zeit wurde derBUNDdurch die Besetzung mit Experten zu einem kompetenten Ansprechpartner in Sachen Umweltfragen. Nach dem Mauerfall 1989 gründete sich in der ehemaligen DDR in Sachsen ein Landesverband desBUND.1990 entstanden sowohl in Thüringen als auch in Brandenburg je ein Landesverband. Anschließend folgten auch die übrigen Neuen Bundesländer.9
3.1.2. Struktur/Organisation
DerBUNDist der mitgliedsstärkste Verband in Deutschland. DerBund Naturschutzin Bayern ist mit 100.000 Mitgliedern der größte Landesverband.
Wie derNaturschutzbund Deutschland (NABU)ist derBUNDhierarchisch aufgebaut (Abb. 2). Der Bundesverband gliedert sich, wie schon erwähnt, in Landesverbände (in jedem Bundesland), wobei derBund Naturschutzin Bayern mit 100.000 Mitgliedern den größten Landesverband darstellt. Diese Landesverbände wiederum gliedern sich in verschiedene Kreis- oder Ortsgruppen. Die Landesverbände entsenden Vertreter in die Delegiertenversammlung des Bundesverbandes. Diese wählt den Bundesvorstand, dem 5 Mitglieder und der /die Sprecher/in derBUND-Jugend, die allen Mitgliedern unter 25 Jahren zugänglich ist, angehören.10
Weiterhin besteht neben dem Vorstand ein Beirat, bestehend aus einem fachpolitischen (aus Sprecher/innen der Arbeitskreise) und einem verbandsorganisatorischen (aus Vorsitzenden der Landesverbände) Ausschuß.
Die Bundesgeschäftsstelle in Bonn wird von einem Bundesgeschäftsführer und zwei Stellvertretern geleitet. Neben Verwaltungsabteilungen gibt es eine Fachabteilung mit Referenten für verschiedene Fachgebiete. In den Fachreferaten der Bundesgeschäftsstelle sitzen fest angestellte Fachleute, die mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Arbeitskreise zusammenarbeiten und sie unterstützen, was auch für den Vorstand gilt. Durch die Erstellung von Informationsmaterial, das den Mitgliedern der Orts- und Kreisgruppen zur Verfügung gestellt wird, unterstützen sie diese bei der Argumentation in der umwelt- und naturschutzpolitischen Auseinandersetzung. Die Vertretung desBUNDbei Konferenzen oder in anderen Vereinen gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich. Hauptamtliche Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle sind hauptsächlich für die politische Lobbyarbeit zuständig. DieBUND-Mitglieder werden vierteljährlich durch die verbandseigene Zeitschrift "Natur und Umwelt" über die aktuellen Aktionen und verbandspolitischen Angelegenheiten informiert.11
Als finanzielle Quellen dienen Mitgliedsbeiträge, Spenden, sowie Einnahmen aus dem Vertrieb von Produkten aus dem verbandseigenen "Bundladen", Einnahmen aus Werbeverkaufsseiten in "Natur und Umwelt" und dem Verkauf der Verbandszeitschrift an Nichtmitglieder. Eine institutionelle Förderung wird abgelehnt, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten.
3.1.3. Zielsetzung
Im Vordergrund stehen speziell der Natur- und Artenschutz. DerBUNDhat sich durch seine Satzung dem Schutz und der Pflege von Natur und Umwelt und der Förderung einer naturverbundenen Landschaftsgestaltung verschrieben.
Die Umweltzerstörung soll eingedämmt werden und die verbliebene Natur vor wei-teren Eingriffen geschützt werden. Von Bedeutung sind weiterhin die Minderung von Luftverschmutzung und Lärm und die Schaffung menschlicher Wohn- und Arbeitsbedingungen. Eine auf Dauer angelegte ökologische Strategie soll allmählich Einzelmaßnahmen ersetzen und zum umweltgerechten Verhalten führen, wodurch Ressourcenverschwendung durch die Förderung alternativer Energiegewinnung ersetzt werden soll. Wirtschaftswachstum soll vermehrt unter qualitativen Aspekten betrachtet werden, unter anderem durch die Quantifizierung von Umweltschäden.12
3.1.4. Programm/Aktionen
Die Tätigkeit des Verbandes erstreckt sich hauptsächlich sich auf Öffentlichkeitsarbeit und auf praktischen Umwelt- und Naturschutz. Podiumsdiskussionen, Stellungnahmen zu öffentlichen Bauvorhaben oder Verkehrsmaßnahmen gehören ebenso dazu wie Vorträge und Informationsstände. Durch die Veranstaltung von Demonstrationen, oder durch die Einrichtung eines Infotelefons möchte derBUNDaktiv an der Diskussion teilnehmen. Dabei wird die gesamte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit von der Bundesgeschäftsstelle koordiniert und geleitet.
Die praktischen Maßnahmen werden vorrangig von den jeweiligen Ortsgruppen durchgeführt und geplant. Die Mitglieder der Ortsgruppen messen z.B. die Wasserqualität eines Gewässers, ermitteln Daten über den Bestand einer Tier- oder Pflanzenart und richten bei Bedarf spezielle Arbeitsgruppen ein. Die Wiedereinbürgerung bestimmter Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. die des Bibers, stellt ebenfalls einen zentralen Punkt dieser Arbeit dar.
3.2. Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.
3.2.1. Geschichte
Wie bei vielen anderen Naturschutzverbänden stand bei Gründung desNABUzunächst der Schutz der Vogelwelt im Vordergrund. So rief Lina Hähnle 1899 den "Bund für Vogelschutz" ins Leben, aus dem später derNABUhervorging. Schon 1911 weitete sich dessen Tätigkeitsfeld aus, indem die Gründerin am ober-schwäbischen Federsee einige feuchte Wiesen kaufte, um die dort bedrohte Natur zu schützen. So entstand der Biotopschutz, der bis heute eine wichtige Rolle im gesamten Umweltschutzbereich spielt.
Später entstanden zahlreiche Vogelschutzstationen an der Ostseeküste und das Biber-Reservat Steckby an der Elbe, das jetzt zu einem Biosphärenreservat gewor-den ist. So hatte der damalige"Bund für Vogelschutz"bis 1945 bereits 10.000 Mitglieder.13 In den nun fast 100 Jahren seines Bestehens hat derNABUsich vom reinen Vogelschutzverband zu einer viele Bereiche des Naturschutzes umfassenden Organisation hochgearbeitet und zählt mittlerweile rund 200.000 Mitglieder.14
3.2.2. Struktur / Organisation
Der NABU ist in einer relativ strengen Hierarchie organisiert (Abb. 3). An oberster Stelle steht die Bundesgeschäftsstelle in Bonn, die zur Zeit 14 Landesverbände unter sich hat. Die einzelnen Landesverbände sind jeweils für die insgesamt 1.500 Orts- und Kreisgruppen sowie für die nochmals 1.500 Gruppen der sog. Naturschutzjugend zuständig. Aus den Orts- und Kreisgruppen, die wiederum durch einen Vorstand geleitet werden, bilden sich dann jeweils nach Bedarf einzelne Arbeitsgruppen, die praktischen Naturschutz vor Ort betreiben. Sie mähen z.B. Feuchtwiesen, pflanzen Hecken, schneiden Kopfweiden und gestalten Tümpel und Teiche.
Die Naturschutzjugend bietet jungen Menschen unter 25 Jahren die Möglichkeit sich in Kinder- und Jugendgruppen zu engagieren, um z.B. an verschiedenen Protestveranstaltungen mitzuwirken.
Die Mitarbeit in den Arbeitskreisen sowie den Orts- und Kreisgruppen erfolgt rein ehrenamtlich. Auf Landes- und Bundesebene sind dagegen Hauptamtliche beschäftigt.
Neben den Orts- und Kreisgruppen, der Naturschutzjugend, den Landesverbänden und dem Bundesverband existieren auch zahlreiche bundesweit arbeitende Fachausschüsse und Arbeitskreise zu zoologischen und botanischen Spezialthemen, aber auch zum Umweltrecht, zur Landwirtschaftspolitik und zur Verkehrsproblematik.
Die Information der NABU-Mitglieder erfolgt durch die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift "Naturschutz heute", die aktuell über alle Bereiche des Natur- und Umweltschutzes berichten soll. Die Finanzierung des NABU erfolgt über Mitgliedsbeiträge und Spenden.15
3.2.3. Zielsetzung
An erster Stelle derNABU-Ziele steht der Arten- und Naturschutz. Dieser soll vorrangig durch eine Eindämmung der Abfallmengen und eine Reduzierung des Energieverbrauchs auf der ganzen Linie hin zu einer auch in Zukunft noch sinnvollen Wirtschaftsweise, die Abfallmengen und Energieverbrauch auf eine umweltverträgliche Menge reduzieren, erreicht werden.
An zweiter Stelle stehen die vermehrte Nutzung der öffentlicher Verkehrsmittel und der schonende Umgang mit allen natürlichen Ressourcen sowie eine schnelle Sanierung von Umweltkrisengebieten, vor allem in den neuen Bundesländern.16
DerNABUgeht davon aus, daß die Information und die Aufklärung jedes einzelnen Bürgers unabdingbare Grundlagen sind, um mehr für den Erhalt von Natur und Umwelt zu tun. DerNABUwill einen Naturschutz auf der gesamten Fläche anstreben. Das heißt, es soll eine flächendeckende naturschonende Landnutzung erfolgen. 1970 standen nur 1.300 km2 des Bundesgebietes unter Naturschutz. 1989 waren es bereits 27.600 km2. Das sind über 11% des gesamten "alten" Bundesgebietes, also noch ohne die neuen Bundesländer. Abbildung 4 gibt einen Überblick über diese Entwicklung von 1970 bis 1989 und zeigt, daß Deutschland 1989 in dieser Übersicht sogar an der Spitze lag, wenn man die Fläche der Naturschutzgebiete ins Verhältnis zur gesamten Landfläche setzt.
3.2.4. Aktionen / Programme
Wie in 3.2.3. genannt, sind die Information und die Aufklärung der Menschen die Grundlagen für ein umweltgerechtes Handeln. Deshalb betreibt derNABUzahlreiche Naturschutzzentren und das Naturschutzseminar Sunder in der Nähe von Celle, wo Interessenten sich in Seminaren in Ökologie und Naturschutz fortbilden können.
Die Arbeit direkt an der Natur geschieht meist durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der verschiedenen Ortverbände. Dort werden z.B. Hecken gepflanzt, Kopfweiden geschnitten, oder Teiche und Tümpel angelegt, die dann neuen Lebensraum für bedrohte Tier und Pflanzenarten bieten.
Groß angelegte Aktionen sind beispielsweise die Vogelschutzstationen an der Ostseeküste, das schon genannte Biber-Reservat Steckby oder das Biosphärenparkkonzept und der Biotopschutz. Das Biosphärenparkkonzept umfaßt Vorschläge, um bestimmte Landschaftsgebiete wie z.B. die Schorfweide, die Rhön oder die Havelniederung zu Modellandschaften für umweltverträgliche Wirtschaftsweisen zu machen. Der Biotopschutz soll durch den Menschen geschädigte Landschaften wieder in ihren natürlichen Zustand zurückversetzen. Moore, die oft durch Torfabbau und andere Maßnahmen geschädigt wurden, sollen wieder zu einem natürlichen Feuchtgebiet umgewandelt werden, um so moorgebundenen Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum zu sichern.
Die Naturschutzjugend bietet ein weiteres großes Aktionsfeld desNABU. Sie organisiert Straßentheater, Büchertische und andere Protestveranstaltungen, wie z.B. "Total tote Dose", eine Kampagne gegen Einwegverpackungen, die "Schüler(innen) Aktion Umwelt" (SAU), oder die Aktion "Mobil ohne Auto" (MOA).17
3.3. Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinand-Pfalz (GNOR) e.V.
3.3.1. Geschichte
DieGNORwurde in ihrer jetzigen Form 1977 gegründet, als unmittelbare Nachfolgeorganisation der "Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz", die seit 1969 bestand, und deren Aktivitäten sich ausschließlich auf den Schutz der Vogelwelt beschränkten.
Seit 1984 ist dieGNORnach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes als "Gesellschaft zur Förderung von Naturschutz und Landespflege und Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt" anerkannt.18
3.3.2. Struktur / Organisation
DieGNORist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Es gibt drei Geschäftsstellen, die Landesgeschäftsstelle in Nassau und je eine Regionalgeschäftsstellen in Mainz und in Neustadt/Weinstraße (Abb. 5). Dort sind hauptamtlich Biologen, Zivildienstleistende, Praktikanten und ehrenamtliche Mitarbeiter tätig.19
Derzeit umfaßt dieGNORca. 860 Mitglieder, die sich fast alle an regionalen Arbeitskreisen aktiv beteiligen. Diese Arbeitskreise befassen sich einerseits mit wissenschaftlichen Arbeiten, wie z.B. Kartierungen, Erhebungen oder Publikationen, und andererseits mit praktischen Arbeiten, wie z.B. der Betreuung oder Pflege schutzbedürftiger Flächen.
Die Mitgliederinformation erfolgt über zwei Jahreshauptversammlungen mit Fachvorträgen und über regionale Arbeitstreffen, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.
Außerdem werden eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift und regelmäßige Rundschreiben ("GNOR-Info" und "GNOR-Aktuell") an die Mitglieder herausgegeben.20
3.3.3. Zielsetzung
DieGNORsetzt sich für den Arten- und Biotopschutz im generellen Sinne ein, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der Ornithologie liegt, da derGNORdie "Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz" zugrunde liegt, die sich ausschließlich mit dem Vogelschutz beschäftigte. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Information der Öffentlichkeit über die Natur und deren Gefährdung durch den Menschen. Hiervon erhofft sich dieGNOR ein besseres Verständnis der natürlichen Umwelt und ihrer Bedeutung für die menschliche Existenz.
DieGNORsetzt sich für die Wiederherstellung und Neuschaffung natürlicher Lebensräume ein. So werden z.B. nicht mehr genutzte Steinbrüche, Kies-, Sand- und Tongruben mit ihren vielen Steilwänden, Wasser- und Sandflächen dazu verwendet, neue Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu schaffen.
Ein weiteres Ziel ist die Durchführung und Auswertung von ökologischen Untersuchungen als Voraussetzung für Schutzmaßnahmen.21
3.3.4. Aktionen und Programme
DieGNORbeteiligt sich an regionalen und überregionalen faunistischen Erfassungs- und Untersuchungsprogrammen, bei denen die Häufigkeit und die Lebensgewohnheiten verschiedener Tiere, insbesondere der Vögel, festgestellt werden. Diese Erfassungsdaten bieten die Möglichkeit, insbesondere in Rheinland-Pfalz die Grundlagen für die sog. "Rote Liste" zu erarbeiten. Diese "Rote Liste" enthält Informationen über bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Abbildung 6 zeigt eine Übersicht über verschiedene Tierarten und dessen Bedrohung in verschiedenen Ländern am Ende der achtziger Jahre. Es ist deutlich zu sehen, daß Deutschland zu diesem Zeitpunkt bei den meisten Tierarten an der Spitze lag.
Die GNOR führt landesweit spezielle Schutzprojekte (u.a. für Vögel, Reptilien, Amphibien, Säugetiere, Insekten und Pflanzen) durch. Diese sollen das Überleben von stark gefährdeten Arten (u.a. Braunkehlchen, Wiedehopf, Smaragdeidechse, Moorfrosch, Wasserfledermaus, Apollofalter, Pillenfarn) sichern helfen.
Arbeitsgruppen derGNORkartieren Laichplätze der Amphibien. Massenwanderwege, auf denen Kröten, Frösche und Molche durch den Verkehr gefährdet sind, werden festgestellt. Besondere Einsätze (z.B. Sammel- und Übersetzaktionen) sollen den Straßentod verhindern. Gemeisam mit den Behören werden auch dauerhafte Schutzmaßnahmen, wie z.B. die Untertunnelung von Straßen oder das Aufstellen von Leitzäunen geplant.
DieGNORunternimmt Planungen und Arbeitseinsätze für die Neuanlage und Gestaltung von Biotopen (z.B. Feuchtgebiete, Brachflächen, Trockenmauern). Dazu gehören auch die darauffolgenden pflegerischen Maßnahmen, für die eigene Pflegepläne erstellt werden.
Landespflegerische Maßnahmen werden aber auch in sonstigen Naturschutzgebieten durchgeführt.22
Mitarbeiter derGNORbeantragen bei Planungsverfahren des Siedlungs- und Straßenbaus, der Flurbereinigung und der Wasserwirtschaft die Erhaltung wertvoller Landschaftsteile und somit den Erhalt von natürlichem Lebensraum für die bedrohte Tier- und Pflanzenwelt.
Dadurch wirken die Mitarbeiter der verschiedenen regionalen Arbeitskreise bei jährlich rund 1.600 behördlichen Planungsverfahren mit.23
Außerdem bearbeitet dieGNOReine Gesamtdarstellung der rheinland-pfälzischen Vogelwelt. Dabei werden spezielle Untersuchungsprojekte durchgeführt, wie z.B. die Winterzählung von Groß- und Kleinvögeln, Siedlungsdichtenuntersuchungen, Rasterkartierungen und eine im Rahmen eines international durchgeführten Projektes durchgeführte Zählung von rheinland- pfälzischen Wasservögeln.
DieGNORverfügt über eine Datenbank mit ökologischen Untersuchungsergebnissen und Dokumentationen, die auch der Allgemeinheit für Naturschutzzwecke zugänglich ist und regelmäßig aktualisiert wird.24
4. Vergleich der Organisationen
Bei genauer Betrachtung der drei untersuchten Verbände, lassen sich trotz der gemeinsamen Zielsetzung des Natur- und Artenschutzes verschiedene Interessenschwerpunkte erkennen.
Das Hauptaugenmerk desBUNDliegt auf der Beteiligung am umweltpolitischen Diskurs und der Einflußnahme auf die öffentliche Meinung zugunsten des Naturschutzgedankens, sowie der politischen Lobbyarbeit in Bonn, die durch seine Mitgliederstärke unterstützt wird.
-Durch die Vielfalt der vomBUNDaufgegriffenen Themen von der Atomkraft und ihren Auswirkungen bis hin zu Renaturierungsprojekten, wie z.B. der Wiedereinbürgerung des Bibers, bietet derBUNDeine breite Plattform für das umweltpolitische Engagement.
Die bundesweite Präsenz vor Ort ermöglicht eine flächendeckende Information der Bevölkerung und effiziente Naturschutzarbeit durch Koordination mit der Bundesgeschäftsstelle. Man legt, wie schon erwähnt, großen Wert auf politische Neutralität und Unabhängigkeit von Industrie und Wirtschaft, um sich keinerlei Zwängen aussetzen zu müssen.
DerNABUist teilweise durch seinen Aufbau und sein Wirken mit demBUNDvergleichbar. Durch seine langjährige Tradition als ältester deutscher Naturschutzverband besitzt er jedoch den reicheren Erfahrungsschatz und ist in vielen Gegenden fester verwurzelt. Wenn ein Verband schon seit über 90 Jahren existiert, so kann er schon fast als eine Art Institution in Sachen Naturschutz angesehen werden. Er kann es sich deshalb auch leisten, mit Industrie und Wirtschaft zu kooperieren, ohne dabei in Zugzwang zu geraten.
Die Jugend imNABUist eine der größten Naturschutzjugendorganisationen in Europa und eine wichtige Stütze des Verbandes. DerNABUmöchte zwar auch den Naturschutzgedanken weiter im Bewußtsein des Einzelnen entwickeln, jedoch ist die praktische Naturschutzarbeit vor Ort zentraler Bestandteil desNABU-Programms und stellt somit die Stärke des Verbandes dar.
DieGNORist als einzige der betrachteten Organisationen regional auf ein Bundesland beschränkt. Das Aufgabengebiet umfaßt ausschließlich den Schutz der Vogelwelt. Ähnlich demBUNDist dieGNORein noch junger Verband. Allein die geringe Mitgliederzahl von ca. 860 Personen führt zu einer starken Einschränkung der Wirkungsmöglichkeiten. Dafür konzentriert man sich auf wenige, überschaubare Projekte und naturwissenschaftliche Aufgabenstellungen, wie z. B. der Erfassung von Populationsbeständen einer Tier- oder Pflanzenart .
5. Fazit
Es ist unbestreitbar, daß durch die Naturschutzverbände das Umweltbewußtsein weiterentwickelt wurde. Auch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten wären ohne das Engagement der Verbände wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Andererseits darf man nicht verkennen, daß die Verschmutzung und Zerstörung der Natur bisher nicht aufgehalten werden konnte (siehe z.B. Rote Liste). Hier fragt man sich, ob ein gemeinsamer Verband nicht effektiver agieren könnte, als eine Vielzahl von Verbänden, deren Einfluß wesentlich geringer ist. Trotz der relativ hohen Mitgliederzahlen der beiden großen Verbänden scheint der Naturschutz in unserer Gesellschaft noch nicht genug Beachtung zu finden, wenn man sich nur einmal vor Augen hält, wieviele Menschen im Vergleich dazu in Sportvereinen, Automobilklubs u.s.w. organisiert wird. Somit sind die Naturschutzverbände weiterhin auf die Werbung neuer Mitglieder angewiesen. Es fragt sich, ob die bisherige Politik der Mitgliederwerbung effizient genug war. Haltungen, wie die desBUNDgegenüber Wirtschaft und Industrie werden dem Naturschutz auf Dauer nicht dienlich sein, da eine ständige Konfrontation zu keinem Ergebnis führen kann. Ansätze, wie die desNABU, eine Kooperation zu fördern, sind mit Sicherheit zukunftsweisend für die verbandspolitische Arbeit im Naturschutz.
Literaturverzeichnis
- Bonewitz, Michael (Hrsg.): Kampfblatt Naturschutz, Köln 1994
- Brockhaus Enzyklopädie: Band 23, 17. Auflage, München 1974
- Cornelsen, Dirk: Anwälte der Natur, München 1991
- Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie (GNOR) e.V. (Hrsg.): GNOR, o.O.u.J.
- Derselbe: Informationsbroschüre GNOR Info , o.O.u.J.
- Leonhard, Martin: Umweltverbände, Opladen 1985
- Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.(Hrsg.): Informationsbroschüre "Der Storch bringt's",o.O.,1994
[...]
1 Vgl. Cornelsen, Dirk, Anwälte der Natur, München 1991, S. 15.
2 Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, (Umweltschutz), 17. Auflage, Bd.23, München 1974, S.493.
3 Vgl. Cornelsen, D., Anwälte der..., a.a.O., S.13.
4 Vgl. Cornelsen, D., Anwälte der..., a.a.O., S. 15.
5 Ebd., S. 64.
6 Vgl. Cornelsen, D., Anwälte der..., a.a.O., S. 21f.
7 Ebd. S. 23.
8 Vgl.: Bonewitz, Michael (Hrsg.), Kampfblatt Naturschutz, Köln 1994, S. 161.
9 Vgl. Cornelsen, D., Anwälte der..., a.a.O., S. 23.
10 Ebd. S. 24.
11 Vgl. Cornelsen, D., Anwälte der..., a.a.O., S. 24f.
12 Leonarde, Martin, Umweltverbände, Opladen 1985, S. 163f.
13 Vgl.: NABU (Hrsg.), Informationsbroschüre "Der Storch bringt's", o.O., 1994, o. Seitenangabe.
14 Ebd., o. Seitenangabe.
15 Vgl.: NABU (Hrsg.), Informationsbroschüre ..., a.a.O., o. Seitenangabe.
16 Ebd., o. Seitenangabe.
17 Vgl.: NABU (Hrsg.), Informationsbroschüre ..., a.a.O., o. Seitenangabe.
18 Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie (GNOR) e.V. (Hrsg.): GNOR, o.O.u.J., o. Seitenangabe.
19 GNOR (Hrsg.), GNOR, ..., a.a.O., o. Seitenangabe.
20 Ders., Informationsbroschüre GNOR Info , o.O.u.J., o. Seitenangabe.
21 GNOR (Hrsg.), GNOR, a.a.O., o. Seitenangabe.
22 GNOR (Hrsg.), GNOR, a.a.O., o. Seitenangabe.
23 Derselbe: Informationsbroschüre GNOR Info , a.a.O., o. Seitenangabe.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Gliederung?
Diese Gliederung gibt einen Überblick über eine Arbeit, die sich mit dem Thema Umweltschutz und dem Vergleich verschiedener Umweltschutzorganisationen in Deutschland beschäftigt. Die Arbeit untersucht Organisationen wie BUND, NABU und GNOR.
Welche Organisationen werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit stellt den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), den Naturschutzbund Deutschland (NABU) und die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) vor.
Welche Aspekte der Organisationen werden betrachtet?
Für jede Organisation werden Geschichte, Struktur/Organisation, Zielsetzung und Programme/Aktionen detailliert beschrieben.
Was sind die Hauptthemen des Umweltschutzes, die in der Arbeit angesprochen werden?
Die Arbeit behandelt die Geschichte des Umweltschutzes, die Entstehung von Umweltschutzorganisationen, Luftverschmutzung, Lärmminderung, Naturschutz und Artenschutz, sowie die Förderung einer ökologischen Strategie.
Welche Grafiken und Abbildungen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit enthält Abbildungen zur Gliederung, zur Struktur von BUND, NABU und GNOR, zu Naturschutzgebieten und zum Thema bedrohte Tierarten.
Welche Ziele verfolgen BUND, NABU und GNOR?
Die Ziele umfassen Natur- und Artenschutz, die Eindämmung der Umweltzerstörung, die Minderung von Luftverschmutzung und Lärm, die Förderung einer naturverbundenen Landschaftsgestaltung und das Bemühen um umweltgerechtes Verhalten.
Wie sind BUND und NABU organisiert?
Beide Organisationen sind hierarchisch aufgebaut. Der Bundesverband gliedert sich in Landesverbände, die wiederum in Kreis- oder Ortsgruppen unterteilt sind. BUND hat zusätzlich eine BUND-Jugend.
Wie finanziert sich die GNOR?
Die GNOR finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Welche Schwerpunkte setzen BUND, NABU und GNOR?
BUND legt den Schwerpunkt auf die Beteiligung am umweltpolitischen Diskurs. NABU setzt auf praktische Naturschutzarbeit vor Ort, und GNOR konzentriert sich auf den Schutz der Vogelwelt und naturwissenschaftliche Aufgabenstellungen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit ist, dass Naturschutzverbände das Umweltbewusstsein weiterentwickelt haben und zahlreiche Tier- und Pflanzenarten gerettet wurden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein gemeinsamer Verband nicht effektiver agieren könnte und es wird dafür plädiert, dass Naturschutz mehr Beachtung in der Gesellschaft finden muss. Kooperation zwischen Naturschutz und Wirtschaft und Industrie ist wichtig.
- Quote paper
- Martin Zülch (Author), 2001, Interessengruppen und Verbände im Umweltbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98225