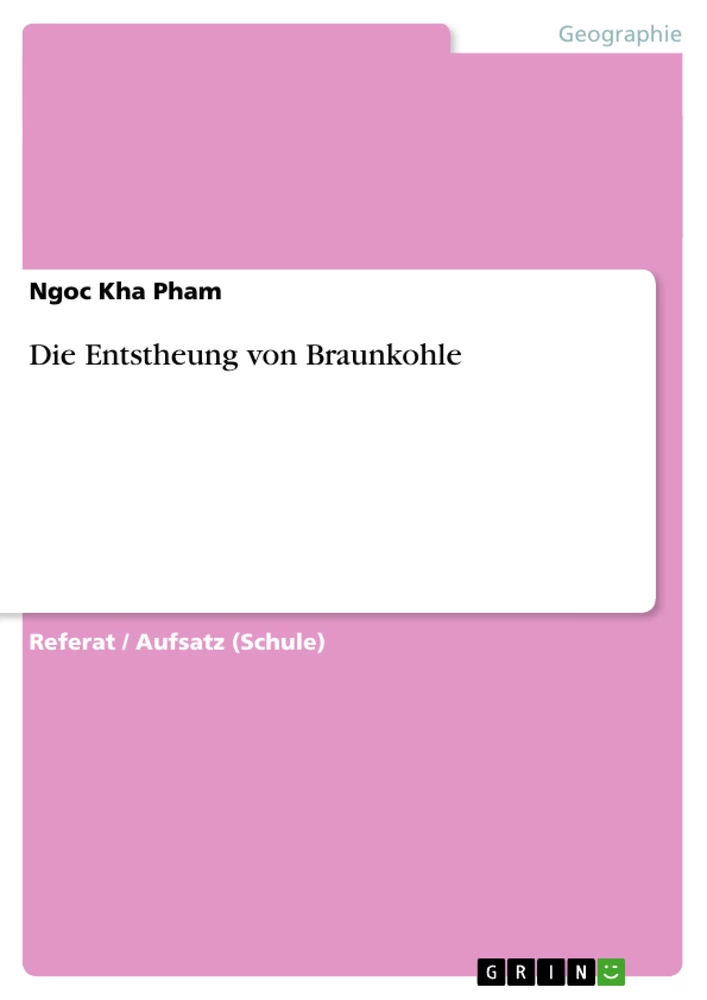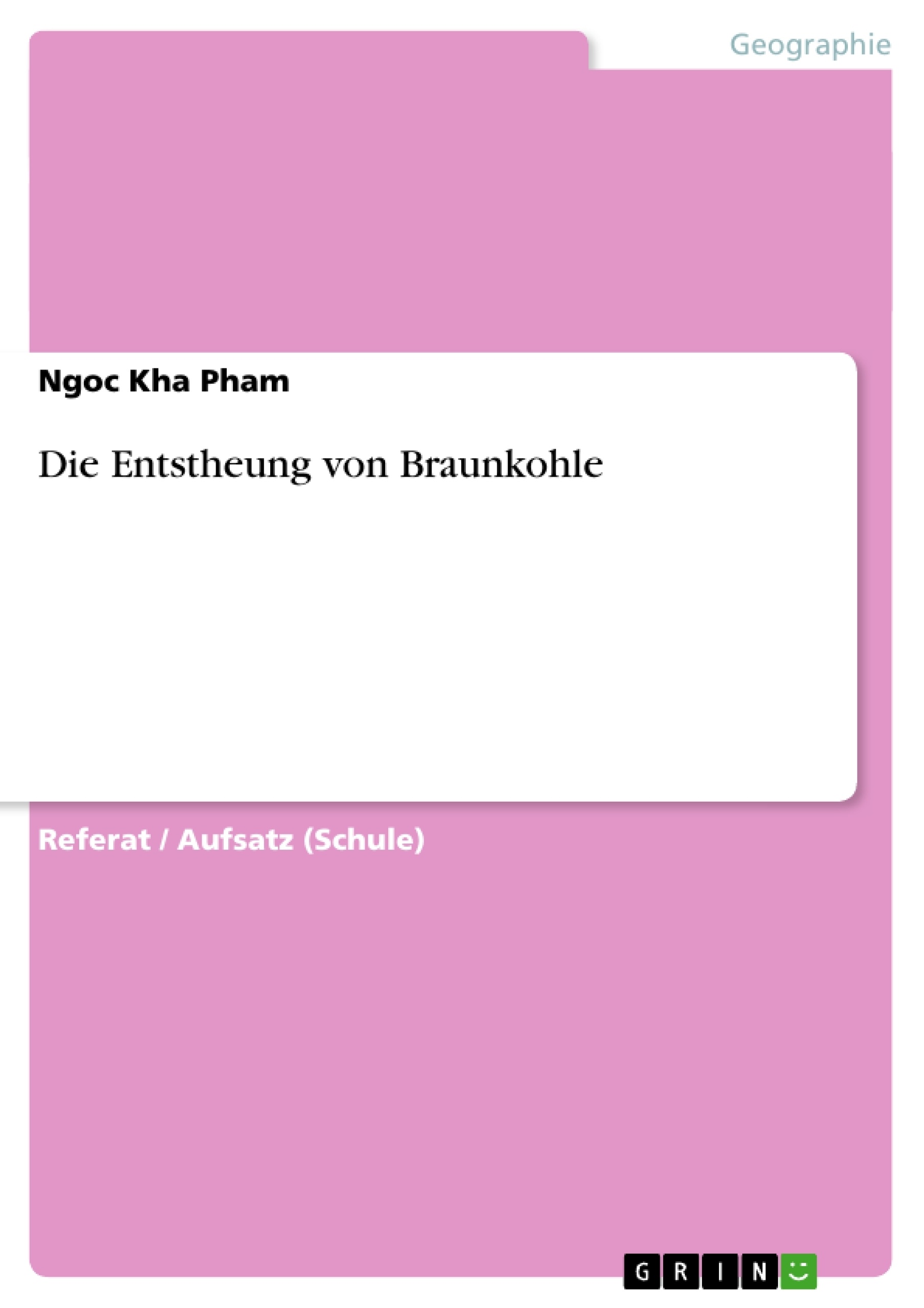Stellen Sie sich eine Reise zurück in die Zeit vor, als üppige Wälder und Sumpflandschaften das heutige Deutschland prägten. Vor Millionen von Jahren, im Erdzeitalter des Tertiärs, begann ein langsamer, aber unaufhaltsamer Prozess, der die Grundlage für einen bedeutenden Energieträger legte: die Braunkohle. Dieses Buch enthüllt die faszinierende Entstehungsgeschichte der Braunkohle, von den urzeitlichen Pflanzenresten, die unter dem Druck von Jahrmillionen zu diesem besonderen Rohstoff verdichtet wurden, bis hin zum modernen Abbau in riesigen Tagebauen. Es beleuchtet die komplexen technologischen Verfahren, die notwendig sind, um die Braunkohle zu fördern, darunter der Einsatz gigantischer Schaufelradbagger und kilometerlange Förderbänder. Dabei werden auch die Herausforderungen und Chancen der Rekultivierung ehemaliger Abbaugebiete thematisiert, die darauf abzielt, die Natur wiederherzustellen und neue Lebensräume zu schaffen. Doch es geht um mehr als nur Technik und Geologie. Das Buch wirft auch einen kritischen Blick auf die Auswirkungen des Braunkohleabbaus auf Mensch und Umwelt, von den notwendigen Umsiedlungen ganzer Dörfer bis hin zu den Maßnahmen zum Immissionsschutz, die darauf abzielen, Staub- und Lärmentwicklung zu minimieren. Es werden die volkswirtschaftliche Bedeutung der Braunkohle als heimischer Energieträger, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Beiträge zur Stromerzeugung durch umweltfreundlichere Technologien wie Rauchgasentschwefelungsanlagen und verbesserte Verbrennungstechniken erläutert. Tauchen Sie ein in die Welt der Braunkohle und entdecken Sie die vielfältigen Facetten dieses umstrittenen, aber wichtigen Rohstoffs, der die deutsche Energieversorgung seit Jahrzehnten prägt. Erfahren Sie, wie die Braunkohleförderung die Landschaft verändert und wie innovative Ansätze dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Eine informative Lektüre für alle, die sich für Geologie, Technik, Energiepolitik und die Zukunft unserer Energieversorgung interessieren. Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Braunkohle, ihre Gewinnung, ihre Verwendung und die damit verbundenen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Es ist ein Muss für jeden, der die Energiewende in Deutschland verstehen und mitgestalten will. Lassen Sie sich von den beeindruckenden Bildern und fundierten Informationen in die Welt der Braunkohle entführen.
Braunkohle
Was ist Braunkohle?
Braunkohle liegt im Grad der Inkohlung zwischen Torf und Kohle. Braunkohle ist geologisch relativ jung; sie wurde in der Kreidezeit und im Tertiär gebildet. Meist ist sie braunschwarz und hat eine deutlich faserige, holzartige Struktur. Braunkohle hat einen geringeren Heizwert als Steinkohle, da sie relativ viel Wasser (10 bis 75 %) und relativ wenig Kohlenstoff (55 bis 77 %) enthält. Aufgrund ihres hohen Gehalts an flüchtigen Stoffen (45 bis 53 %) zerfällt sie an der Luft sehr rasch, so dass es sich nicht lohnt die Rohkohle über längere Strecken zu transportieren. Deshalb liegen die Braunkohlenkraftwerke in der Nähe der Tagebaue. Der Heizwert von Braunkohle beträgt 17 211 Kilojoule pro Kilogramm.
Die Entstehung der Braunkohle
Braunkohle waren früher Bäume, Sträucher, Farne und Gräser. Das war 20 Millionen Jahren im Erdzeitalter des Tertiärs. Das Klima war deutlich wärmer und feuchter als heute. Diese flache Landschaft lag nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Dort erstreckten sich Flussläufe, tote Flussarme, Seen, Lagunen und Sümpfe. Wenn die Bäume, Sträucher und Gräser alt wurden, starben sie ab und machten neuen Pflanzen Platz. Die verwelkten Blätter und morschen Stämme fielen in das Wasser. In den Sümpfen und Mooren konnten die abgestorbenen Pflanzen nicht vermodern, weil sie durch das Wasser luftdicht abgeschlossen waren. Mikroorganismen zersetzten die Pflanzenreste zunächst zu Torf. Dazu brauchten sie den Sauerstoff aus der Luft nicht. Auf dieser Torfschicht wuchsen wieder neue Pflanzen. Wachsen, Absterben, Versinken im feuchten Untergrund: dieser Kreislauf wiederholte sich immer wieder. Denn gleichzeitig senkte sich der Boden über viele Millionen Jahre ganz allmählich ab. Die Torfschicht wurde immer dicker sowie dichter und war bis zu 279 m stark.
Im Laufe der Jahrmillionen änderte sich das Bild. Es wurde allmählich kühler. Und die Vorläuferin der Nordsee drang tief in die Niederreihnische Bucht vor. Somit lagerte das Meer auf der Torfschicht ein dickes Paket aus Sand und Kies ab. Diese Decke wurde immer schwerer und presste den lockeren feuchten Torf zusammen. Durch den hohen Druck wurde der Torf wie ein Schwamm ausgepresst und zu Braunkohle verdichtet. Die Erdmassen über der Kohle heißen Abraum.
Abbau der Braunkohle und was danach geschieht
Um die Braunkohle fördern zu können, muss der Grundwasserspiegel bis unter den tiefsten Punkt eines Tagebaus abgesenkt werden.
In den Tagebauen tragen sogenannte Schaufelradbagger zunächst die obere Bodenschicht, den fruchtbaren Löslehm, ab und fördern anschließend den sogenannten Abraum: Ton, Kies und Sand. Anschießend kann man die Kohle baggern. Für diese Arbeiten benutzen die Bagger ihr Schaufelrad. Der Tagebau ist treppenförmig angelegt. Auf jeder Stufe arbeitet ein Schaufelradbagger.
Die größten Bagger der Rheinbraun AG sind 96 m hoch, 225 m lang, 13 t schwer, 200 Millionen DM wert und werden von fünf Mann bedient. Die 24 Bagger der Firma können pro Jahr bis zu 120 Millionen Tonnen Braunkohle gewinnen.
Braunkohle kann im Reinland nur in offenen Gruben, also in Tagebauen, abgebaut werden. Denn über der Kohle liegt lockeres Erdreich. Ein unterirdischer wäre im Rheinischen Braunkohlenrevier nur mit riesigem Aufwand möglich. Doch dann würde sich die Kohleförderung nicht mehr lohnen.
Kilometerlange Förderbänder führen von den Schaufelradbaggern zu einem Verteiler: dem Bandsammelpunkt. An dieser zentralen Stelle wird gesteuert, wohin das Material auf den Förderbändern gelangen soll. Braunkohle kommt zur Zwischenlagerung in die 600 000 t fassende Kohlebunkergräben oder direkt in das nahgelegene Kraftwerk. Dagegen gelangt der Abraum auf einem anderen Förderband zu einem Absetzer.
Damit schüttet der Absetzer den hinteren Teil des Tagebaus wieder zu, wo die Braunkohle längst abgebaggert ist. Eine Bandanlage besteht aus einem insgesamt 245 kilometerlangem Förderband aus Gummi. Das Förderband ist wie eine Rinne geformt und wird von Elektromotoren angetrieben.
Für lange Strecken außerhalb der Tagebaue werden Züge eingesetzt. Sie bringen das Material zu weiter entfernten Kraftwerken und Fabriken. Die Rheinbraun-Werksbahn ist eine der größten der Welt, was die Beförderungsmenge angeht.
Lös, Kies, Sand und Ton werden in grauen , achtachsigen Waggongs transportiert. Braunkohle dagegen in braunen vierachsigen Waggongs. Die unterschiedlichen Waggons sind nötig, weil Abraum sehr viel schwerer ist als Kohle. Deshalb dürfen die Rheinbraun- Werksbahnen nicht auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn fahren.
Dafür können aber Züge der DB AG auf Rheinbraun-Gleisen rollen, denn die Spurbreiten sind gleich.
Immissionsschutz
Gezielte Maßnahmen mindern die Staub- und Lärmentwicklung aus dem Tagebau und minimieren damit die Belästigung der in Nachbarschaft zum Betrieb lebenden Menschen: Freigelegt Abraum- und Kohleflächen werden durch bewegliche Regnerautomaten feucht gehalten oder durch Einsaat von Gras, Raps oder Getreide befestigt. Düsen am Schaufelrad des Baggers und an den Bandübergabestellen versprühen ständig Wasser und verhindern, dass der bei Gewinnung und Transport von Kohle entstehende Staub aufwirbelt. Am Rande des Tagebaus sprühen ungefähr 150 Beregnungsmaste feine Wasserschleier aus, die den Staub niederschlagen. Zur Lärmbekämpfung werden Antriebe von Baggern, Absetzern und Bandanlagen geräuschdämmend gekapselt. Die Bandanlagen werden mit lärmarmen Rollen ausgerüstet. Darüber hinaus schützen Erdwelle am Tagebaurand nahliegende Orte vor Lärm.
Umsiedlung
Es kommt nicht selten vor, dass ein Dorf auf einen Braunkohleboden liegt. Daher kommt es zu Umsiedlungen der Bewohner eines ganzen Ortes. Jedoch bringt dies einige Probleme mit sich. Denn hierbei geht es nicht nur um materielle Besitze, der natürlich von Rheinbraun entschädigt wird, in der Höhe wie ein unparteiischer Gutachter den Wert eines Grundstückes schätzt. Es geht auch um ideelle werte, wie Nachbarschaft, Heimat und Tradition, die sich mit Geld nicht bemessen lassen können.
Aus diesem Grund versucht Rheinbraun so viele Bewohner eines Ortes möglichst gleichzeitig zusammen umzusiedeln. Alle Umsiedler waren und sind bei der Wahl ihres neuen Wohnortes und bei der Verwendung ihrer Entschädigungssumme völlig frei.
Rekultivierung
Nachdem die Braunkohle in einem Gebiet ausgeschöpft sind, beginnt dort die Wiederherstellung der Landschaft. Was die Bagger auf der Gewinnungsseite an Abraum abtragen, schichten Absetzer auf der Verkippungsseite auf und bereiten damit der Rekultivierung den Boden. Dabei ist die Rekultivierung nicht der Versuch, die Natur nachzubauen. Der Mensch kann nur eine Starthilfe geben. Die wesentliche Arbeit leistet die Natur selber.
Braunkohle und Volkswirtschaft
Deutschland muss die meisten Energie-Rohstoffe aus dem Ausland importieren. So deckt Deutschland seinen Energienbedarf zu 60% aus importiertem Mineralöl, Erdgas und Uran. Die Braunkohle ist dagegen ein heimischer Energieträger. Die Vorräte reichen noch für Generationen ihren Beitrag zur Energieversorgung leiste, ohne auf Subventionen angewiesen zu sein. Braunkohle ist der in Deutschland einziger Energieträger, der im internationalen Preisvergleich bestehen kann.
Die Braunkohleförderung der Rheinbraun AG liegt derzeit bei etwa 100 Millionen Tonnen pro Jahr.
40 000 Arbeitsplätze im Bergbau, in den Kraftwerken und in den Zulieferungsbetrieben sind damit über Jahrzehnte gesichert.
Allein die Rheinbraun AG beschäftigt rund 11 500 Mitarbeiter. Rund 2 300 von ihnen arbeiten im Bereich der Betriebsdirektion Tagebau Garzweiler.
Stromerzeugung
Etwa 85% der Braunkohle werden in den Kraftwerken der RWE Energie AG zur Stromerzeugung eingesetzt. Zur Zeit beträgt die installierte Leistung der fünf RWE- Kraftwerke im Revier fast 10 000 Megawatt. Sie sind rund um die Uhr mit konstanter Leistung am Netz, um den Grundbedarf des Strombedarfs sichern zu helfen. Dabei arbeiten sie umweltfreundlich: Die großen Kraftwerke sind an Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen angeschlossen, die den Schwefelausstoß, der mitverantwortlich für den ,,sauren Regen" auf ein Zehntel der früheren Menge reduziert haben. Und dank verbesserter Verbrennungstechniken wurde der Stickoxidausstoß auf ein Viertel gedrosselt.
Meine eigene Meinung über die Exkursion zur Rheinbraun AG
Meiner Meinung nach war die Führung durch den Tagebau interessant. Man bekam sehr viele Informationen und wurde mit in die Unterhaltung integriert. Das heißt, dass man Fragen stellen, schätzen und antworten konnte. Auch war es beeindruckend 20 Meter vor einem Schaufelradbagger zu stehen, wobei man sich im Bus als ,,Winzling" vorkam. Allerdings gefiel mir die Multimediashow nicht so sehr, da sie einfach nur das Gebiet der Rheinbraun AG beschrieb.
Häufig gestellte Fragen zu Braunkohle
Was ist Braunkohle?
Braunkohle ist ein fossiler Brennstoff, der im Grad der Inkohlung zwischen Torf und Steinkohle liegt. Sie ist geologisch relativ jung und hat einen geringeren Heizwert als Steinkohle, da sie mehr Wasser und weniger Kohlenstoff enthält.
Wie entsteht Braunkohle?
Braunkohle entsteht aus abgestorbenen Pflanzenresten wie Bäumen, Sträuchern, Farnen und Gräsern, die sich über Millionen von Jahren unter Druck und Luftabschluss in Torf und schließlich in Braunkohle verwandeln. Dieser Prozess fand hauptsächlich im Erdzeitalter des Tertiärs statt.
Wie wird Braunkohle abgebaut?
Braunkohle wird im Tagebau abgebaut. Dabei werden zunächst die oberen Bodenschichten (Löslehm und Abraum) mit Schaufelradbaggern abgetragen, bevor die Kohle selbst gebaggert werden kann. Der Grundwasserspiegel muss abgesenkt werden, um den Abbau zu ermöglichen.
Was geschieht nach dem Abbau der Braunkohle?
Nach dem Abbau der Braunkohle wird die Landschaft rekultiviert. Das bedeutet, dass der Abraum wieder aufgeschüttet wird und die Flächen neu bepflanzt werden. Ziel ist es, die Natur bei der Wiederherstellung der Landschaft zu unterstützen.
Welche Umweltauswirkungen hat der Braunkohleabbau?
Der Braunkohleabbau hat verschiedene Umweltauswirkungen, darunter Staub- und Lärmentwicklung. Es werden Maßnahmen zur Immissionsschutz ergriffen, um diese Belastungen zu minimieren. Außerdem kann es zu Umsiedlungen von Bewohnern kommen, wenn Dörfer auf Braunkohlevorkommen liegen.
Welche Bedeutung hat Braunkohle für die Volkswirtschaft?
Braunkohle ist ein heimischer Energieträger und trägt zur Energieversorgung Deutschlands bei. Sie sichert Arbeitsplätze im Bergbau, in Kraftwerken und Zulieferungsbetrieben.
Wie wird Braunkohle zur Stromerzeugung genutzt?
Etwa 85% der Braunkohle werden in Kraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt. Die Kraftwerke sind mit Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen ausgestattet, um den Schwefelausstoß zu reduzieren.
Was sind die größten Bagger der Rheinbraun AG?
Die größten Bagger der Rheinbraun AG sind 96 m hoch, 225 m lang, 13 t schwer und können pro Jahr bis zu 120 Millionen Tonnen Braunkohle gewinnen.
Was passiert mit dem Abraum im Tagebau?
Der Abraum wird mit Förderbändern zu Absetzern transportiert und im hinteren Teil des Tagebaus wieder aufgeschüttet, wo die Braunkohle bereits abgebaut wurde.
Was wird getan, um Staub und Lärm im Tagebau zu reduzieren?
Es werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Staub und Lärm zu reduzieren, darunter das Feuchthalten von Flächen, der Einsatz von Düsen zur Staubbindung, die Kapselung von Antrieben und der Bau von Erdwällen.
Was passiert mit Dörfern, die auf Braunkohlevorkommen liegen?
Die Bewohner der betroffenen Dörfer werden umgesiedelt. Sie erhalten eine Entschädigung für ihren materiellen Besitz und werden bei der Wahl ihres neuen Wohnortes unterstützt.
Wie viele Arbeitsplätze sind durch die Braunkohleförderung gesichert?
Durch die Braunkohleförderung sind etwa 40.000 Arbeitsplätze im Bergbau, in den Kraftwerken und in den Zulieferungsbetrieben gesichert.
- Quote paper
- Ngoc Kha Pham (Author), 2000, Die Entstheung von Braunkohle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98179