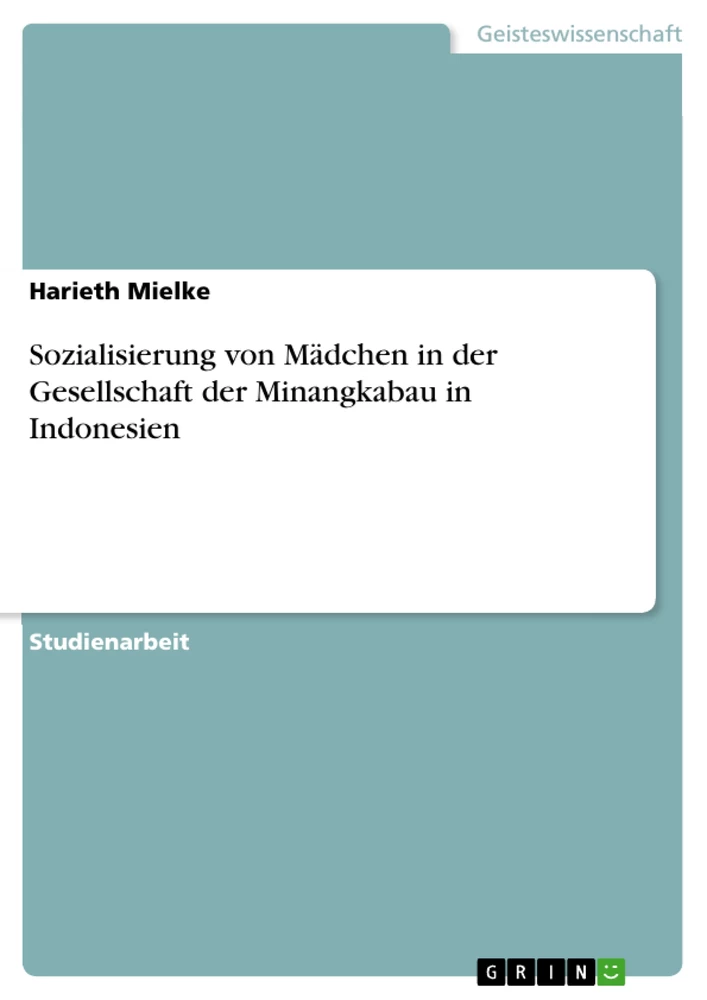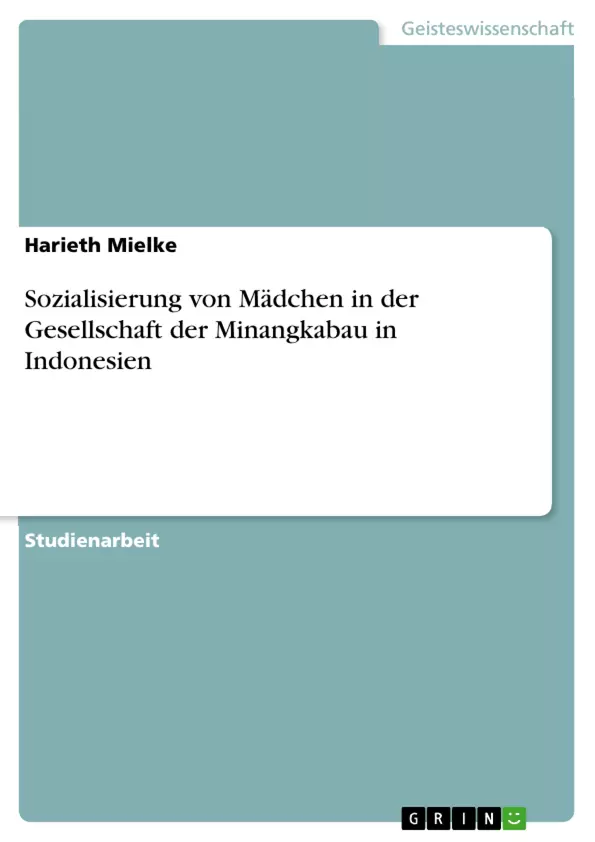Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der primären Sozialisation durch Eltern und Familie, und der sekundären Sozialisation durch die Schule bei den jungen weiblichen Mitgliedern (0-12 Jahre) der matrilinearen Gesellschaft der Minangkabau. Es soll die Frage beantwortet werden, welche Erziehungs- und Bildungsprozesse sich auf die Identität dieser jungen weiblichen Mitglieder auswirken. Im ersten Teil der Hausarbeit wird die Gesellschaft der Minangkabau vorgestellt und deren kulturspezifische Erziehungsmuster erläutert, und im zweiten Teil wird die Erziehung und Bildung in der Schule aufgeführt.
Als Sozialisation bezeichnet man den lebenslangen Erwerb von Werten, Normen, Verhaltensmustern und Einstellungen, der die Übernahme einer sozialen Rolle ermöglicht. Die Sozialisation hilft dem Individuum, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden und seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Sozialisation findet in verschiedenen Phasen der Entwicklung sowie in unterschiedlichen Umgebungen statt. Aus diesem Grund wird die Sozialisation in die primäre Sozialisation, die sekundäre und die tertiäre Sozialisation unterschieden. Die primäre Sozialisation findet statt durch Eltern und Familie als Instanz, die sekundäre Sozialisation findet statt durch Kindergarten, Schule und Peergroup. Die tertiäre Sozialisation geschieht durch Erwachsene in Beruf, Hochschule, Militär und Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturspezifische Erziehungsmuster
- Das Prinzip des Ängstigens
- Das Prinzip des Beschämens
- Geschlechtsspezifische Elemente der Erziehung
- Erziehung in der Schule
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sozialisation junger Mädchen (0-12 Jahre) in der matrilinearen Gesellschaft der Minangkabau in Indonesien. Der Fokus liegt auf der primären Sozialisation innerhalb der Familie und der sekundären Sozialisation in der Schule. Ziel ist es, die Erziehungs- und Bildungsprozesse zu analysieren, die die Identität dieser jungen Frauen prägen.
- Matrilineare Gesellschaft der Minangkabau und ihre kulturellen Besonderheiten
- Kulturspezifische Erziehungsmuster (Ängstigen und Beschämen)
- Einfluss der Schule auf die Sozialisation
- Vergleich mit anderen matrilinearen Gesellschaften
- Entwicklung der Identität junger Mädchen im Kontext von Tradition und Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Begriff der Sozialisation in ihren verschiedenen Phasen (primär, sekundär, tertiär) und benennt den Fokus der Arbeit: die Sozialisation junger Mädchen der Minangkabau, betrachtet aus der Perspektive der primären Sozialisation (Familie) und der sekundären Sozialisation (Schule). Es wird die Forschungsfrage nach den Erziehungs- und Bildungsprozessen formuliert, die die Identität dieser Mädchen beeinflussen.
Kulturspezifische Erziehungsmuster: Dieses Kapitel beschreibt die Minangkabau-Gesellschaft als die weltweit größte matrilineare und matrilokale Gesellschaft und beleuchtet den Spannungsfeld zwischen matrilinearen Traditionen und patriarchalischen Einflüssen des Islam. Es werden kulturspezifische Erziehungsmuster analysiert, die darauf abzielen, Kindern Werte, Normen und Verhaltensmuster zu vermitteln, die für ein harmonisches Zusammenleben innerhalb der Gemeinschaft unerlässlich sind. Die Bedeutung von sozialer Integration und der Anpassung an die kulturellen Regeln wird hervorgehoben.
Das Prinzip des Ängstigens: Dieses Unterkapitel fokussiert sich auf eine spezifische Erziehungsmethode der Minangkabau, nämlich das "Ängstigen" von Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Durch das Erzählen von Geschichten über Gefahren der Außenwelt wird versucht, Gehorsam und die Einhaltung von Regeln zu erzwingen. Die Funktion dieser Methode liegt in der Schaffung eines sicheren und geschützten Raumes innerhalb der Familie, der gleichzeitig ein starkes Abhängigkeitsverhältnis erzeugt. Ein Vergleich mit der Sozialisation in einer anderen matrilinearen Gesellschaft unterstreicht die kulturelle Variabilität dieser Prozesse.
Das Prinzip des Beschämens: Hier wird eine weitere Methode zur Sozialisation beschrieben: das Beschämen von Kindern in der Öffentlichkeit. Durch das öffentliche Auslachen wird versucht, die Einhaltung kultureller Regeln zu erzwingen und ein Gefühl von Scham als inneres Kontrollinstrument zu etablieren. Die soziale Kontrolle durch die Gemeinschaft spielt hier eine entscheidende Rolle.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Minangkabau, Matrilinearität, Matrilokalität, Indonesien, Erziehungsmuster, Primäre Sozialisation, Sekundäre Sozialisation, Identität, Islam, Patriarchat, Angst, Scham, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sozialisation junger Mädchen in der Minangkabau-Gesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sozialisation junger Mädchen (0-12 Jahre) in der matrilinearen Gesellschaft der Minangkabau in Indonesien. Der Fokus liegt auf der primären Sozialisation innerhalb der Familie und der sekundären Sozialisation in der Schule. Ziel ist die Analyse der Erziehungs- und Bildungsprozesse, welche die Identität dieser jungen Frauen prägen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die matrilineare Gesellschaft der Minangkabau und ihre kulturellen Besonderheiten, kulturspezifische Erziehungsmuster (insbesondere „Ängstigen“ und „Beschämen“), den Einfluss der Schule auf die Sozialisation, Vergleiche mit anderen matrilinearen Gesellschaften und die Entwicklung der Identität junger Mädchen im Kontext von Tradition und Moderne.
Welche Methode der Sozialisation wird im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert zwei spezifische Erziehungsmuster: das „Ängstigen“ von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren durch das Erzählen von Geschichten über Gefahren der Außenwelt, und das „Beschämen“ von Kindern in der Öffentlichkeit zur Durchsetzung kultureller Regeln. Beide Methoden werden im Hinblick auf ihre Funktion und Wirkung auf die Kinder untersucht und mit anderen matrilinearen Gesellschaften verglichen.
Welche Phasen der Sozialisation werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die primäre Sozialisation (Familie) und die sekundäre Sozialisation (Schule). Der Begriff der Sozialisation in seinen verschiedenen Phasen (primär, sekundär, tertiär) wird in der Einleitung erläutert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu kulturspezifischen Erziehungsmustern (inkl. Unterkapiteln zu „Ängstigen“ und „Beschämen“), ein Kapitel zur Erziehung in der Schule und eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sozialisation, Minangkabau, Matrilinearität, Matrilokalität, Indonesien, Erziehungsmuster, Primäre Sozialisation, Sekundäre Sozialisation, Identität, Islam, Patriarchat, Angst, Scham, Kulturvergleich.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Erziehungs- und Bildungsprozesse zu analysieren, die die Identität junger Mädchen in der Minangkabau-Gesellschaft prägen. Es soll ein Verständnis für die kulturellen Einflüsse auf die Sozialisation und die Entwicklung der Identität dieser Mädchen geschaffen werden.
Wie wird der Einfluss des Islam berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen den matrilinearen Traditionen der Minangkabau und den patriarchalischen Einflüssen des Islam, die sich auf die Sozialisation der jungen Mädchen auswirken.
Welche Rolle spielt die Gemeinschaft?
Die soziale Kontrolle durch die Gemeinschaft spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Erziehungsmethode des „Beschämens“ von Kindern in der Öffentlichkeit.
Gibt es einen Vergleich mit anderen Gesellschaften?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen Vergleich mit anderen matrilinearen Gesellschaften, um die kulturelle Variabilität der beschriebenen Sozialisationsprozesse aufzuzeigen.
- Citation du texte
- Harieth Mielke (Auteur), 2017, Sozialisierung von Mädchen in der Gesellschaft der Minangkabau in Indonesien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981315