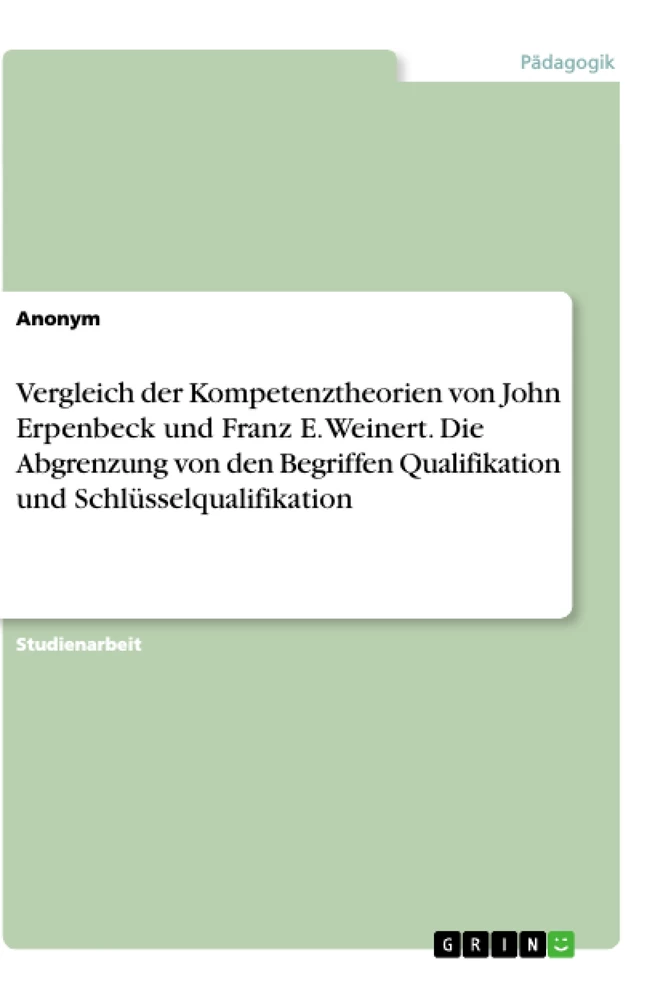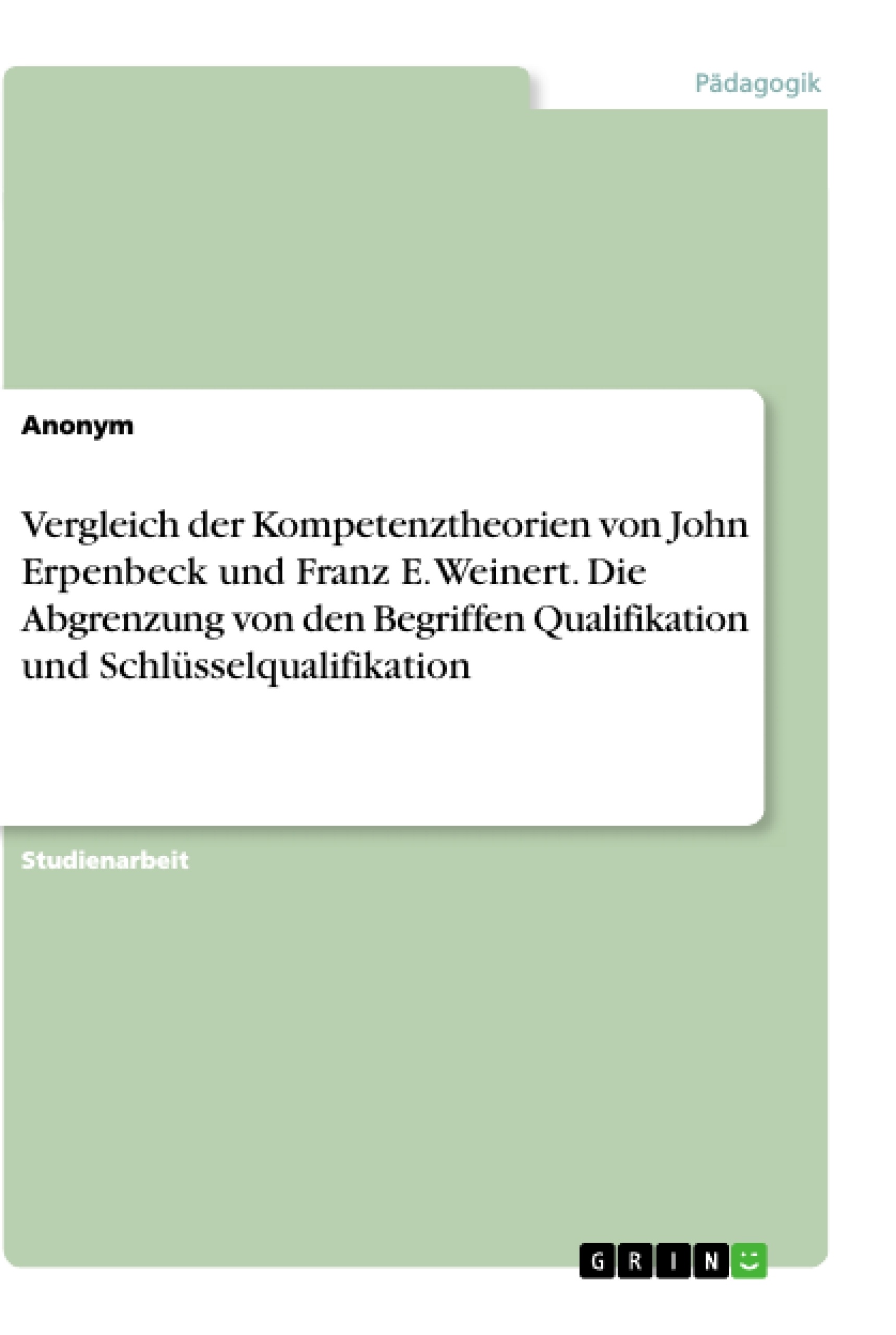Spätestens durch die arbeitsorganisatorischen Entwicklungen der 1980er Jahre vermehrt ins Zentrum von Gesprächen und besonders Forschung gerückt, ist das Konzept von Kompetenzen und deren Erwerb bzw. Entwicklung inzwischen nicht mehr aus dem deutschen Bildungssystem wegzudenken. Besonders im Bereich der beruflichen und Weiterbildung ist es zu einer der zentralen Kernstrukturen geworden. Doch auch auf allen anderen Bildungsebenen und auch in zahlreichen anderen Ländern war diese Entwicklung zu beobachten, was sich besonders in der Entstehung der vergleichenden internationalen Schulleistungsstudien wie PISA und TIMSS und internationaler Bildungsforschung bemerkbar macht. Der Ausdruck „Kompetenz“ findet sich heutzutage in allen Lebensbereichen, in Stellenausschreibungen genauso wie in Werbeanzeigen oder Schulcurricula. Weit entfernt jedoch von seiner ursprünglichen Bedeutung der „Zuständigkeit“, ist das Konzept inzwischen in unserer Gesellschaft omnipräsent und weckt dabei zahlreiche Assoziationen. Gleichzeitig ist es nur schwer zu fassen und noch schwerer theoretisch abzustecken und abzugrenzen von den in vielerlei Hinsicht ähnlichen Begriffen der Qualifikation im Allgemeinen und Schlüsselqualifikationen im Besonderen. Diese Arbeit soll eine mögliche Abgrenzung untersuchen und dabei auftretende Schwierigkeiten beleuchten. Zunächst werden hierzu die Kompetenzmodelle von John Erpenbeck und Franz E. Weinert vorgestellt und verglichen, bevor gängige Definitionen von Qualifikation und Schlüsselqualifikation untersucht werden. Im Anschluss sollen diese von den zuvor ausgearbeiteten Modellen abgegrenzt und dabei etwaige Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Kompetenz nach Erpenbeck
- 3 Kompetenz nach Weinert und Vergleich mit Erpenbecks Theorie
- 4 Vergleich von Qualifikation und Kompetenz
- 5 Vergleich von Schlüsselqualifikation und Kompetenz
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Kompetenztheorien von John Erpenbeck und Franz E. Weinert und grenzt diese von den Begriffen Qualifikation und Schlüsselqualifikation ab. Die Zielsetzung ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Konzepte zu beleuchten und auftretende Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zu untersuchen.
- Vergleich der Kompetenzmodelle von Erpenbeck und Weinert
- Untersuchung der Definitionen von Qualifikation und Schlüsselqualifikation
- Abgrenzung von Kompetenz, Qualifikation und Schlüsselqualifikation
- Analyse der Messbarkeit von Kompetenzen
- Kritik an Erpenbecks Kompetenzmodell im Hinblick auf Wertevermittlung und ökonomische Ausrichtung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kompetenz ein und betont dessen zunehmende Bedeutung im deutschen Bildungssystem, insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung. Sie hebt die Omnipräsenz des Begriffs "Kompetenz" hervor, gleichzeitig aber auch seine theoretische Unbestimmtheit und die Schwierigkeit, ihn von ähnlichen Begriffen wie Qualifikation und Schlüsselqualifikation abzugrenzen. Die Arbeit kündigt den Vergleich der Kompetenzmodelle von Erpenbeck und Weinert sowie die Abgrenzung von Qualifikation und Schlüsselqualifikation an.
2 Kompetenz nach Erpenbeck: Dieses Kapitel präsentiert Erpenbecks Kompetenzdefinition als die "Fähigkeiten einer Person zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in für sie bisher neuen Situationen". Der Fokus liegt auf selbstständigem Handeln in unbekannten Situationen, um kreative Lösungen zu finden. Erpenbeck unterscheidet vier Basiskompetenzen (personale, Aktivitäts- und Umsetzungskompetenz, Fach- und Methodenkompetenz sowie sozial-kommunikative Kompetenz), die er als erlernbar und erweiterbar beschreibt, jedoch auch betont, dass sie kontextabhängig sind. Das Kapitel diskutiert kritisch die Messbarkeit von Kompetenzen nach Erpenbeck und hinterfragt die Wertevermittlung als essentiellen Bestandteil der Kompetenzbildung.
Schlüsselwörter
Kompetenz, Qualifikation, Schlüsselqualifikation, Erpenbeck, Weinert, Kompetenzmodelle, Selbstorganisation, Handlungsfähigkeit, Messbarkeit, Wertevermittlung, Bildungssystem, Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Kompetenzmodelle von Erpenbeck und Weinert
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Kompetenzmodelle von John Erpenbeck und Franz E. Weinert und grenzt diese von den Begriffen Qualifikation und Schlüsselqualifikation ab. Sie untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Konzepte und analysiert Schwierigkeiten bei deren Abgrenzung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Darstellung der Kompetenzmodelle, einen Vergleich der Modelle, eine Abgrenzung zu Qualifikation und Schlüsselqualifikation, ein Fazit und Schlüsselwörter.
Welche Kompetenzmodelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Kompetenzmodelle von John Erpenbeck und Franz E. Weinert. Erpenbecks Modell fokussiert auf selbstorganisiertes, kreatives Handeln in neuen Situationen, während Weinert's Modell (obwohl nicht explizit detailliert dargestellt) als Gegenstück dient, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszustellen.
Wie definiert Erpenbeck Kompetenz?
Erpenbeck definiert Kompetenz als die "Fähigkeiten einer Person zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in für sie bisher neuen Situationen". Er unterteilt Kompetenzen in vier Basiskompetenzen: personale, Aktivitäts- und Umsetzungskompetenz; Fach- und Methodenkompetenz; sowie sozial-kommunikative Kompetenz. Diese werden als erlernbar und erweiterbar, aber auch kontextabhängig beschrieben.
Wie werden Qualifikation und Schlüsselqualifikation abgegrenzt?
Die Arbeit grenzt die Konzepte von Kompetenz, Qualifikation und Schlüsselqualifikation voneinander ab. Obwohl die genauen Abgrenzungen im Detail nicht im Preview aufgeführt sind, wird deutlich, dass die Arbeit diese Unterschiede analysiert und untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Vergleich der Kompetenzmodelle von Erpenbeck und Weinert, Untersuchung der Definitionen von Qualifikation und Schlüsselqualifikation, Abgrenzung von Kompetenz, Qualifikation und Schlüsselqualifikation, Analyse der Messbarkeit von Kompetenzen und Kritik an Erpenbecks Kompetenzmodell im Hinblick auf Wertevermittlung und ökonomische Ausrichtung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst mindestens sechs Kapitel: Einleitung, Kompetenz nach Erpenbeck, Kompetenz nach Weinert und Vergleich mit Erpenbecks Theorie, Vergleich von Qualifikation und Kompetenz, Vergleich von Schlüsselqualifikation und Kompetenz und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Kompetenz, Qualifikation, Schlüsselqualifikation, Erpenbeck, Weinert, Kompetenzmodelle, Selbstorganisation, Handlungsfähigkeit, Messbarkeit, Wertevermittlung, Bildungssystem und Wirtschaft.
Welche Kritikpunkte an Erpenbecks Modell werden angesprochen?
Die Arbeit kritisiert Erpenbecks Kompetenzmodell im Hinblick auf seine Messbarkeit und die Rolle der Wertevermittlung und ökonomischen Ausrichtung. Es wird hinterfragt, wie gut sich Kompetenzen nach Erpenbecks Definition messen lassen und welche Bedeutung die Vermittlung von Werten im Rahmen der Kompetenzbildung hat.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Vergleich der Kompetenztheorien von John Erpenbeck und Franz E. Weinert. Die Abgrenzung von den Begriffen Qualifikation und Schlüsselqualifikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981254