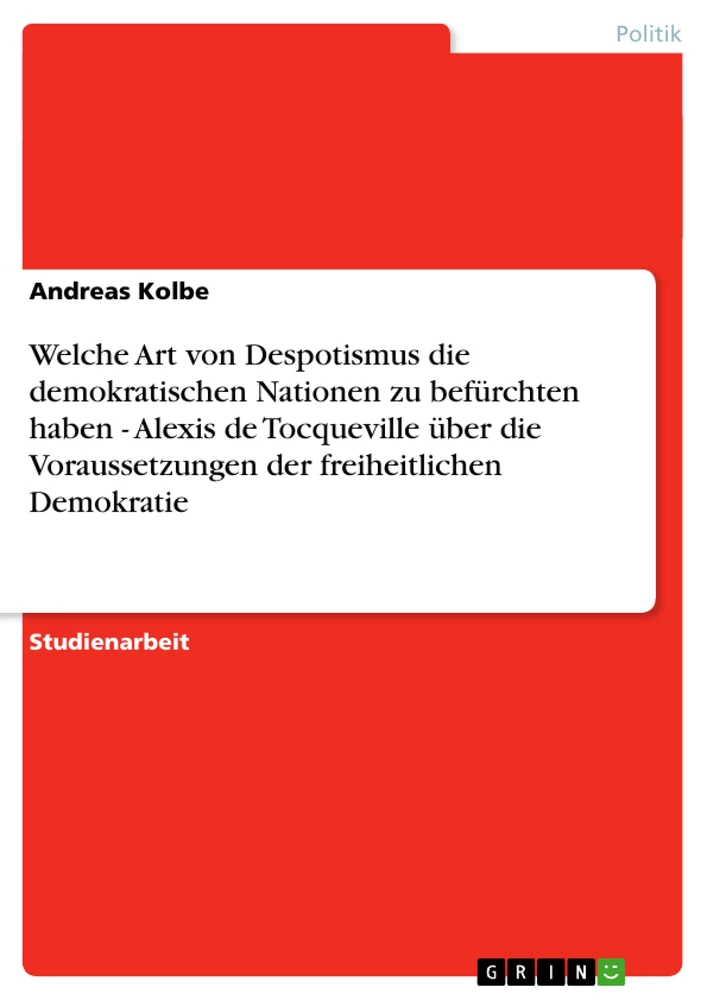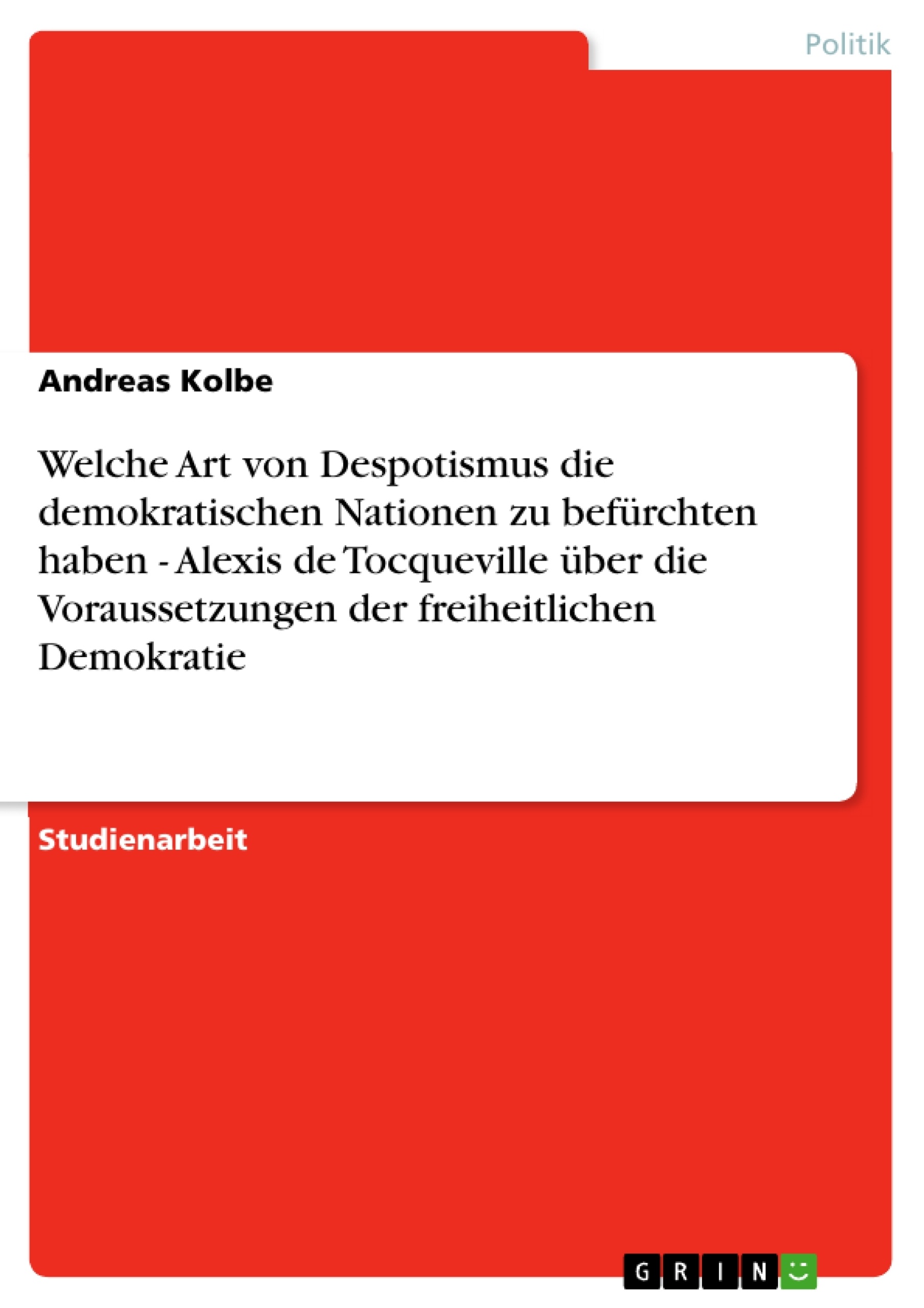Droht uns in der Postmoderne eine neue Form des Despotismus, unbemerkt und subtil, inmitten unseres vermeintlichen Wohlstands und unserer technologischen Errungenschaften? Klaus Hornungs Analyse, inspiriert von Alexis de Tocquevilles bahnbrechendem Werk "Über die Demokratie in Amerika", wirft ein beunruhigendes Licht auf die potenziellen Gefahren, die in egalitären Wohlfahrtsdemokratien lauern. Hornung zieht Parallelen zwischen dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Französischen Revolution, um die Fragilität westlicher Demokratien aufzuzeigen, die seiner Meinung nach geistig, politisch, technokratisch und ökonomisch erschöpft sind. Er greift Tocquevilles zentrale Fragen auf: Sind demokratische Gesellschaften der Zukunft in der Lage, freiheitlich zu regieren? Welche Lehren können wir aus der Geschichte der Vereinigten Staaten ziehen? Tocqueville erkannte in der Demokratie zwei Gesichter: Freiheit und Despotismus. Hornung argumentiert, dass die Postmoderne eine Form von vormundschaftlichem Despotismus begünstigt, in der die Gesellschaft institutionell zentralisiert ist und der Fokus auf materielle Bedürfnisbefriedigung die Menschen versklavt. Er betont die Bedeutung von Selbstverwaltung, Recht und Pressefreiheit als Bollwerke gegen den Mehrheitsdespotismus und warnt vor der Gefahr, dass ein übersteigertes Streben nach Wohlstand den Freiheitswillen untergräbt. Diese tiefgründige Auseinandersetzung mit Tocquevilles Ideen fordert uns heraus, die Fundamente unserer freiheitlichen Ordnung kritisch zu hinterfragen und die subtilen Mechanismen zu erkennen, die zu einer neuen Form der Unfreiheit führen könnten. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für politische Philosophie, Demokratie und die Zukunft unserer Gesellschaft interessieren, insbesondere im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Dieses Werk regt dazu an, über die Wechselwirkungen von Freiheit, Gleichheit und Wohlstand nachzudenken und die Lehren der Vergangenheit für die Herausforderungen der Gegenwart zu nutzen, um eine informierte und engagierte Bürgerschaft zu fördern. Entdecken Sie die zeitlose Relevanz von Tocquevilles Warnungen und Hornungs Analyse für das 21. Jahrhundert, ein Muss für jeden, der die Zukunft der Demokratie aktiv mitgestalten möchte. Lassen Sie sich von dieser kritischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen unserer Gesellschaft inspirieren und entwickeln Sie ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Freiheit, Verantwortung und politischer Macht.
REZENSION
Klaus Hornung.1994. Welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben - Alexis de Tocqueville über die Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie. In: Zeitschrift für Politik 41: 347-358.
1. EINLEITUNG
Klaus Hornung sieht die westlichen Demokratien am Ende, gefährdet und einem neuen Despotismus verfallend. Auf Grund dessen verweist er auf Alexis de Tocqueville und erinnert an seine Botschaften und Belehrungen, die die Sicherung von Freiheit und die Gefahr, die vom Despotismus droht, anbelangen.1 Hornung übernahm für seine Abhandlung die gleichnamige Überschrift eines Kapitels aus Tocqueville´s Werk.2 Ich werde im folgenden den Text zusammenfassen, um heraus zu kristallisieren, welche Darlegungen seitens Tocqueville für Hornung von Bedeutung sind. Im Anschluss daran werde ich mich mit der Betrachtungsweise von Hornung kritisch auseinandersetzen, insbesondere mit seiner Idee, sich auf Tocqueville zu beziehen und mit seiner Ansicht, dass die Arten des Tocqueville´schen Despotismus in der Postmoderne eine Renaissance erfahren könnten.
2. ZUSAMMENFASSUNG
Klaus Hornung bezieht sich bei seinen Überlegungen, welche Arten von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben, auf Tocqueville´s ,,Über die Demokratie in Amerika", mit dem Ziel einen neuen, aktualitätsbezogenen Blick auf dieses Werk zu werfen. Dabei konzentriert sich Hornung auf Tocqueville´s Analyse, wie sich eine egalitäre Wohlfahrtsdemokratie despotisch entarten kann. Der Autor zieht bezüglich des Zusammenbruchs der Sowjetunion3 Parallelen zu der Französischen Revolution4 ; er sieht in beiden einen ebenbürtigen weltgeschichtlichen Umbruch. Seiner Ansicht nach sind die westlichen Demokratien geistig und politisch sowie technokratisch und ökonomisch verbraucht. Nach der Wende scheint es ihnen an Zukunfts- bzw. Zielperspektiven zu fehlen, die wohlfahrtsstaatliche Ordnung kann in alter Weise nicht weiter existieren. Hornung greift die beiden Schlüsselfragen der ,,Demokratie in Amerika" auf: Werden die Demokratischen Gesellschaften der Zukunft in der Lage sein freiheitlich zu regieren?[5] Welche Lehren erteilte in dieser Hinsicht die damals noch einzige demokratische Republik der Vereinigten Staaten?[5]
Für Tocqueville hatte die Demokratie zwei Gesichter, denn aus der Demokratie können Freiheit und Despotismus hervortreten. Sein Anliegen bestand darin, herauszufinden wie aus der Demokratie die Freiheit entspringen kann. Die wesentliche institutionelle Voraussetzung für die Freiheit ist nach Tocqueville eine gemischte Regierung bzw. Gewaltenteilung. Die Mehrheit bildet den Kern der Demokratie. Eine Mehrheitsdemokratie kann leicht in despotische Demokratie umschlagen, da die Omnipotenz der Mehrheit über die sittliche Kraft des Menschen geht. Tocqueville´s Skizze einer repräsentativen Gewaltenteilung beinhaltet erstens, dass die gesetzgebende Körperschaft nicht zum Sklaven der Mehrheit werde, dass zweitens die ausübende Gewalt eine eigene Stärke besitzt und drittens, dass die Gerichtsgewalt von den anderen beiden unabhängig bleibt. Andersherum kann in einer vormundschaftlichen Despotie die Mehrheit zum Sklaven der Regierung werden. Hornung sagt, der Zustand der Postmoderne entspricht dieser Art von Despotismus, die Gesellschaft ist institutionell zentralisiert. Tocqueville sah in eine despotische Zukunft, in der industriellen Revolution erblickte er den materiellen Güterreichtum, der, seiner Ansicht nach, zum Massenwohlstand führt. Sobald sich der Erwartungshorizont der Menschen von der Regierung maximal bis zur materiellen Bedürfnisbefriedigung ausdehnt, ist dies der direkte Weg zur Versklavung. Als zentrales Motiv für die Revolution empfand Tocqueville die ,,Leidenschaft für die Gleichheit5 ". Beruft sich die Demokratie auf die Mehrheit, ist ein neuer Despotismus geboren. Selbstverwaltung und Recht sind die beiden wichtigsten Stützen zur freiheitssichernden Gewaltenteilung. Die Pressefreiheit benennt er als ,,demokratisches Werkzeug"6 ; die Geschworenengerichte und die richterliche Gewalt bezeichnete Tocqueville als unentbehrlich im Kampf gegen den Mehrheitsdespotismus. Die Freiheit wäre nach Tocqueville ohne die Religion nicht denkbar. Die sittliche und geistige Kultur der Gesellschaft entscheidet über Freiheit oder Knechtschaft. Klaus Hornung warnt die postmodernen westlichen Staaten vor der Versklavung durch eine Aufstufung des Wohlstandes. Der Freiheitswille verschwindet dann von selbst, dass Gemeindewesen fasst nicht mehr Fuß und die Menschen enden in Gewalt und Knechtschaft. Freiheit kann nur permanent bestehen, wenn sie Ziele bzw. Vorbilder besitzt, auf welche die Freiheit begrenzt wird. Hornung bezeichnet Tocqueville´s Werk als ein Werk mit Aufforderungscharakter, in dem er in der Gegenwart (1994) und in den tatsächlichen Umständen (dito 1994) Orientierung sucht.
3. KRITIK
Klaus Hornung konfrontiert den Zusammenbruch der Sowjetunion mit der Französischen Revolution unter dem Argument, dass sie jeweils einen äquivalenten weltgeschichtlichen Umbruch dargestellt haben. Infolge beider Ereignisse kam es in den betreffenden Zeiten zu einem sozialen Wandel, welcher allerdings jeweils unterschiedliche Prozesse absolvierte und jeweils unterschiedliche Ursachen zeigte. 1789 löste die Französische Revolution das feudale System ab und verhalf der Demokratie und den Menschenrechten zum Durchbruch. 200 Jahre später symbolisierte die Maueröffnung7 den Zerfall der Sowjetunion und das Ende des Kommunismus. Betrachte ich die zeitlichen Relationen, so vertrete ich die Meinung, dass die französische Revolution, die ein über mehrere Jahrhunderte beständiges System ablöste, nicht mit der Wende von 1989/90, die ein 40 Jahre altes System beseitigte, als ebenbürtiger weltgeschichtlicher Umbruch verglichen werden kann. 1989 existierten Medien, welche die Menschen gelenkt, motiviert und aufgefordert haben, gegen die Staatsmacht voranzugehen. Die westlichen Staaten stärkten dem Volk der DDR den Rücken, insbesondere die BRD. Die Menschen hatte ihr Ziel sicher im Auge - die westliche Demokratie. Das oben angeführte besaßen die Franzosen 1789 nicht. Sie verfügten über keine vergleichbare Orientierung, keinen Beistand anderer Völker und auch nicht über die mannigfaltigen Medien8. Meinem Urteil zufolge, sollte man sich bei Alexis de Tocqueville, der zwar als ,,Prophet des Massenzeitalters"9 gilt und mit seinen Werken hochgeschätzte Zeitdokumente der Wissenschaft aushändigte, nicht in der Postmoderne orientieren. Grundsätzliche Aussagen über Demokratie und Despotismus des Zeitdiagnostikers haben in der momentanen Gesellschaft ihre Legitimität nicht eingebüßt, dennoch entstanden diese unter anderen gesellschaftlichen und zeitlichen Verhältnissen, die von jener Zeit abhängig und durchdacht waren. Diese Aussagen traf Tocqueville in einer Gesellschaft, die nicht die Möglichkeit zur Massenkommunikation besaß. Tocqueville wurde 16 Jahre nach Beginn der Revolution geboren und erlebte das feudale System mit dem sich begleitenden Despotismus persönlich nicht mit.10 Primär besitzen seine Berichte, bezüglich des Despotismus, einen philosophisch- belehrenden Charakter als eine auf Erfahrung beruhende Zeitdiagnose. Hornung, der die Transition des Systemwandels 1989/90 miterlebte, greift nach diesen Ausführungen von Tocqueville, der ,,nur" die Etappe der Konsolidierung der Transformation erfuhr. Wenn Hornung über einen fiktiven bevorstehenden Despotismus Ausführungen treffen will, so sollte er die Historie der betreffenden Nation genauer analysieren. Tocqueville´s Werk entstand etwa 40 Jahre nach dem lange anhaltenden Despotismus in Frankreich und orientierte sich an der amerikanischen Demokratie. Er versucht, anhand des etablierten Systems in Amerika
Ratschläge zu geben, auf welche Weise sich die Demokratie und die Freiheit in Frankreich bewahren und erhärten kann. Laut Überschrift bezieht Hornung diese Aussagen auf die Postmoderne, in der sich die demokratischen Systeme global, bis auf Ausnahmen, konventionalisiert haben. Während vor der Französischen Revolution der Despotismus bzw. die Knechtschaft in der klassischen Form vorherrschte, existierte im Kommunismus durch das diktatorische Regime eine andere Art von Despotismus, meiner Meinung nach ein repressiver Despotismus. Ich komme deswegen zu dem Entschluss, dass sich beide genannten Formen von Despotismus gegenseitig ausschließen, sofern sie gegenüber gestellt werden. Hornungs Interpretation, dass die westlichen Staaten bei einer Erhöhung des Wohlstandes Gefahr laufen, möchte ich widersprechen.11 Ich denke, gerade diese Steigerung stellt die Leitbilder und Ziele der Gesellschaft dar, auf dessen Fundament die Freiheit und damit die Demokratie dauerhaft bestehen kann. Stagniert der Wohlstand in der modernen Zeit, die vom unbeirrten Streben höher und weiter zu kommen geartet ist, würde es zu einer internationalen Wirtschaftskrise führen. Die Industrie ist ausgerichtet, den fortanwachsenden Wohlstand zu begleiten. Ich meine, dass infolge eines Zusammenbruchs der Wirtschaft die Menschen von der staatlichen Fürsorge abhängig sind; damit stehen die Türen zur Versklavung offen und es bietet dem Staat die außerordentliche Gelegenheit zur Ausbildung einer neuen Gesellschaftsform.
Die Gefahr des Despotismus, der sich auf die Demokratie der Mehrheit beruft, sehe ich persönlich nicht gegeben. Während Tocqueville seine Überlegungen, in denen nur wenige Individuen einer Gesellschaft die Macht über die ganze Bevölkerung haben, beispielsweise auf einen König bezog, reproduziert Klaus Hornung diese Überlegungen in die Gegenwart und setzt anstelle der Könige die Kommandohöhen in Parteien, die Medien und die monopolistische Wirtschaft ein. Ich denke, diese Institutionen können die Gesellschaft zwar bis zu einem bestimmten Punkt beeinflussen, allerdings besitzt die Gesellschaft auch eine sittliche und geistige Kultur12, welche letzten Endes über Hörigkeit oder Freiheit entscheidet. Ohne Zweifel nehmen die Medien bzw. die Parteien eine gewisse Machtposition in der Gesellschaft ein, die aber meiner Ansicht nach nicht mit der Hegemonie eines Königs zu messen ist.
Auch stimme ich nicht mit Hornungs Darstellung überein, die er aus dem Versuch ableitet, den ,,neuen, bevormundenden Despotismus"13 in der Postmoderne widerzuspiegeln. Seiner Ansicht nach zeichne das zentralisierte und beamtenhafte System die bevormundende Macht aus. Ich plädiere im Gegensatz eher dazu, in den Institutionen, die hinter den zentralen und bürokratischen Organen stehen, eine Schutzfunktion zu sehen. Die Institutionen beschützen die Gesellschaft vor einer zur Anarchie entartenden Freiheit und dienen somit in derselben Weise zur Erhaltung der freiheitlichen Demokratie. Zum Schluss kommend, möchte ich noch etwas prinzipielles zu Klaus Hornungs Schriftstück14 sagen. Er entnahm Tocqueville´s Werk15 die beiden Schlüsselfragen16. Um sein Anliegen besser hervorzuheben, hätte er meiner Ansicht nach diesen beiden Fragestellungen mehr Beachtung schenken müssen. Sein Artikel besteht im Kern fast ausschließlich aus Wiederholungen und der Zusammenfassung von Kapiteln und Gedanken aus Tocquevilles ,,Über die Demokratie in Amerika". Dies wurde letztlich von einem Rahmen umschmückt, der aus einleitenden, sehr interessanten Gedanken bestand und mit der Quintessenz endete, Tocqueville sei ein Autor mit aktueller Gegenwartsbedeutung. In der Folge ernüchterte das Werk aus den nachstehenden Gründen. Viel zu wenig vorhandene Querverweise und Bezüge zwischen Tocquevilles Aussagen und Hornungs Interpretation im Hauptteil, ferner erschienen mir die Interpretationen fraglich und bestreitbar (-> bevormundende Macht = Bürokratie?). Die eingangs genannten Fragestellungen17 wurden nur partiell und nicht im Zusammenhang beantwortet und sind in seinem Resümee überhaupt nicht mehr zur Sprache gekommen. Weiterhin verwendete Hornung meines Erachtens zu viele Zitate anderer Historiker, dementsprechend ist seine eigene Meinung zu kurz geraten.18 Abschließend möchte ich bemerken, dass die Idee, sich gegenwärtig die Frage19 zu stellen, eine sehr interessante Angelegenheit ist. Diese Frage hingegen mit Hilfe von Alexis de Tocqueville zu beantworten, halte ich - wie oben schon begründet - für die falsche Herangehensweise.
4. FAZIT
Alexis de Tocqueville versuchte die Transformation der französischen Revolution als politische Revolution zu verstehen. Klaus Hornung indessen versteht die Transformation des Systemwandel von 1989 als politische Revolution. Von dieser Warte aus überträgt er die Grundgedanken20 der ,,Demokratie in Amerika" in die Gegenwart. Diese Gedanken über Demokratie und Despotismus gewinnen in der Postmoderne meines Erachtens nach eine rundweg neue Bedeutung. Es hat sich inhaltlich an den Voraussetzungen für Demokratie und Despotismus seit Tocqueville nichts geändert, trotzdem sind diese Gedanken in einer anderen Epoche21 niedergeschrieben worden. Meines Ermessens stellen die von mir bereits angesprochenen gegenwärtigen Kommunikationsmöglichkeiten eine weltweite Errungenschaft dar, die die Nationen, welche längst die Demokratie und die Freiheit erlangt haben, vor einer Wiederkehr der Willkürherrschaft bewahren. Aller geübten Kritik zum Trotz, halte ich es für eine sehr interessante Idee, auf Klassiker wie Tocqueville einen aktualitätsbezogenen Blick zu werfen. Hornung begeht jedoch meiner Anschauung nach den Fehler, dass die zu vielen Argumentationen anderer Wissenschaftler seine eigene Meinung unterdrücken und somit der Eindruck erweckt wird, sein Werk besteht aus einer Aneinanderreihung von Zitaten seitens Tocqueville und seitens anderer Historiker. Ungeachtet dessen halte ich es für falsch, in der modernen Zeit bei Alexis de Tocqueville gesellschaftlich-politische Orientierung zu suchen, obendrein bei sozialen und staatlichen Entscheidungsfragen seine Ausführungen zu Rate zu ziehen. Abschließend kommt bei mir die Frage auf, ob der Kommunismus ohne die Möglichkeit zur Massenkommunikation, weiter bestanden hätte.
Literaturverzeichnis
Hornung, Klaus. 1994. Welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben - Alexis de Tocqueville über die Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie. In: Zeitschrift für Politik 41: 347-358.
Tocqueville, Alexis de. 1835/1987. Ü ber die Demokratie in Amerika. Erster Teil. Zürich: Manese: 369-389 (II. Teil, 7. Kapitel).
Tocqueville, Alexis de. 1840/1987. Ü ber die Demokratie in Amerika. Zweiter Teil. Zürich: Manese: 141-166 (II. Teil, 1. bis 5. Kapitel), 369-387 (III. Teil, 21. Kapitel), 460-487 (IV. Teil, 6. bis 8. Kapitel).
[...]
1 Alexis de Tocqueville. 1835/40. Ü ber die Demokratie in Amerika. Erster und Zweiter Teil.
2 Tocqueville. 1840. Ü ber die Demokratie in Amerika. Zweiter Teil., Vierter Teil, sechstes Kapitel.
3 Zusammenbruch der Sowjetunion: 1991.
4 14. Juli 1789: Sturm auf Bastille löst Revolution aus.
5 FN (= Fußnote) 5: 352.
6 Vergleich Alexis de Tocqueville. 1840/1987. Ü ber die Demokratie in Amerika. Zweiter Band. Vierter Teil. Siebentes Kapitel: 473.
7 Gemeint : 9.November 1989.
8 Vergleich Kommunikationsmedien und Massenkommunikation mit 1989.
9 Untertitel der Biographie von Karl Pisa.
10 Alexis de Tocqueville: *1805,_1859.
11 FN 5: 353.
12 Die sittliche und geistige Kultur des Volkes ist meiner Meinung nach sehr schwer zu manipulieren, z.B. hat es das SED-Regime jahrelang versucht aber dennoch nicht geschafft. Verantwortlich ist meiner Überzeugung zufolge auch hier wieder die Massenkommunikation.
13 FN 5: 353.
14 FN 5: 347ff.
15 Vergleich FN 1.
16 Vergleich FN 5.
17 Vergleich FN 16.
18 Vergleich FN 5: 350. Zitiert aus Werken Jardins, Ortliebs, Geiß, Dilthey.
19 FN 5: ,,Welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben."
20 Die ,,Grundgedanken" in: FN 5: 347 ff.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Rezension von Klaus Hornungs Artikel über Tocqueville?
Die Rezension fasst Klaus Hornungs Artikel "Welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben - Alexis de Tocqueville über die Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie" zusammen. Hornung untersucht Tocquevilles Warnungen vor den Gefahren des Despotismus in demokratischen Gesellschaften und dessen Relevanz für die heutige Zeit (1994). Die Rezension erörtert kritisch Hornungs Bezugnahme auf Tocqueville und seine These, dass die Tocqueville'schen Despotismusarten in der Postmoderne eine Renaissance erfahren könnten.
Welche zentralen Punkte aus Tocquevilles "Über die Demokratie in Amerika" werden in Hornungs Artikel hervorgehoben?
Hornung konzentriert sich auf Tocquevilles Analyse, wie eine egalitäre Wohlfahrtsdemokratie despotisch entarten kann. Er betont Tocquevilles Warnung vor der Omnipotenz der Mehrheit und die Notwendigkeit einer Gewaltenteilung, einschließlich einer unabhängigen Justiz und Pressefreiheit. Auch die Bedeutung der Religion für die Freiheit und die Gefahr eines reinen materiellen Strebens nach Wohlstand werden thematisiert.
Wie kritisiert der Rezensent Klaus Hornungs Analyse?
Der Rezensent argumentiert, dass Hornungs Vergleich des Zusammenbruchs der Sowjetunion mit der Französischen Revolution fragwürdig sei. Er stellt auch die Relevanz von Tocquevilles Beobachtungen für die postmoderne Gesellschaft in Frage, da diese unter anderen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen entstanden seien. Zudem wird Hornungs Interpretation eines "neuen, bevormundenden Despotismus" durch eine zentralisierte Bürokratie widersprochen, da die Institutionen hinter diesen Organen als Schutzfunktion für die Freiheit angesehen werden.
Welche Bedenken äußert der Rezensent bezüglich Hornungs Verwendung von Zitaten?
Der Rezensent kritisiert, dass Hornungs Artikel zu stark auf Zitaten von Tocqueville und anderen Historikern beruht, wodurch seine eigene Meinung zu kurz komme. Die Zusammenhänge zwischen Tocquevilles Aussagen und Hornungs Interpretation seien zu wenig vorhanden.
Welches Fazit zieht der Rezensent bezüglich der Aktualität von Tocquevilles Werk?
Obwohl der Rezensent die Idee interessant findet, klassische Werke wie Tocquevilles auf ihre Aktualität hin zu untersuchen, hält er es für verfehlt, in der heutigen Zeit gesellschaftlich-politische Orientierung bei Tocqueville zu suchen. Er stellt abschließend die Frage, ob der Kommunismus ohne die Möglichkeit zur Massenkommunikation weiter bestanden hätte.
- Arbeit zitieren
- Andreas Kolbe (Autor:in), 2001, Welche Art von Despotismus die demokratischen Nationen zu befürchten haben - Alexis de Tocqueville über die Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98116