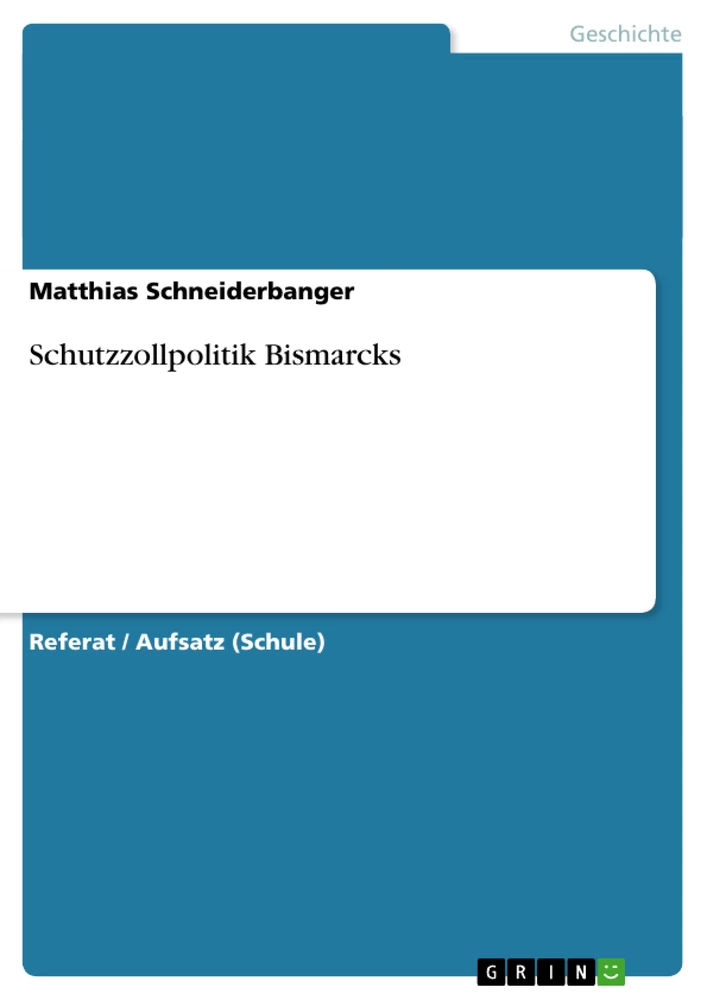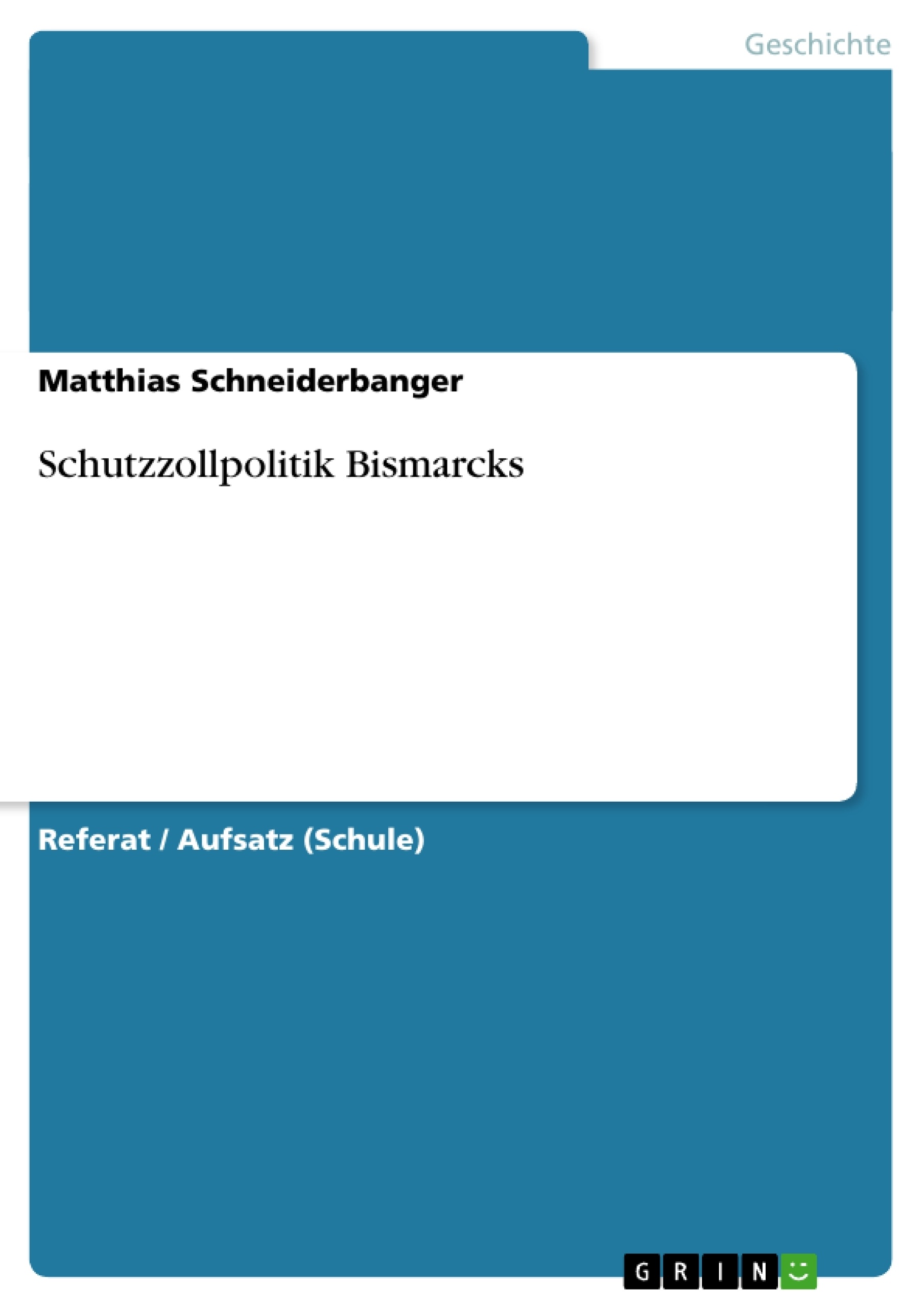Wie Schutzzölle das Deutsche Reich veränderten: Tauchen Sie ein in eine Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs und politischer Intrigen, als das junge Deutsche Reich unter Bismarck um seine Identität rang. Diese fesselnde Analyse der Schutzzollpolitik der späten 1870er Jahre enthüllt, wie die Einführung von Zöllen auf Industrie- und Agrarprodukte nicht nur die deutsche Wirtschaft umgestaltete, sondern auch die politischen Kräfteverhältnisse dramatisch verschob. Verfolgen Sie die hitzigen Debatten zwischen Freihändlern und Protektionisten, die zum Bruch mit den Nationalliberalen und zur Annäherung an das Zentrum führten. Entdecken Sie die komplexen Motive Bismarcks, der mit diesem Schritt nicht nur die heimische Wirtschaft schützen, sondern auch die finanzielle Unabhängigkeit des Reiches von den Einzelstaaten stärken und seine Machtbasis festigen wollte. Erfahren Sie, wie die Schutzzölle einerseits zu einer Entlastung der Bundesländer und höheren Staatseinnahmen führten, andererseits aber auch die Lebenshaltungskosten für die Bevölkerung erhöhten, die Exportwirtschaft beeinträchtigten und soziale Spannungen verstärkten. Analysieren Sie die langfristigen Folgen dieser protektionistischen Maßnahmen, die bis heute in der deutschen Wirtschafts- und Handelspolitik nachwirken. Eine packende Darstellung der Gründerjahre, der Weltwirtschaftskrise von 1873 und der darauffolgenden politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen, die das Fundament für das moderne Deutschland legten. Ergründen Sie die komplexen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einer entscheidenden Phase der deutschen Geschichte und gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für die Ursachen und Auswirkungen des Protektionismus. Dieses Buch bietet eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts, die Entwicklung der Industriegesellschaft und die Mechanismen der Wirtschaftspolitik interessieren. Entdecken Sie die verborgenenTriumphe und tragischen Fehlentscheidungen einer Epoche, die unser heutiges Leben entscheidend prägt.
Inhaltsverzeichnis
1. Industrielle Entwicklung zu Beginn der Reichsgründung
2. Ursachen:
a. Weltwirtschaftskrise
b. Beendigung der Reparationszahlungen Frankreichs 1873
c. Der industrielle Aufholbedarf in Deutschland war erreicht
d. Heimische Produkte waren jetzt durch Billigimporte gefährdet
e. Forderung der Wirtschaft nach Schutzzollpolitik und deren Schutz vor deren Einführung
3. Merkmale:
a. Bruch der Regierung mit den Nationalliberalen
b. Annäherung der Regierung ans Zentrum
c. Unabhängigkeit des Reiches von den Matrikularbeiträgen
d. Inhalt der Schutzzollvereinbarung
e. Haltung der Wirtschaft zur Schutzzollpolitik
4. Folgen:
a. Positive Folgen der Schutzzollpolitik
b. Negative Folgen der Schutzzollpolitik
1. Industrielle Entwicklung zu Beginn der Reichsgründung
- enormes Wirtschaftswachstum, welches aufgrund der Rückständigkeit der Wirt- schaft entstand, führte zu Unternehmensgründungen wegen Liberalisierung der Möglichkeiten einer Firmengründung (speziell Aktiengesellschaften) und zum Abbau der Zölle, da man von Billigimporten profitieren konnte = Gründerjahre ab 1871-73
- Förderung des Wirtschaftswachstums durch die Reparationszahlungen Frankreichs aufgrund des Krieges (1870/71): 3 Milliarden Goldfrancs der 5 Milliarden Gesamtsumme wurden in Form von Aufträgen an die Schwer- und Bauindustrie für die Wiederaufrüstung investiert bzw. in Form von Krediten weitergegeben (restl. 2. Mrd. Francs wurden in die Rückzahlung von Kriegsanleihen gesteckt); des weiteren erfolgte der Zugewinn des rohstoffreichen Gebietes Elsass-Lothringen
- auch Großgrundbesitzer unterstützten diese Politik da sie billig Getreide ex- portieren konnten
2. Ursachen:
a. Weltwirtschaftskrise
weltweit an den Börsen in die Höhe getriebene Aktienkurse mündeten im April 1873 im „Großen Krach“: im Mai wurde die Wiener Börse geschlossen woraufhin einige Bankhäuser ihre Zahlungsunfähigkeit erklärten; im September desselben Jahres geschah selbiges an der New Yorker Börse; im Herbst 1873 erfasste diese Entwicklung auch die Berliner Börse (bis 1876 wurden 61 Banken, 4 Eisenbahngesellschaften und 115 Industrieunternehmungen liquidiert), da das den Unternehmen bereitgestellte Geld bereits investiert war. Ein weiteres Problem war die schlechte Kapitalabsicherung der Unternehmen, d.h. die Unternehmen waren mit zu wenig Eigenkapitalanteil gegründet worden, so dass sie nun in der Zeit der Krise besonders anfällig gewesen sind.
b. Beendigung der Reparationszahlungen Frankreichs 1873 => somit
auch Abbruch der Investitionstätigkeit des Reiches
c. Der industrielle Aufholbedarf in Deutschland war erreicht
d. Heimische Produkte waren jetzt durch Billigimporte gefährdet, vor
allem Rekordgetreideernten in Russland und der USA trafen die Deutsche Landwirtschaft empfindlich, da die vor allem die USA eine billigere Produktionsweise hatte und überdies die Transportkosten für Bahn- und Überseefrachten sanken.
Schließlich bleibt noch zu erwähnen, dass auch die dt. Textil- und Eisenindustrie durch englische Billigimporte starke Absatzeinbußen hinnehmen musste.
e. Forderung der Wirtschaft nach Schutzzollpolitik und deren Schutz vor deren Einführung
Die Wirtschaft schützte sich bereits vor der Einführung der Schutzzölle, indem sie Kartelle und kartellähnlichen Zusammenschlüssen zur Regulierung von Preisen, Produktionszahlen und Absatzgebieten gründeten. Ebenso gründete sie Verbände, die spezifische Interessen gegenüber der Regierung und anderen staatlichen Institutionen vertreten sollten, wie z. B. 1873 den Verein Deutscher Stahl- und Eisenindustrieller (= erste Gesamtdeutsche Interessenvertretung der Schwerindustrie) oder 1876 den Centralverband deutscher Industrieller (CdI) als Dachorganisation verschiedener industrieller Interessenverbände, wobei besonders die rheinisch-westfälische Eisen- und Stahlindustrie hier großen Einfluss hatte. Deren Ziel war die Abkehr vom liberalen Freihandel und die Forderung nach Einführung von Schutzzöllen.
Auch die ostelbischen Agrarier vereinigten sich 1876 in der Vereinigung der Steuer- und Wirtschaftsreformer die sich für Zölle auf ausländisches Getreide stark machte. Diese Forderung lief auf eine Subventionierung der Großgrundbesitzer zu Lasten der Verbraucher hinaus, die dadurch höhere Brotpreise hätten zahlen müssen. Die Landwirtschaft war allerdings erst später von den Billigimporten betroffen, so dass sie erst drei Jahre nach der Industrie die Forderung nach Schutzzöllen erhob. In Verbindung mit dem Ruf der Verbände nach „Schutz der nationalen Arbeit“ mischten sich antisemitische und aggressiv-nationalistische Töne. Bezeichnend dafür war folgendes Schlagwort, das seinerzeit aufkam: „Deutschland den Deutschen“. Problematisch war allerdings einen Konsens zwischen den beiden Dachverbänden zu finden, denn einerseits wollten die Agrarier Schutzzölle für Getreide, aber die Forderung der Industrie konnten sie nicht unterstützen, da der Preis für landwirtschaftliche Maschinen sonst ebenso stieg. 1877 gelang es den beiden Verbänden dann doch ein gemeinsames Zollprogramm vorzulegen.
=> Der Ruf nach wirksamer staatlicher Schutzzollpolitik wurde sowohl von Industrie als auch Landwirtschaft gefordert; auch Teile der Gesellschaft unterstützte diese Forderung, da sie von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. betroffen war.
3. Merkmale:
a. Bruch der Regierung mit den Nationalliberalen
Bismarck hatte erkannt, dass eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Koalitionspartner, den Nationalliberalen nicht mehr möglich sein würde. Denn er strebte nicht nur an, Schutzzölle für landwirtschaftliche und industrielle Produkte zu erheben, wie er 1875 dem Bundesrat eröffnete, sondern auch eine staatliche geplante Sozialpolitik einzuführen, das dem wirtschaftlichen und sozialen Individualismus der Liberalen entgegenstand.
Weiterhin brauchte er durch den Solidarprotektionismus ein Mittel um die Liberalen in die Schranken zu verweisen, da diese eine Neugestaltung der Reichsverfassung im freiheitlichen Sinne beabsichtigten. Dies lag auch daran, dass der Kronprinz Friedrich Wilhelm durch sein liberales Denken bei einem eventuellen Thronwechsel diesen Prozess noch unterstützen würde.
Bismarck versuchte durch die Gewinnung von einigen Parteigrößen der Nationalliberalen, vor allem dem Parteiführer Bennigsen als Minister im preußischen Staatsministerium, einen Bruch des linken Flügels der Nationalliberalen dadurch zu erreichen, dass durch die Einsetzung dieser Minister die Nationalliberalen fest an die Entscheidungen der Regierung gebunden würden. Außerdem konnte bei einem evtl. Thronwechsel eine Regierung mit Nationalliberalen für den liberalen Nachfolger annehmbar sein.
Aber die Verhandlungen mit Bennigsen scheiterten, da Wilhelm I. einen Liberalen nicht zu Minister ernennen wollte und Bennigsen unbedingt darauf bestand, dass zwei Angehörige des linken Flügels Minister würden.
Damit war der Bruch der Nationalliberalen eingeleitet.
Bismarck drängte nun die Nationalliberalen Minister aus den Ministerpositionen und leitete die Zoll- und Finanzreform ein. Die Nationalliberalen wollten dies nur unter Anerkennung des Budgetrechts für den Reichtag annehmen. Dies lehnte Bismarck allerdings ab. Inzwischen sammelten sich die Befürworter des Schutzzolls im Reichstag in der „Volkswirtschaftliche Vereinigung des Reichstages“, der 204 Abgeordnete angehörten (75 Konservative, 87 Zentrumsabgeordnete und 27 Nationalliberale). Für Bismarck war dies der Anlass mit aller Konsequenz sein Ziel durchzusetzen, so dass folglich die nationalliberale Fraktion daran zerbrach, da die Befürworter der Schutzzollpolitik aus der Fraktion ausgetreten sind. Im folgenden Jahr trat der linke Flügel aus der Partei aus, da sich der Kern von Bismarck nicht trennen wollte. Die verbliebenen Abgeordneten nannten sich nun „Liberale Vereinigung“.
b. Annäherung der Regierung ans Zentrum
Nachdem nun der Kulturkampf beigelegt worden war und die konservativen Parteien mit Zentrum parlamentarische Verhandlungen über die Einführung der Schutzzollpolitik und der Erhöhung der Tabaksteuer führten, waren die Weichen gestellt. Das Zentrum aber war föderalistisch eingestellt, so dass die Regierungsvorlage durch Hinwirkung des Zentrums um die „Franckensteinische Klausel“ erweitert wurde. Diese Klausel beinhaltet, dass die Einnahmen aus den Zöllen und der Tabaksteuer die einem Betrag von 130 Millionen Reichsmark übersteigen auf die Länder aufgeteilt werden müssen. Damit war ein Ziel von Bismarck nicht erreicht worden. Die
c. Unabhängigkeit des Reich von den Ländern
Diese Unabhängigkeit versuchte Bismarck durch die indirekten Steuern und Zölle zu erreichen um das Reich als „Kostgänger“ der Länder zu befreien. Er strebte auch an die direkten Steuern auf Einkommen u. a. aufzuheben. Dies war aber durch die vorgenannte Franckensteinische Klausel beschränkt worden. Denn die Mehreinnahmen hätte Bismarck für die Erweiterung und Aufstockung des Heeres benötigt (401000 - 427000 Mann in 7 Jahren). Im Zuge seiner Finanzreform strebte er noch danach ein Tabakmonopol einzurichten und weitere indirekte Steuern einzuführen (Brau-, Börsensteuer u. a.), denn die erhöhten Zolleinnahmen und die Matrikularbeiträge reichten nicht dazu aus die geplante Sozialpolitik und die Heeresvermehrung zu finanzieren.
d. Inhalt der Schutzzollvereinbarung
Am 15. Dezember 1878 informierte er den Bundesrat über denn Kurswechsel der Wirtschaftspolitik und den bevorstehenden Gesetzesentwurf zur Schutzzollpolitik. Damit war die Schutzzollpolitik eingeleitet, nachdem er Teile der Nationalliberalen und das Zentrum zusammen mit den Konservativen für die Einführung von Schutzzöllen gewinnen konnte. Die Gesetzesvorlage wurde von einer Tarifkommission, die sich aus 15 Mitglieder (drei vom Kanzler ernannte, drei von Preußen, zwei von Bayern und je eines aus Württemberg, Sachsen, Mecklenburg, Hessen, Baden, Weimar und gemeinsam von den Hansestädten) zusammensetzte, ausgearbeitet. Es waren sich alle einig, dass Schutzzölle für die Industrie nötig seien, jedoch nicht für die Landwirtschaft. Dies erzwang Bismarck in der Kommission, da er sowieso schon 6 Personen hinter sich wusste und dann noch Württemberg und Weimar gewinnen konnte. So wurde z. B. für Getreide 10 DM pro Tonne fällig, doch dafür wurde Roggen und Mais nur mit 5 DM pro Tonne belegt. Für Roheisen wurde ein Betrag von 10 DM bei Import fällig, dieser Betrag war vom Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller gewünscht, lag jedoch um 4 DM höher als der vom Centralverband deutscher Industrieller. Im übrigen bedeutete, dass Schutzzölle neben vorgenannten auch auf Fleisch, Bauholz und Textilwaren erhoben werden sollten. Bemerkenswert bleibt noch die Ergänzung die Bismarck vornahm, da er einen „Repressalienparagraphen“ einfügen ließ, der besagte, dass die Zölle für alle auswärtigen Staaten, die deutsche Erzeugnisse diskriminierten, zu verdoppeln sind.
So wurde dann der Gesetzentwurf am 4. April 1879 dem Reichstag zugeleitet und am 12. Juli schließlich mit Stimmen der Konservativen Parteien, des Zentrums sowie 20 Nationalliberalen Abgeordneten angenommen. Das Zentrum jedoch machte seine Zustimmung von der Bedingung abhängig, welche bei Punkt b. + c. bereits als „Franckensteinische Klausel“ erläutert ist.
4. Folgen:
a. Positive Folgen der Schutzzollpolitik
Die Bundesländer waren durch sinkende Matrikularbeiträge entlastet und hatte sogar noch Geld aus dem Überschuss erhalten, so dass sich die Haushaltslage in den Ländern etwas entspannte.
Auch das Reich hatte natürlich mehr Geld im Haushalt zur Verfügung und erhöhte seine Einnahmen noch durch die Erhöhung weiterer indirekter Steuern, da das Heer vergrößert werden sollte von 401000 auf 427000 Mann in sieben Jahren, ebenso wurde Geld für die geplante Sozialpolitik nötig.
b. Negative Folgen für Schutzzollpolitik
Die Landwirtschaft war nicht erfreut über die Zölle auf Eisen, da die landwirtschaftlichen Maschinen dadurch teuerer wurden und schließlich die Kosten auf die Bevölkerung umgelegt wurden.
Weiterhin erhöhten sich die Lebenshaltungskosten der schwachen Bevölkerungsmehrheit, besonders durch die Einfuhrzölle auf Getreide und Vieh, denn die Zolleinnahmen waren nicht zum Verbraucherschutz gedacht, das ist insbesondere an den Zöllen auf Lebensmittel zu erkennen.
Als weiteres Resultat entstand eine geringere Nachfrage, die auf größerer Arbeitslosigkeit beruhte, dadurch schuf man eine noch geringer Nachfrage, so dass abermals Arbeitslose daraus folgten, schließlich stieg die Armut der Bevölkerung, da sich Menschen ohne Arbeit nichts leisten konnten.
Auch verschlechterte sich die Absatzlage für die Exportwirtschaft besonders in der Maschinenbau-, Elektro- und chemischen Industrie, da bis auf England, Dänemark und die Niederlande alle europäischen Länder dem Schutzzollbeispiel Deutschlands folgten.
Die Unzufriedenheit der Bürger quittierten diese in der Reichtagswahl vom Herbst 1881, in welcher Bismarck eine Niederlage erleiden musste. Sein Wahlkampfthema über die Steuerpolitik mit der Ankündigung eines Tabakmonopols stieß bei der Bevölkerung auf Ablehnung. Dies führte bei der SPD zu einem Anstieg in der Wählergunst.
Unter dem Strich jedoch, nützte der staatliche Protektionismus der stetigen Entwicklung der Industrie und Landwirtschaft in Deutschland, vor allem weil der Staat nicht nur Einfuhrzölle erhob, sondern in der Folge auch günstige Transporttarife für Ausfuhrgüter, Steuervorteile, Subventionen und handelspolitische Hilfen gewährte um die internationale Wirtschaft international konkurrenzfähig zu halten. Die Entwicklung lässt sich bis zum heutigen Tag beobachten (vgl. Kohle, Agrarwesen).
Quellen:
- Rudolf Berg, Rolf Selbmann: Grundkurs Deutsche Geschichte Band 1, Hirschgraben-Verlag 2. Auflage 1987
- Hermann Kinder, Werner Hilgemann: dtv-Atlas Weltgeschichte Band 2, Deutscher Taschenbuch Verlag 33. Auflage Oktober 1999
- Volker Ulrich: Die nervöse Großmacht, Fischer Taschenbuch Verlag, 3. Auflage Dezember 1999
- Hans-Uwe Rump, Quellen zur Entwicklung der modernen Industriegesellschaft, Manzverlag historische Reihe 2, 6. Auflage 1984
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für die Einführung von Schutzzöllen in Deutschland nach der Reichsgründung?
Die Einführung von Schutzzöllen erfolgte aufgrund einer Kombination von Faktoren, darunter die Weltwirtschaftskrise von 1873, das Ende der französischen Reparationszahlungen, der Aufholbedarf der deutschen Industrie, die Bedrohung heimischer Produkte durch Billigimporte und die Forderung der Wirtschaft nach Schutz vor ausländischer Konkurrenz.
Welche Merkmale kennzeichneten die Schutzzollpolitik unter Bismarck?
Zu den Hauptmerkmalen gehören der Bruch der Regierung mit den Nationalliberalen, die Annäherung ans Zentrum, die angestrebte Unabhängigkeit des Reiches von den Matrikularbeiträgen der Länder, der Inhalt der Schutzzollvereinbarung (Zölle auf Getreide, Eisen, etc.) und die unterschiedliche Haltung der Wirtschaft (Industrie vs. Landwirtschaft) zur Schutzzollpolitik.
Welche positiven und negativen Folgen hatte die Schutzzollpolitik?
Positive Folgen waren die Entlastung der Bundesländer durch sinkende Matrikularbeiträge und höhere Einnahmen für das Reich. Negative Folgen waren steigende Lebenshaltungskosten für die Bevölkerung, geringere Nachfrage aufgrund von Arbeitslosigkeit, Verschlechterung der Absatzlage für die Exportwirtschaft und Unzufriedenheit der Bürger, die sich in den Reichstagswahlen von 1881 zeigte.
Welche Rolle spielten die Nationalliberalen und das Zentrum in der Schutzzollpolitik?
Bismarck brach mit den Nationalliberalen, da diese eine freiere Wirtschafts- und Sozialpolitik befürworteten. Er näherte sich dem Zentrum an, um eine Mehrheit für die Schutzzollpolitik zu sichern. Die "Franckensteinische Klausel", die durch das Zentrum eingebracht wurde, schränkte jedoch Bismarcks Pläne zur finanziellen Unabhängigkeit des Reiches ein.
Was beinhaltete die "Franckensteinische Klausel"?
Die "Franckensteinische Klausel" besagte, dass Einnahmen aus Zöllen und der Tabaksteuer, die 130 Millionen Reichsmark überstiegen, auf die Länder aufgeteilt werden mussten. Dies verhinderte, dass das Reich die Mehreinnahmen vollständig für z.B. die Heeresvermehrung nutzen konnte.
Wie schützte sich die Wirtschaft vor Einführung der Schutzzölle?
Die Wirtschaft gründete Kartelle und kartellähnliche Zusammenschlüsse zur Regulierung von Preisen, Produktionszahlen und Absatzgebieten. Außerdem entstanden Verbände zur Vertretung spezifischer Interessen gegenüber der Regierung, wie der Verein Deutscher Stahl- und Eisenindustrieller und der Centralverband deutscher Industrieller (CdI).
Was forderten die ostelbischen Agrarier?
Die ostelbischen Agrarier forderten Zölle auf ausländisches Getreide, was auf eine Subventionierung der Großgrundbesitzer zu Lasten der Verbraucher hinauslief, die höhere Brotpreise hätten zahlen müssen. Ihre Forderung kam später als die der Industrie.
Welche Rolle spielten antisemitische Töne im Zusammenhang mit der Schutzzollpolitik?
Im Zusammenhang mit der Forderung nach "Schutz der nationalen Arbeit" mischten sich antisemitische und aggressiv-nationalistische Töne, wie das Schlagwort "Deutschland den Deutschen" zeigt.
Welchen Einfluss hatte die Schutzzollpolitik auf die Lebenshaltungskosten?
Die Lebenshaltungskosten erhöhten sich für die Bevölkerung, besonders durch die Einfuhrzölle auf Getreide und Vieh.
- Quote paper
- Matthias Schneiderbanger (Author), 2000, Schutzzollpolitik Bismarcks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98007