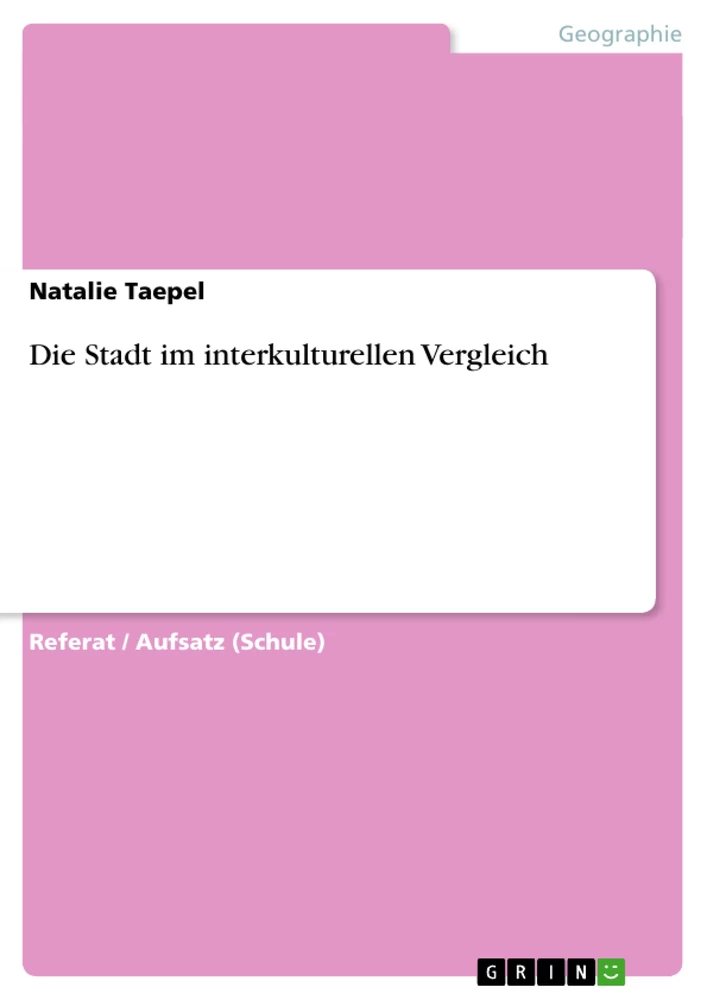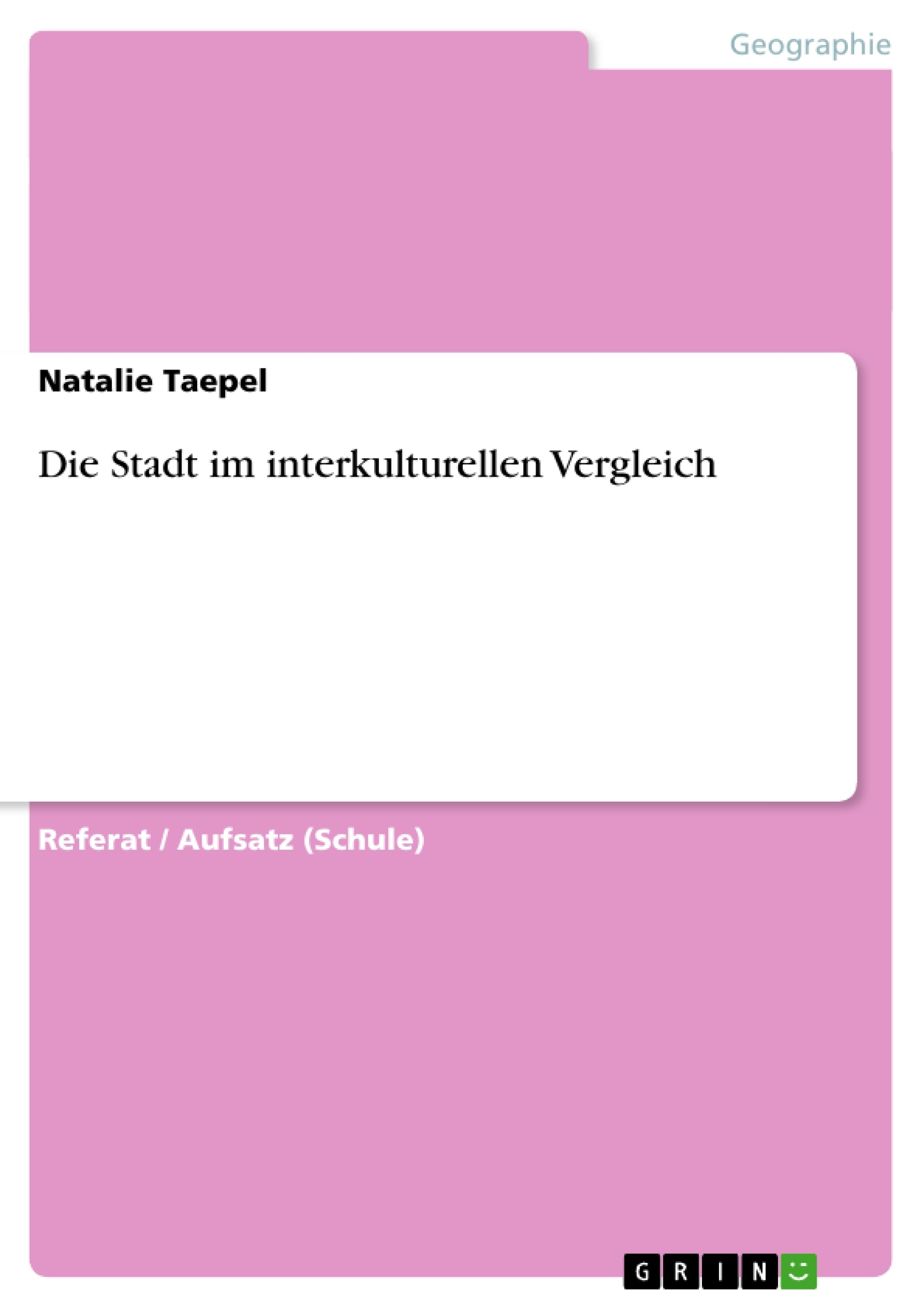Die Stadt im interkulturellen Vergleich
Der kulturgenetische Ansatz
-kosmologische, religiöse, okönomische, politische und planerische Vorstellungen haben das Stadtbild der Städte beeinflusst.
-um Städte zu betrachten muß man sich auf mittlere Betrachtungsebene begeben, die Gemeinsamkeiten der Städte eines Teilraumes der Erde untersuchen.
-die größte Stufe der allgemeinen Betrachtung umfaßt wenige kulturgenetische Stadttypen, die sich in Kulturerdteilen zusammenfassen lassen.
-unter einem Kulturerdteil versteht man einen subkontinentalen Raum, der sich in einheitlich im individuellem Ursprung der Kultur, der einzigartigen Verbindung von Natur und Kulturelementen, und der selbständigen Ordnung geistiger und materieller Aspekte zeigt. Einzelne Aspekte der geistigen und materiellen Kultur können jedoch über den Kulturerdteil hinausgehen und in andere Kulturerdteile / in dessen Kultur einfließen.
Kulturerdteilzuordnung nach Beaujeu-Garnier/ Chabot 1963- Abendländischer Kulturerdteil: Nordeuropa, Zentral- und Westeuropa, Mediteranes Europa, Osteuropa
Russischer K.: Traditionelles Rußland, Sowjetasien
Orientalischer K.: Orient, (Moyen Orient), Nordafrika
Indischer K.: Süd- und Südostasien
Sinischer K.: Ferner Osten (Extreme Orient)
Australpazifischer K.: Australien/Neuseeland
Negrider K.: Afrika südl. der Sahara
Germanischamerikanischer K.: Amerika nördl. des Rio Grande
Iberoamerikanischer K.: Amerika südl. des Rio Grande
Altkulturstädte, z.B. orientalische und chinesische Städte bestehen mehr aus selbst gewachsenen Elementen, während jüngere Städte eher geplant, oftmals monoton gleich, im Erscheinungsbild sind.
Einige Typmerkmale der alten Städte haben sich bis in die heutige Zeit gehalten, so z.B. die Bazarstruktur und die bazarartige Branchensortierung bis in die heutigen Einkaufszentren orientalischer Städte.
Die orientalische Stadt
-Der Orient ist das Gebiet ältester Stadtkultur
-orientalische Städte sind normal Quell- oder Flußoasenstädte
-zum Schutz vor Nomaden waren solche Oasenstädte von der Umgebung abgeschlossen, die Bevölkerung hob sich meist ethnisch und sprachlich vom Umfeld ab, die Grenzen zerfließen erst in der heutigen Zeit
-das Wasser wurde und wird zu Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte genutzt, heute liegt die Agrarerwerbsquote in Damascus bei 33%
-anders als in der europäischen Stadt, war die Landwirtschaft in den orientalischen Städten nicht durch die Feudalherren von der Stadt und dem Gewerbe getrennt
-wichtig für die orientalische Stadt war die Lage an Karawanenstraßen, größere Städte sind an den Karawanentreffpunkten entstanden (Caravan cities)
-das baumartig verzweigte System von Sackgassen, winkeligen Knickgassen, überbaute Tunnelgassen, Verbauungen mit Anbauten und Hofbauten die es oft schwierig machen, das einzelne Haus zu erkennen, schmale und niedrige Durchgänge über Gängen und Treppen sind äußerliche charakteristische Merkmale für die orientalische Stadt
-die Häuser sind in der Regel aus Luftziegeln gebaut
-Abwasserrinnen, die quer durch die Stadt laufen sind typisch
-der Sackgassengrundriß entstand durch die Gruppierung der einzelnen Sippen um solche Gassen
Ein Beispiel:
-Die 762 entstandene runde Stadt Mansour (heute nahe Bagdad) entstand laut eines alten Plans um einen zentralen Kern mit Moschee und Kalifenpalast, kreisförmig die Paläste der Kalifensöhne, in einem zweiten Kreis Verwaltungsgebäude und in einem dritten die Häuser der einzelnen Sippen (die dritte Schicht war der Stadtmauer am dichtesten)
-Die Häuser sind nach außen hin nichtssagend, fast fensterlos, von der Straße abgewendet --- der Innenhof hingegen ist schön gestaltet und mit Säulengängen und Pflanzen dekoriert.
-Im Stadtkern befinden sich die Hauptmoschee und der Bazar, manchmal auch der Kalifenpalast
-Auf dem Bazar waren die Waren nach Branchen geordnet, abgestuft nach der Wertschätzung der Waren auf dem jeweiligen Bazar.
Brokatstoffe, Bücher oder Goldschmuck gehörten zu den besten Waren und Stände mit diesen Waren lagen der Hauptbazargasse am nächsten. Blech-/Seilerwaren und andere mindere Waren wurden in den Nebengassen verkauft. Jede Ladenstraße hatte einen ihr vorstehenden Vormann.
-Heute hat sich einiges geändert: die Waren werden nicht mehr nach Wertordnung, sondern gemischt angeboten. In zentralen Teilen existieren schon nach europäischem Vorbild gebaute Geschäfte, in denen die Ware im Schaufenster ausgelegt und preislich ausgezeichnet ist.
-Oftmals sind die Wohnviertel nach ethnischen Gruppen / Glaubensrichtungen aufgeteilt, die Viertel sind dann auch äußerlich unterschiedlich
-Seit 1930 ca. ändern sich die orientalischen Städte, Fernstraßen wurden gebaut, Stadtmauern wurden abgerissen, Häuser wurden mehrgeschossig und der Grundriß wird, je weiter man sich vom Stadtkern entfernt, regelmäßiger, teilweise sogar Schachbrettmuster. Beispiel Teheran in Persien.
-In den neueren Städten wird kein Innenhof mehr gebaut, es gibt westliche Geschäftszentren und ein hohes Verkehrsaufkommen
-In Cityähnlichen Geschäftsvierteln haben sich jedoch alte Strukturen erhalten, d.h. Bazarstruktur und bazarbranchensortierung mit den besten Geschäften unten und den minderen Waren in den oberen Geschossen.
Die afrikanische Stadt
-bis auf wenige Ausnahmen ist Afrika dünn besiedelt und städtearm
-Die Städte in Ost-, Zentral-, West - und das von Weißen beherrschte Südafrika sind bis auf die großen Afrikanerdörfer von Arabern oder Europäern gegründet worden.
-Die Afrikaner die heute in diesen Städten leben sind erst zugewandert.
-Die Umstrukturierung durch die Fremden brachte eine Umorientierung der Wohnart mit sich und geschlossene Ortschaften entstanden, Europäer und Inder verdrängten die afrikanischen Bauten und errichteten ihre Wohnkomplexe.
-Demzufolge zeichnet die ethnische Mehrschichtigkeit der Bevölkerung afrikanische Städte aus, wobei die Gruppen jedoch oftmals ethnisch getrennt lebten. Den Afrikanern war oft der Bodenerwerb in der Stadt verboten und sie durften nur öffentliche Einrichtungen wie Polizei, Tankstellen und Post mitbenutzen.
-Einrichtungen wie Schule, Kirche usw. waren jedoch nach Gruppen getrennt.
-Lediglich die Inder, die in viele Sekten aufgeteilt sind, waren nach Gruppen getrennt und sie bauten ihre Häuser um ihre Moschee herum.
-Städte wie Mombasa und Sansibar in Ostafrika wurden durch die Araber gegründet, die das Städtewesen aus ihren Oasen-und Hafenstädten dorthin brachten.
-Sie nahmen jedoch nicht so großen Einfluß auf die afrikanischen Städte (was Aussehen betrifft), erstens da sie nicht so vertreten waren, und da sie in der afrikanischen Kultur aufgingen. Sie gründeten zudem keine eigenen Stadtviertel, nur einzelne Elemente wie geschnitzte Holzverkleidungen, blumendekorierte Innenhöfe und enge winklige Gassen des Bazars kennzeichnen noch heute Teile arabischer Stadtgründungen wie z.B. in Mombasa.
-Die Europäer nahmen größeren Einfluß, sie leiteten und gründeten Wirtschaftsunternehmen und technische Bauunternehmen.
-Sie bauten Appartements und Bungalows mit Veranden. Ihre Siedlungen legten sie meist in Schachbrettmuster an, mit Flachdächern wie die Araber, hielten aber meist an ihrer heimischer Bauweise fest und segretierten sich von den anderen ethnischen Gruppen.
-Die Inder kamen als Eisenbahn- und Plantagenarbeiter nach Afrika. Sie lebten in Kastenhäusern mit Dachverzierungen und hölzernen oder eisernen Fenstergittern. Im Gegensatz zu den Europäern lebten sie zu vielen Generationen in einem Haus.Genau wie die Araber haben sie auch Bazarviertel, die sich zur Straße richten, sie haben säulengetragene Veranden, die nachts mit Bretterverschlägen geschlossen werden. Es gibt im Gegensatz zur indischen Stadt keine Branchensortierung.
-Die afrikanische Wohnweise ist sehr verschieden innerhalb einer Stadt. Heute bilden die Afrikaner die Hauptgruppe in den Städten, früher hingegen kamen sie als Bedienstete der Europäer in die Städte und wohnten in extra Bedienstetenquartieren.
-Früher wurden für Afrikaner einfache Unterkünfte gebaut, heute leben sie in Mietwohnungen (Ein- oder Mehrfamilienhäusern).
-In den Elendsvierteln leben die Afrikaner auch heute noch in Wellblechhütten, in Südafrika meist auf gepachteten Europäer- oder Inderland. Oftmals leben viele afrikanischen Familien auf einem Hektar.
-Heute haben viele Afrikaner besser bezahlte Arbeitsplätze in der Stadt und können sich bessere Wohnungen leisten.
-Dadurch, daß viele Afrikaner sich heute bessere Wohnungen leisten können, sind sie oft nach Einkommensverhältnissen und nicht mehr nach Stämmen gegliedert. Die anglomerikanische Stadt -Vor Kolumbus gab es in Angloamerika keine geschlossenen Dauersiedlungen mit Ausnahme der Wohnplätze der Mound Builders und der Pueblo-Indianerdörfer, mit ihren mehrgeschossigen Adobe-Flachdachhäusern, die die Spanier den Indianern nachbauten und die sich im Rio- Grande Gebiet bis heute erhalten haben.
-Spanier, Fanzosen, Engländer , Holländer und Schweden kolonisierten Angloamerika
-Die kolonisierten Gegenden sind individueller als die uniformen Städte des Landesinneren. (Die ab 1800 gegründet wurden)
-Lage und Verteilung der Städte sind in den Landesteilen unterschiedlich.
-Die quadratische Vermessung in den Staaten westlich des Ohio und Mississippi erzeugten ein regelmäßiges Städtenetz.
-Bis etwa 1860 waren Handels-, Militär- und Verwaltungsfunktionen für das Entstehen und das Wachstum von Städten entscheidend, danach wurden Verkehrsnetz (Eisenbahn) und Industrie wichtig für die Entstehung von Städten.
-In Bergbaugebieten bildeten sich mit Erschöpfung der Bodenschätze sogenannte Geisterstädte (Ghosttowns). In klimatisch bevorzugten Gebieten wie Kalifornien und Florida entwickelten sich Pensionärsstädte (sun cities).
-In angloamerikanischen Städten gibt es im Gegensatz zu den lateinamerikanischen Städten keinen alten Stadtkern. Der courthouse square war der Ort des gesellschaftlichen und kommerziellen Lebens.
-Ortsnamen wie Athens, Ithaca, Rome, Troy, Syracuse und klassizistische Bauten sollten die fehlende Tradition ersetzen.
-Museen, Kapitole, Universitäten, Verwaltungsgebäude und Bankhäuser wurden im Stil von gríechischen Tempeln gebaut.
-Die Städte wurden im Schachbrettmuster angelegt, ab und zu nur etwas abgeändert durch eine Kombination mit Diagonalstraßen.
-Durch deutsche und skandinavische Siedler kam das Blockhaus nach Angloamerika. Es wurde als häufigstes Baumaterial Holz verwendet.
-1885 entstand der erste Wolkenkratzer, er war das Verwaltungsgebäude einer Versicherungsgesellschaft.
-Im Laufe der Zeit verdrängten die Wolkenkratzer die alten Häuser ohne Fahrstuhl.
Die Lateinamerikanische Stadt -Vor allem Portugiesen und Spanier kamen nach Südamerika und gründeten dort Städte -Fast alle Städte befinden sich in peripherer Lage, d.h. in Küstenlage. Besonders die Portugiesen wollten eine Verbindung von den neu gegründeten Städten zu ihrem Heimatland schaffen.
-Die Spanier errichteten ihre Städte als religiöse und militärische Stützpunkte, zum Teil in von ihnen eroberten Indianergebieten, im Hochland.
-Die Gebiete der hohen Gerichtshöfe der Spanier entwickelten sich später zu eigenständigen Staaten, ihre Mittelpunkte wurden zu den Hauptstädten.
-Da auch die Spanier auf die Küstenverbindung zum Heimatland angewiesen waren, waren die Hauptstädte meist auch Hafenstädte.(Montevideo/ Buenos Aires/ Rio de Janeiro)
-1521 erließ der spanische König den Erlaß, daß alle Städtegründungen in der neuen Welt im Schachbrettmuster zu erfolgen hätten.
-Später wurden auch Diagonalen hinzugefügt, im Zentrum wurde Platz gelassen für eine Kathedrale, das Bürgerratsgebäude und die Plaza für Gerichts- und Bankgebäude. Diese öffentlichen Gebäude wurden im kolonialspanischen Barockstil gebaut und waren ein Merkmal für die ersten lateinamerikanischen Städte.
-Diese Plaza stellte die einzige Auflockerung der Monotonie in den Wohnvierteln der Außenbezirke dar.
-In den jüngsten Wohnsiedlungen ging man vom Schachbrettmuster weg und ging zum europäischen Muster des unregelmäßigen Altstadtkerns, mit geplant gestalteten Außenvierteln über.
-Im Stadtzentrum leben vornehmlich die reicheren Schichten, ihre Häuser sind mit Ornamenten, Kuppeln und Türmchen überladen.
-Am Stadtrand hausen die armen Bevölkerungsschichten in Hütten. Man nennt diese Siedlungen Favelas -- Negersiedlungen
-Im Gegensatz zu den angloamerikanischen Stadtsiedlungen liegen die Slums hier am Rande, während sie in der angloamerikanischen Stadt innen, und die reicheren Stadtsiedlungen außen liegen.
-Mit der französischen Revolution kam eine zweite Bauepoche, in der protzig gebaut wurde, mit vielen Aufsätzen, Türmchen, Spitzen und Kuppeln. Alles wirkt unecht und unruhig an den Bauten dieser Zeit, das einzig Gute war die Errichtung der breiten Boulevards.
-In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann die dritte Periode, in der wegen der Erdbebengefahr mit der Eisenbetonbauweise und im Stil der Sacharchitektur gebaut wurde.
-Die wirtschaftliche mannigfaltige Entwicklung brachte auch eine bauliche Entwicklung mit sich. Zunächst wurden die üblichen Patiohäuser nur ausgebaut und der Patio überdacht und gewerblich genutzt. Später baute man Lagerhallen und -baracken zur Lagerung.
-Ca. 50 Jahre später (um 1935) als in Angloamerika wurde der erste Wolkenkratzer in Lateinamerika erbaut Daran waren auch die steigenden Bodenpreise schuld.
-Europäische Architekten errichteten das zu Lateinamerika passende Tropenhochhaus. Aluminiumlamellen sorgten für eine Beschattung und Kühlung der Fensterflächen. Es überwiegen kubische Formen, die Umrisse scheinen ruhiger als die der angloamerikanischen Städte.
-Durch die Geschäftshochhäuser wurden Wohnviertel und Geschäftsviertel voneinander getrennt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptaussagen zum kulturgenetischen Ansatz im Text "Die Stadt im interkulturellen Vergleich"?
Der kulturgenetische Ansatz besagt, dass kosmologische, religiöse, ökonomische, politische und planerische Vorstellungen das Stadtbild beeinflusst haben. Um Städte zu betrachten, muss man sich auf eine mittlere Betrachtungsebene begeben und die Gemeinsamkeiten der Städte eines Teilraumes der Erde untersuchen. Auf der allgemeinsten Ebene lassen sich wenige kulturgenetische Stadttypen unterscheiden, die sich in Kulturerdteilen zusammenfassen lassen. Ein Kulturerdteil zeichnet sich durch einen individuellen Ursprung der Kultur, eine einzigartige Verbindung von Natur- und Kulturelementen und eine selbstständige Ordnung geistiger und materieller Aspekte aus.
Welche Kulturerdteilzuordnung wird im Text genannt?
Der Text erwähnt die Kulturerdteilzuordnung nach Beaujeu-Garnier/Chabot 1963, mit folgenden Erdteilen: Abendländischer Kulturerdteil (Nord-, Zentral-, West-, Mittelmeer- und Osteuropa), Russischer Kulturerdteil (Traditionelles Russland, Sowjetasien), Orientalischer Kulturerdteil (Orient, Nordafrika), Indischer Kulturerdteil (Süd- und Südostasien), Sinischer Kulturerdteil (Ferner Osten), Australpazifischer Kulturerdteil (Australien/Neuseeland), Negrider Kulturerdteil (Afrika südlich der Sahara), Germanischamerikanischer Kulturerdteil (Amerika nördlich des Rio Grande), Iberoamerikanischer Kulturerdteil (Amerika südlich des Rio Grande).
Wie werden alte und junge Städte unterschieden?
Altkulturstädte, wie z.B. orientalische und chinesische Städte, bestehen eher aus selbst gewachsenen Elementen, während jüngere Städte eher geplant und oft monoton gleich im Erscheinungsbild sind.
Was sind charakteristische Merkmale der orientalischen Stadt?
Die orientalische Stadt ist oft eine Quell- oder Flussoasenstadt, die zum Schutz vor Nomaden von der Umgebung abgeschlossen war. Typisch sind ein baumartig verzweigtes System von Sackgassen, winkeligen Knickgassen, überbauten Tunnelgassen, schmale Durchgänge, Häuser aus Luftziegeln und Abwasserrinnen, die quer durch die Stadt laufen. Der Innenhof der Häuser ist oft schön gestaltet, während die Häuser nach außen hin nichtssagend sind. Im Stadtkern befinden sich Hauptmoschee und Bazar.
Wie war die Warenordnung auf dem orientalischen Bazar geregelt?
Auf dem Bazar waren die Waren nach Branchen geordnet, abgestuft nach der Wertschätzung der Waren. Brokatstoffe, Bücher oder Goldschmuck gehörten zu den besten Waren und lagen der Hauptbazargasse am nächsten. Blech-/Seilerwaren und andere mindere Waren wurden in den Nebengassen verkauft. Jede Ladenstraße hatte einen Vormann.
Wie hat sich die orientalische Stadt seit 1930 verändert?
Seit etwa 1930 haben sich orientalische Städte verändert. Fernstraßen wurden gebaut, Stadtmauern abgerissen, Häuser wurden mehrgeschossig und der Grundriß wird, je weiter man sich vom Stadtkern entfernt, regelmäßiger. In neueren Städten gibt es westliche Geschäftszentren und ein hohes Verkehrsaufkommen.
Was kennzeichnet die afrikanische Stadt?
Bis auf wenige Ausnahmen sind die Städte in Afrika von Arabern oder Europäern gegründet worden. Die ethnische Mehrschichtigkeit der Bevölkerung ist typisch, wobei die Gruppen oft ethnisch getrennt lebten. Europäer bauten Appartements und Bungalows meist im Schachbrettmuster, während Inder in Kastenhäusern mit Dachverzierungen lebten. Die afrikanische Wohnweise ist sehr verschieden, von einfachen Unterkünften bis zu Mietwohnungen und Wellblechhütten in Elendsvierteln.
Was sind die Besonderheiten der angloamerikanischen Stadt?
Vor der Kolonialisierung gab es in Angloamerika keine geschlossenen Dauersiedlungen. Die kolonisierten Gegenden sind individueller als die uniformen Städte des Landesinneren. Es gibt keinen alten Stadtkern. Der Courthouse Square war der Ort des gesellschaftlichen und kommerziellen Lebens. Die Städte wurden im Schachbrettmuster angelegt. Das Blockhaus wurde als häufigstes Baumaterial verwendet. Der erste Wolkenkratzer entstand 1885.
Was zeichnet die lateinamerikanische Stadt aus?
Die Städte wurden vor allem von Portugiesen und Spaniern gegründet, meist in Küstenlage. Spanische Städte waren oft religiöse und militärische Stützpunkte, im Schachbrettmuster angelegt. Im Zentrum befindet sich eine Plaza mit Kathedrale, Bürgerratsgebäude und Gerichts- und Bankgebäude. Im Stadtzentrum leben die reicheren Schichten, am Stadtrand die armen Bevölkerungsschichten in Favelas. Seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Eisenbetonbauweise im Stil der Sacharchitektur eingesetzt. Später entstanden Tropenhochhäuser mit Aluminiumlamellen zur Beschattung.
- Quote paper
- Natalie Taepel (Author), 1996, Die Stadt im interkulturellen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97932