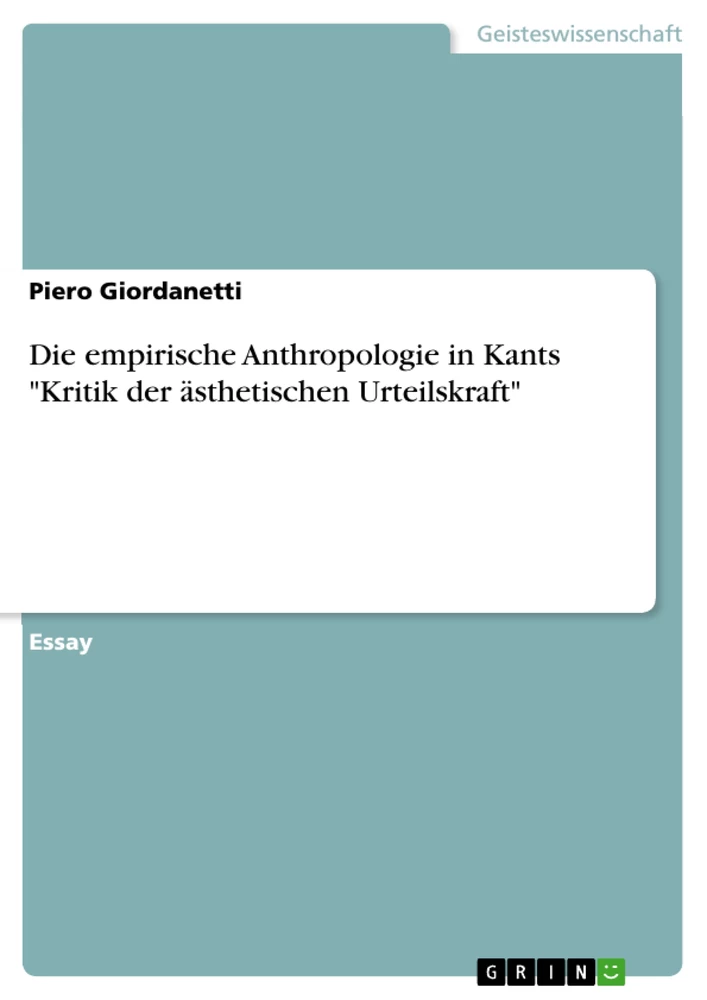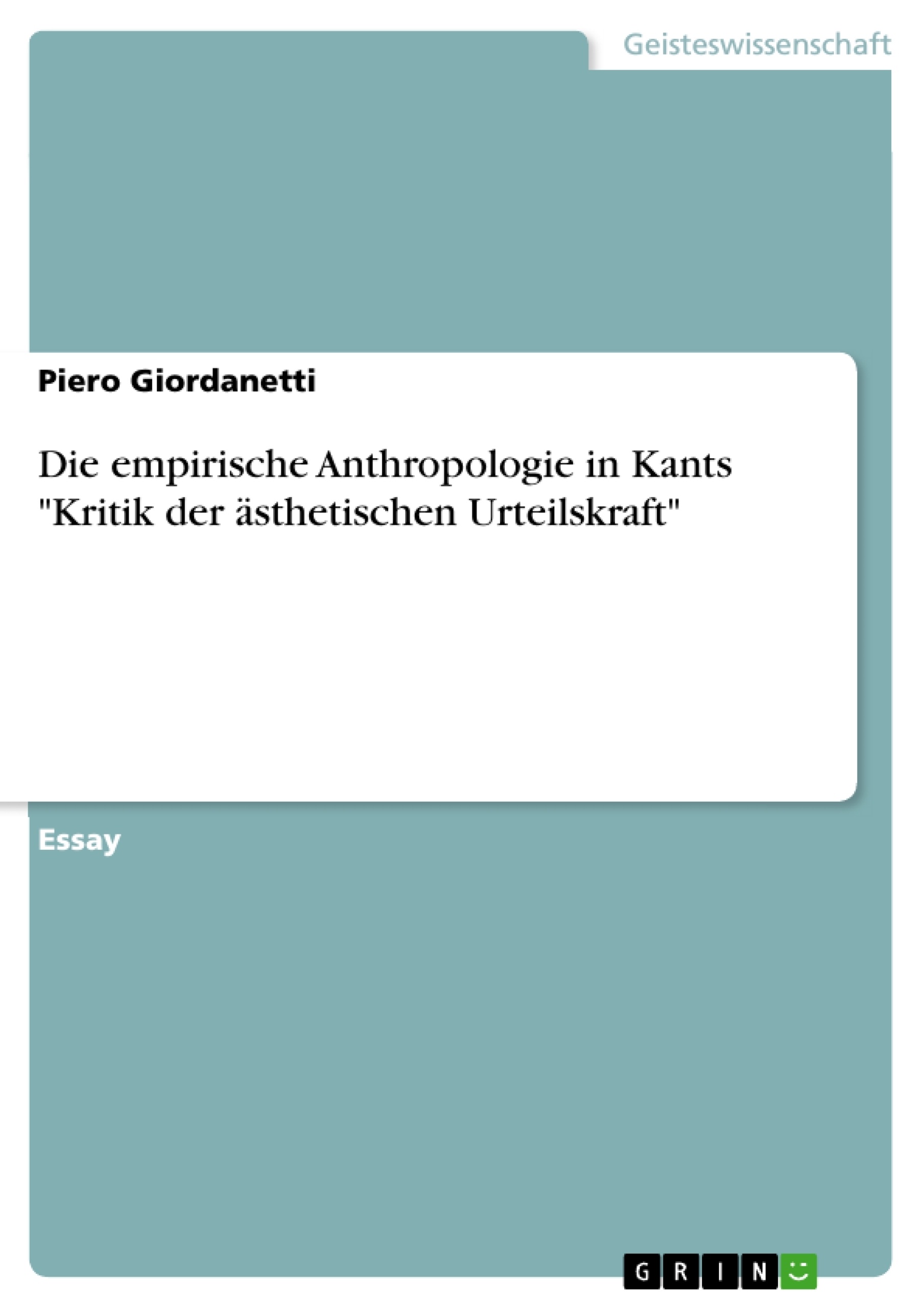Der Beitrag setzt sich zum Ziel, aufzuzeigen, daß sich die "Kritik der ästhetischen Urteilskraft" auch als Dokument bewerten läßt, um unsere Kenntnis von Kants Anthropologie um 1790 zu erweitern, also zu einer Zeit, die uns durch keine uns erhaltene Vorlesungsnachschrift zugänglich ist. Es soll die These bewiesen werden, daß nicht wenige Lehrstücke der "Kritik der ästhetischen Urteilskraft" eine empirisch-anthropologische Theorie enthalten. Die Analyse wird sich auf einige dieser Themen konzentrieren: nämlich auf die Rolle der unwillkürlichen produktiven Einbildungskraft in der "Allgemeinen Anmerkung zur Analytik", auf die Unterscheidung zwischen Affekten und Leidenschaften, auf den Rekurs auf die leibnizsche Lehre der dunklen Vorstellungen im § 28 der »Analytik des Erhabenen«, und auf die in Anlehnung an Epikur und Burke entwickelte Theorie von Vergnügen und Schmerz. Die Berücksichtigung dieser Themen trägt dazu bei, die Kenntnis der Kantischen Theorie zu vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
- Die empirische Anthropologie in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft
- Einleitung
- Die »Allgemeine(n) Anmerkung zur Analytik«
- Affekte und Leidenschaften
- Dunkle Vorstellungen
- Vergnügen und Schmerz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Beitrag setzt sich zum Ziel, die »Kritik der ästhetischen Urteilskraft« als Dokument zur Erweiterung unserer Kenntnis von Kants Anthropologie um 1790 zu betrachten. Die These wird aufgestellt, dass die »Kritik der ästhetischen Urteilskraft« eine empirisch-anthropologische Theorie beinhaltet.
- Die Rolle der unwillkürlichen produktiven Einbildungskraft in der »Allgemeinen Anmerkung zur Analytik«
- Die Unterscheidung zwischen Affekten und Leidenschaften
- Die leibnizsche Lehre der dunklen Vorstellungen im § 28 der »Analytik des Erhabenen«
- Die Theorie von Vergnügen und Schmerz in Anlehnung an Epikur und Burke
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung thematisiert die scheinbar widersprüchliche Verbindung zwischen Kants Kritik der empirischen Psychologie und seiner eigenen anthropologischen Theorie in der »Kritik der ästhetischen Urteilskraft«.
- Die »Allgemeine Anmerkung zur Analytik« untersucht die Rolle der unwillkürlichen produktiven Einbildungskraft im Geschmack, indem sie schöne Gegenstände von schönen Aussichten auf Gegenstände abgrenzt und Beispiele wie das Kaminfeuer, weite Aussichten und den Bach heranzieht.
- Der Abschnitt über Affekte und Leidenschaften beleuchtet ihre Unterschiede und diskutiert, welche Affekte als erhaben gelten können. Empfindelei, zärtliche Rührungen, Romane und weinerliche Schauspiele werden als Beispiele für nicht erhabene Affekte angeführt.
- Der § 28 befasst sich mit dem Erhabenen und der Beobachtung des Menschen. Die gemeinste Beurteilung des Erhabenen, die auf der Furcht vor der Macht der Natur beruht, wird mit Kants Theorie der dunklen Vorstellungen und der dunklen Verstandestätigkeit in Verbindung gebracht.
- Der Abschnitt über Vergnügen und Schmerz betrachtet Burkes physiologische Erklärung des Schönen und Erhabenen im Kontext der empirischen Anthropologie. Kant argumentiert, dass jede Vorstellung, die das Gefühl des Lebens affiziert, mit Vergnügen oder Schmerz verbunden ist und dass diese Verbindung den Körper voraussetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die empirische Anthropologie im Kontext der »Kritik der ästhetischen Urteilskraft« von Kant. Zentral sind Themen wie die unwillkürliche produktive Einbildungskraft, Affekte und Leidenschaften, die leibnizsche Lehre der dunklen Vorstellungen, Vergnügen und Schmerz, sowie Burkes physiologische Erklärung des Schönen und Erhabenen.
- Citar trabajo
- Piero Giordanetti (Autor), 2020, Die empirische Anthropologie in Kants "Kritik der ästhetischen Urteilskraft", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978553