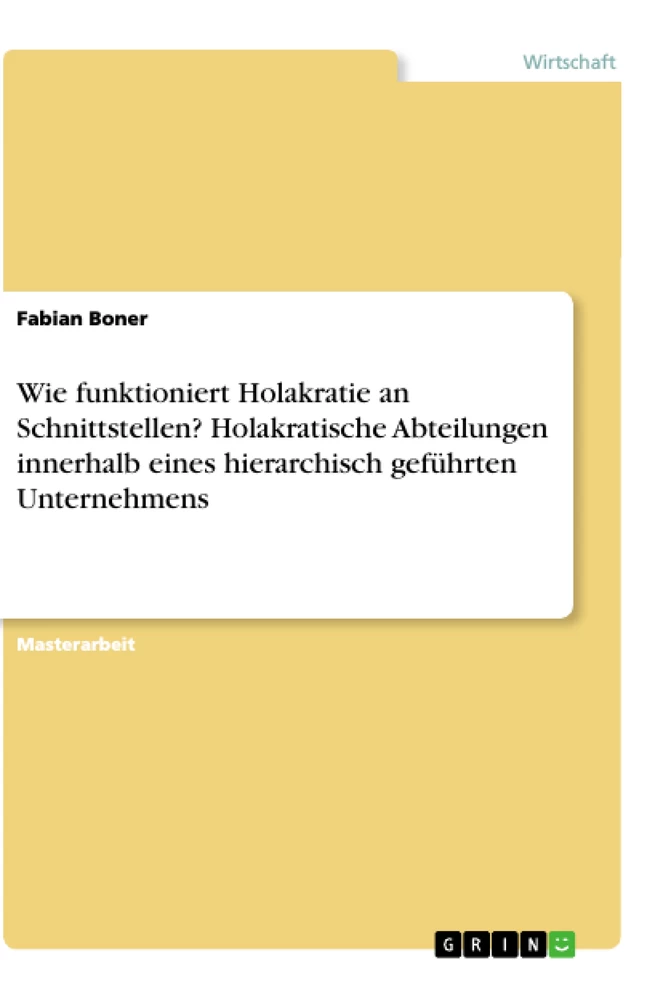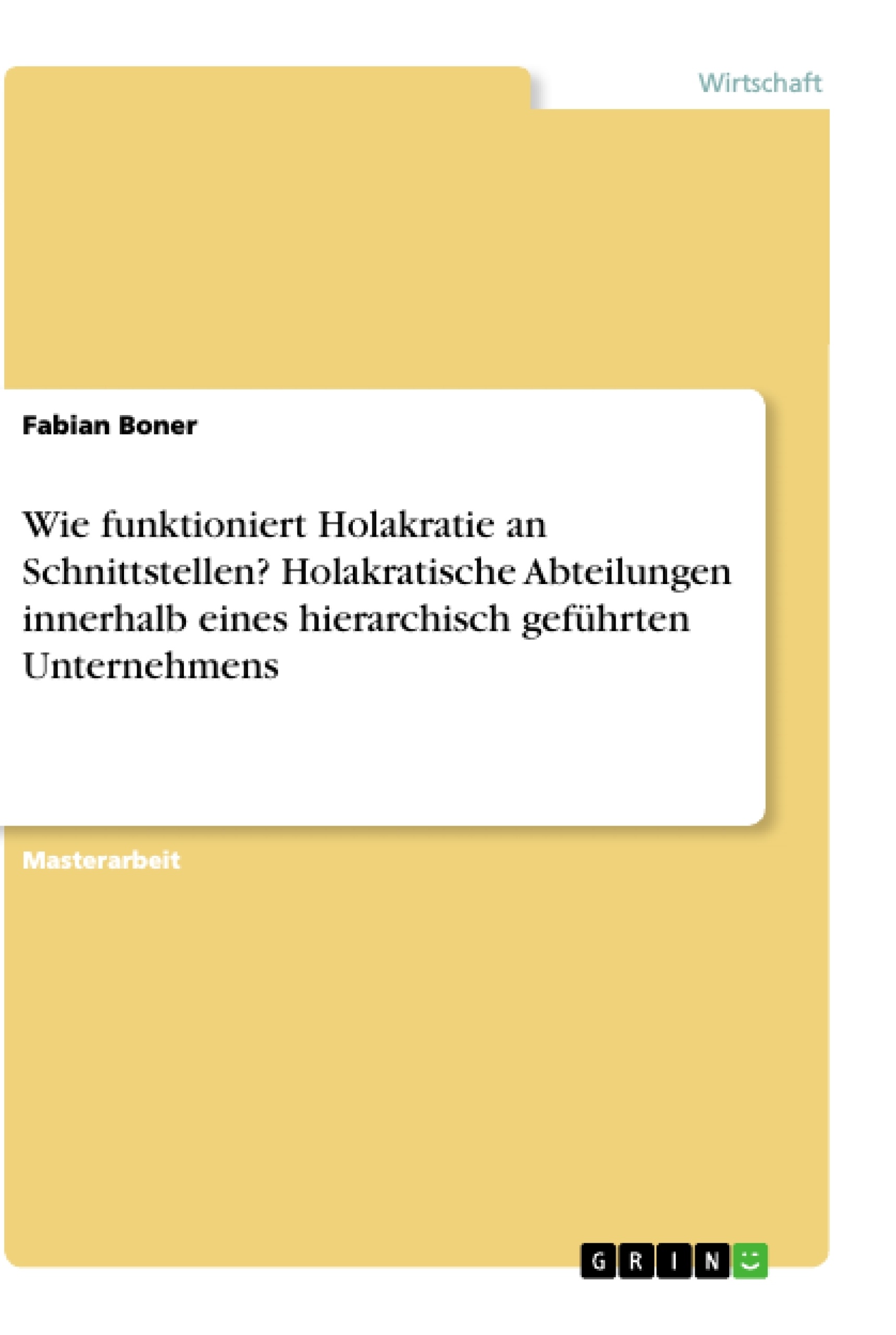In der vorliegenden Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, welche Schnittstellen zwischen den holakratisch geführten Bereichen eines Unternehmens und den hierarchisch aufgestellten Abteilungen reibungslos miteinander agieren, und welche dieser Schnittstellen zu Problemen führen können.
Um die Verständnisfrage der Schnittstellenthematik zu verstehen, ist auf das frei vom Englischen übersetzte Zitat von Christiane Seuhs-Schoeller (Bretones, 2020) zu verweisen: "Menschliche Verhaltensmuster wie Denkweise oder Benehmen sind schwierig zu ändern, anpassungsfähiger ist die pure Verschiebung der Organisation." Eine empirische Auswertung mittels Interviews mit einer Expertin und vier Experten, welche mehrheitlich in holakratisch geführten Unternehmen in der Schweiz praxisbezogen arbeiten oder arbeiteten, stellen zusammen mit der verfügbaren Literatur klar, welche Schnittstellen funktionieren und welche weiter verfeinert werden müssen, damit das holakratische Hybridmodell oder aber ein agiles Modell der Selbstorganisation künftig erfolgreich installiert werden kann. Auch wenn die in dieser Arbeit ausgewiesenen und im holakratischen Hybridmodell fungierenden Schweizer Unternehmen zumeist das holakratische Modell wieder de-ratifiziert haben, ist der Auswertung zu entnehmen, dass Schnittstellen-Problemfelder mittlerweile gezielt erkannt sowie lösungsorientiert und effizient angegangen werden. Nichtsdestotrotz steht am Ende eine nüchterne Bilanz des holakratisch geführten Hybridmodells in der Schweiz zu Buche: von den vier bekannten Unternehmen, die sechs Bereiche dem holakratischen Selbstorganisationsmodell unterwarfen, wird kurzfristig wohl mit den SBB nur noch ein einziges Unternehmen mit einem internen Geschäftsbereich dem holakratischen Hybridmodell treu bleiben.
Vor dem Hintergrund, künftige Interessenten von agilen Führungsmodellen rundum und umfassend über heikle Schnittstellenprobleme mit der traditionellen Hierarchie aufklären und beraten zu können, wurde der Fokus logischerweise auch auf negative Aspekte und Erfahrungen gelegt. Konkret werden im Kontext zur spärlich vorhandenen Literatur mittels empirischer Ansätze Schnittstellenprobleme der Holakratie zur Hierarchie aufgezeigt und spezifische Lösungsmöglichkeiten diskutiert und aufgezeigt. Mit dieser Vorgehensweise kann nach Meinung des Autors dieser Arbeit die angepeilte Forschungsfrage kompetent und umfänglich beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangslage
- 1.2 Phänomen
- 1.3 Relevanz
- 1.3.1 Spezifische Relevanz
- 1.3.2 Allgemeine Relevanz
- 1.4 Ziele der Arbeit
- 1.4.1 Teilziele
- 1.4.2 Ziel
- 1.5 Zentrale Fragestellungen
- 1.6 Abgrenzungen
- 1.7 Aufbau der Arbeit
- 2 Theorieteil
- 2.1 Erster Teil - Das holakratische Organisationsmodell
- 2.2 Merkmale in der Holakratie
- 2.2.1 Eine sich entwickelnde Organisation
- 2.2.2 Verteilung von Autorität
- 2.2.3 Organisationsstruktur
- 2.3 Elemente in der Holakratie
- 2.3.1 Verfassung
- 2.3.2 Kreise und Sub-Kreise
- 2.3.3 Rollen
- 2.3.4 Meetings
- 2.4 Kritik am holakratischen Organisationsmodell
- 2.5 Stand von holakratischen Unternehmen in der Schweiz im Jahr 2020
- 2.6 Zweiter Teil - Das holakratische Hybridmodell
- 2.6.1 Unternehmen mit Bezug zum holakratischen Hybridmodell in der Schweiz
- 2.7 Voraussetzungen für ein holakratisches Hybridmodell
- 2.8 Schnittstellenfaktoren beim holakratischen Hybridmodell
- 2.8.1 Faktoren im Kontext des hierarchischen Umfelds
- 2.8.2 Faktoren der Implementation in die Organisation
- 2.8.3 Faktoren der Führung
- 2.8.4 Faktoren der Mitarbeitenden
- 2.8.5 Faktoren der Meeting Kultur
- 2.8.6 Faktoren der Transparenz
- 2.8.7 Faktoren der Kunden
- 2.9 Konklusion
- 3 Methodenteil
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Qualitatives Vorgehen
- 3.2.1 Begründung der Methodenwahl
- 3.2.2 Auswahl Experten/-innen
- 3.2.3 Vorbereitung der Interviews
- 3.2.4 Interviewleitfaden und Ablauf der Interviews
- 3.2.5 Durchführung der Interviews
- 3.2.6 Nachbearbeitung der Interviews
- 3.3 Methode der Auswertung
- 3.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.4 Gütekriterien der Forschungsarbeit
- 3.4.1 Validität, Reliabilität und Objektivität
- 3.4.2 Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite
- 3.5 Zusammenfassung des Methodenteil
- 4 Auswertungsteil
- 4.1 Auswertung der Interviews mit der Expertin und den Experten
- 4.1.1 Gründe und Grundvoraussetzungen für das holakratische Hybridmodell
- 4.1.2 Herausforderungen Schnittstelle zur Hierarchie
- 4.1.3 Einfache und problemlose Implementation von Schnittstellen
- 4.1.4 Problempunkte und Lösungsansätze von Schnittstellen
- 4.1.5 Nicht effizient lösbare Schnittstellen zur Hierarchie
- 4.1.6 Wahrnehmungen des Managements und der Mitarbeitenden
- 4.1.7 Weiterentwicklungen des holakratischen Hybridmodells
- 4.2 Ergebnisse der Befragungen und daraus erwachsene Diskussionspunkte
- 4.2.1 Schnittstellen zum hierarchischen Umfeld
- 4.2.2 Schnittstellen der Implementation in die Organisation
- 4.2.3 Schnittstellen der Führung
- 4.2.4 Schnittstellen bei den Mitarbeitenden
- 4.2.5 Schnittstellen der Meetings
- 4.2.6 Schnittstellen der Transparenz
- 4.2.7 Schnittstellen mit den Kunden
- 4.2.8 Neue Erkenntnisse von Schnittstellen
- 4.3 Konklusion
- 5 Fazit und Ausblick
- 5.1 Schlussbetrachtungen
- 5.2 Handlungsempfehlungen
- 5.3 Ausblick
- 5.4 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Schnittstellen zwischen holakratisch und hierarchisch geführten Bereichen in Unternehmen. Ziel ist es, reibungslos funktionierende und problematische Schnittstellen zu identifizieren und Lösungsansätze zu diskutieren. Die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews mit Experten aus der Schweizer Wirtschaft.
- Analyse des holakratischen Organisationsmodells und des holakratischen Hybridmodells.
- Identifikation von Schnittstellenproblemen zwischen holakratischen und hierarchischen Strukturen.
- Bewertung der Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Implementierung eines holakratischen Hybridmodells.
- Entwicklung von Lösungsansätzen für die identifizierten Schnittstellenprobleme.
- Bewertung der Erfahrungen Schweizer Unternehmen mit dem holakratischen Hybridmodell.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der holakratischen Organisationsmodelle und deren Implementierung in hierarchisch strukturierten Unternehmen ein. Es beschreibt die Ausgangslage, die Relevanz des Themas und die spezifischen Ziele der Arbeit. Die zentralen Forschungsfragen werden formuliert und der Aufbau der Arbeit erläutert. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Untersuchung, indem sie den Kontext und den Fokus der Arbeit klar definiert.
2 Theorieteil: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das holakratische Organisationsmodell und das holakratische Hybridmodell. Es beschreibt die Merkmale und Elemente der Holakratie, wie z.B. die Verteilung von Autorität, die Organisationsstruktur, Kreise, Rollen und Meetings. Kritische Aspekte des Modells werden ebenso behandelt wie der Stand der Implementierung in der Schweiz. Der zweite Teil des Kapitels konzentriert sich auf das Hybridmodell, beleuchtet die Voraussetzungen für dessen Erfolg und analysiert Schnittstellenfaktoren in verschiedenen Bereichen wie dem hierarchischen Umfeld, der Implementierung, der Führung, den Mitarbeitenden, der Meetingkultur, der Transparenz und den Kundenbeziehungen. Dieses Kapitel liefert die theoretische Grundlage für die spätere empirische Untersuchung.
3 Methodenteil: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es rechtfertigt die Wahl eines qualitativen Ansatzes, erläutert die Auswahl der Interviewpartner (Experten aus holakratisch geführten Unternehmen in der Schweiz), den Ablauf der Interviews und die Methode der Auswertung (qualitative Inhaltsanalyse). Es werden zudem die Gütekriterien der Forschung (Validität, Reliabilität, Objektivität, Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite) dargelegt. Dieser Abschnitt garantiert die Nachvollziehbarkeit und die wissenschaftliche Fundiertheit der Ergebnisse.
4 Auswertungsteil: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit den Experten. Es analysiert die Gründe und Voraussetzungen für ein holakratisches Hybridmodell, die Herausforderungen an der Schnittstelle zur Hierarchie, die Implementation von Schnittstellen, sowie Problempunkte und Lösungsansätze. Die Wahrnehmungen des Managements und der Mitarbeitenden werden beleuchtet, und mögliche Weiterentwicklungen des Modells werden diskutiert. Dieser Abschnitt liefert die Kernbefunde der empirischen Untersuchung.
Schlüsselwörter
Holakratie, Hybridmodell, hierarchische Organisation, Selbstorganisation, Schnittstellenmanagement, qualitative Forschung, Interviews, Schweiz, agile Führung, Implementierung, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Holakratische Hybridmodelle in der Schweiz
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Schnittstellen zwischen holakratisch und hierarchisch geführten Bereichen in Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Identifizierung reibungslos funktionierender und problematischer Schnittstellen sowie der Diskussion möglicher Lösungsansätze. Die Arbeit basiert auf qualitativen Interviews mit Experten aus der Schweizer Wirtschaft.
Welche Modelle werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das holakratische Organisationsmodell und das holakratische Hybridmodell. Es werden die Merkmale, Elemente und kritischen Aspekte der Holakratie beleuchtet, sowie der Stand der Implementierung in der Schweiz.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet einen qualitativen Forschungsansatz. Die Datenbasis bilden Interviews mit Experten aus der Schweizer Wirtschaft. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Die Gütekriterien der Forschung (Validität, Reliabilität, Objektivität, Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite) werden explizit berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse des holakratischen Organisationsmodells und des holakratischen Hybridmodells; Identifikation von Schnittstellenproblemen zwischen holakratischen und hierarchischen Strukturen; Bewertung der Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Implementierung eines holakratischen Hybridmodells; Entwicklung von Lösungsansätzen für die identifizierten Schnittstellenprobleme; Bewertung der Erfahrungen Schweizer Unternehmen mit dem holakratischen Hybridmodell.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Ausgangslage, Relevanz, Ziele, Forschungsfragen, Aufbau); Theorieteil (Holakratie, Hybridmodell, Voraussetzungen, Schnittstellenfaktoren); Methodenteil (qualitatives Vorgehen, Interviewdurchführung, Auswertung, Gütekriterien); Auswertungsteil (Auswertung der Interviews, Ergebnisse, Diskussion); Fazit und Ausblick (Schlussbetrachtungen, Handlungsempfehlungen, Ausblick).
Welche konkreten Ergebnisse werden präsentiert?
Der Auswertungsteil präsentiert die Ergebnisse der Experteninterviews. Analysiert werden Gründe und Voraussetzungen für ein holakratisches Hybridmodell, Herausforderungen an der Schnittstelle zur Hierarchie, die Implementation von Schnittstellen, Problempunkte und Lösungsansätze. Die Wahrnehmungen des Managements und der Mitarbeitenden werden beleuchtet, und mögliche Weiterentwicklungen des Modells werden diskutiert.
Wer sind die Interviewpartner?
Die Interviewpartner sind Experten aus holakratisch geführten Unternehmen in der Schweiz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Holakratie, Hybridmodell, hierarchische Organisation, Selbstorganisation, Schnittstellenmanagement, qualitative Forschung, Interviews, Schweiz, agile Führung, Implementierung, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Aufbau der Arbeit?
Das Inhaltsverzeichnis im ersten Abschnitt der HTML-Datei bietet eine detaillierte Übersicht über den Aufbau der Arbeit mit allen Kapiteln und Unterkapiteln.
- Quote paper
- Fabian Boner (Author), 2020, Wie funktioniert Holakratie an Schnittstellen? Holakratische Abteilungen innerhalb eines hierarchisch geführten Unternehmens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978520