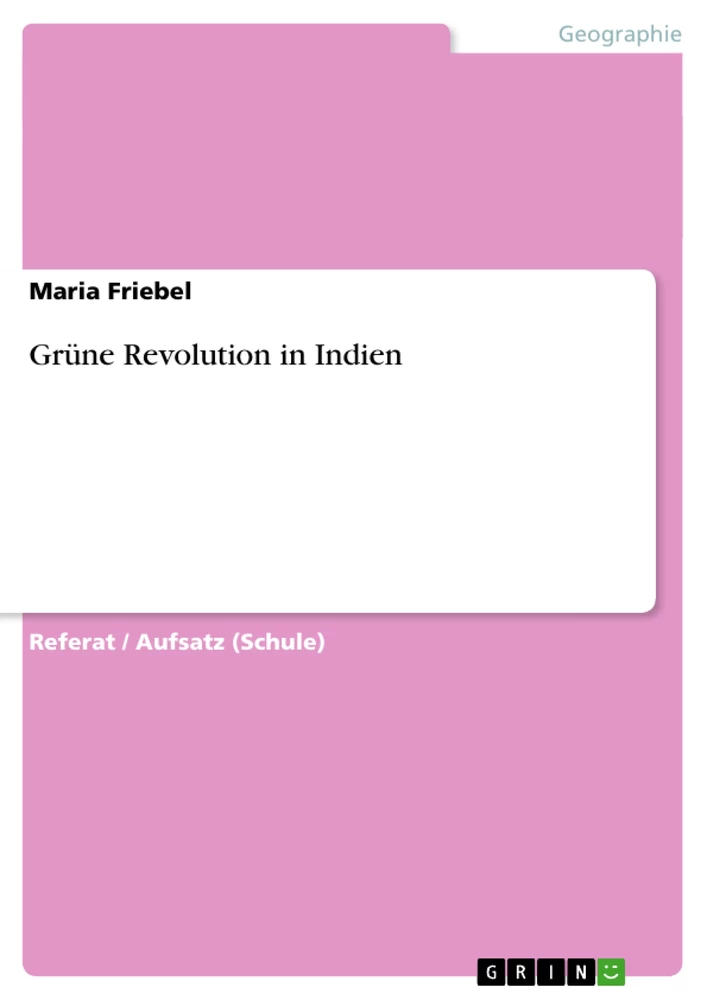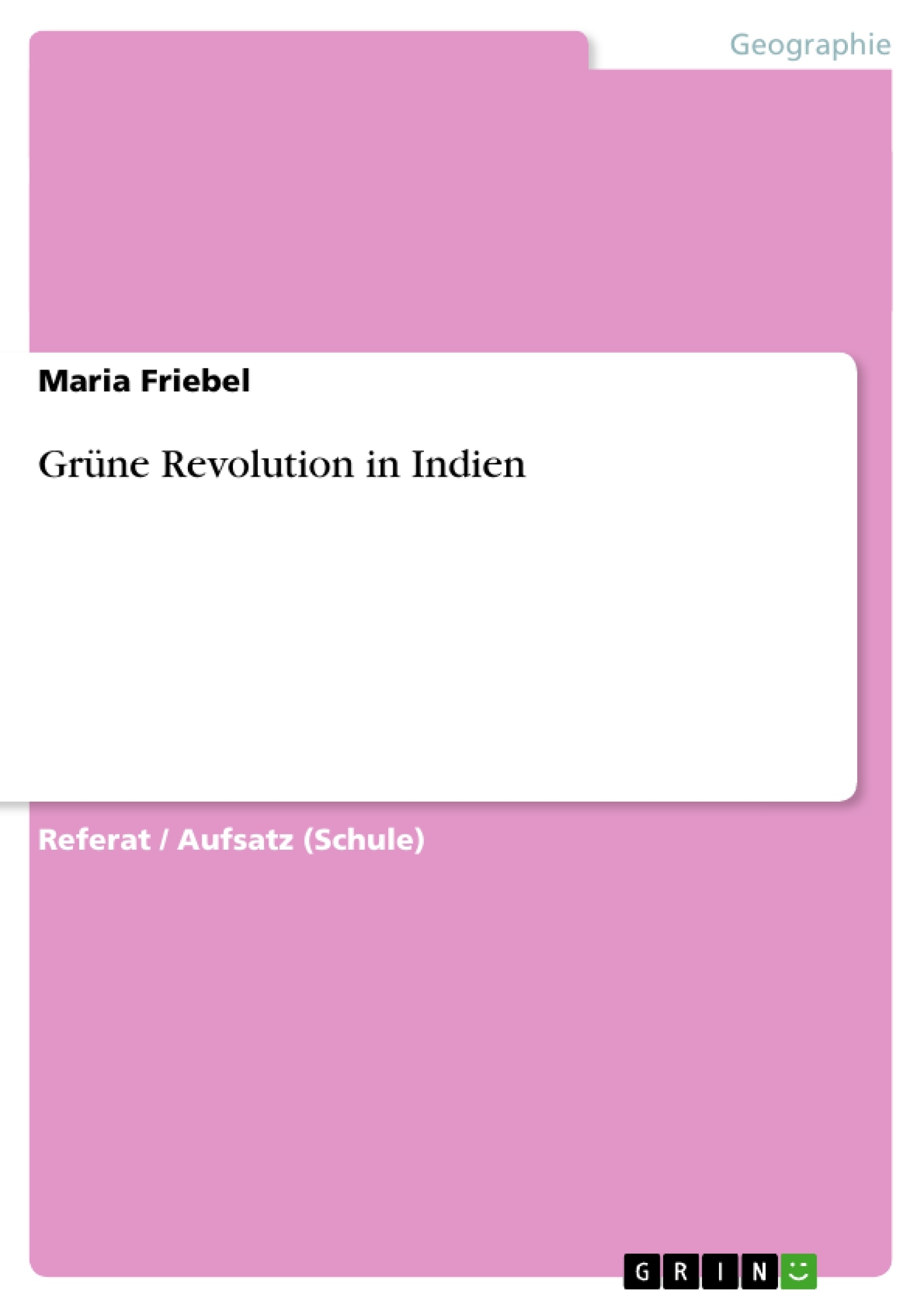Stellen Sie sich ein Indien vor, geplagt von Armut und Hunger, am Rande einer demografischen Katastrophe. Inmitten dieser düsteren Realität keimt eine revolutionäre Idee auf: die Grüne Revolution. Ein ehrgeiziges Unterfangen, das darauf abzielt, die Nahrungsmittelproduktion des Landes dramatisch zu steigern und Millionen aus dem Elend zu befreien. Doch zu welchem Preis? Diese fesselnde Analyse enthüllt die komplexe Geschichte der Grünen Revolution in Indien, von ihren ambitionierten Zielen bis hin zu ihren verheerenden Konsequenzen. Erfahren Sie, wie die Einführung von Hochertragssorten, Kunstdüngern und intensiver Bewässerung das Gesicht der indischen Landwirtschaft veränderte. Entdecken Sie die beeindruckenden Erfolge, die Indien von einem hungernden Land zu einem Weizenexporteur machten, und die damit einhergehenden sozialen und ökologischen Kosten. Tauchen Sie ein in die Welt der Landwirte, die mit neuen Technologien kämpfen, sich in Schulden verstricken und ihre traditionelle Lebensweise verlieren. Untersuchen Sie die Auswirkungen auf die Umwelt, von der Bodendegradierung bis hin zur Grundwasserverschmutzung, und die langfristigen Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung. Diese tiefgründige Untersuchung beleuchtet die unvorhergesehenen Folgen einer vermeintlichen Lösung für ein drängendes Problem und stellt die Frage, ob der Nutzen die Kosten wirklich aufwiegt. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Versprechen und Fallstricken technologischer Innovationen im Kontext von Entwicklungsländern, die Leser dazu anregt, die komplexen Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft, Armut, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit neu zu bewerten. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für globale Entwicklung, Agrarpolitik und die Zukunft der Ernährungssicherheit interessieren. Es wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit ganzheitlicher Lösungsansätze, die sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen und ökologischen Dimensionen berücksichtigen, um eine wirklich nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Die Grüne Revolution: Ein Wendepunkt in der indischen Geschichte, der bis heute nachwirkt und uns wichtige Lehren für die Zukunft lehrt. Eine Reise durch Triumph und Tragödie, die das komplexe Zusammenspiel von Fortschritt und seinen Konsequenzen offenbart.
Die Grüne Revolution in Indien
- aufgrund der großen Armut und des explosiven Bevölkerungswachstums: EWL=riesiges Hungerproblem
Ziele: (der Indischen Reg.)
- schnelle und nachhaltige Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion ohne dabei die Agrarstruktur wesentlich zu verändern
⇒ dauerhafte Überwindung von Armut und Hunger ( die Hälfte der ländl. Bev. Indiens betroffen)
- nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der armen Landbewohner
- Abbau der Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten aus dem Ausland (Selbstversorgung)
Versuche einer Bodenreform:
- 1948 Agrarreform (Auflsg. der Großbetriebe → Verteilung des Landes an Kleinbauern u. Landlose → wirkungslos)
- 1952 - 1960 Dorfentwicklungsprogramm (Förderung d. ges. ländl. Raumes in Indien → Programm auf wenige Gebiete beschränkt, zu hohe wirtsch. u. soziale Unterschiede in den Dörfern)
- seit 1966 Grüne Revolution: landwirtsch. bzw. ländliches Modernisierungsprogramm
⇒ „Saatgut-Wasser-Düngertechnologie“
Maßnahmen:
Einführung von moderner Agrarwissenschaft und neuester Agrartechnik, d.h.:
- Einsatz/ Anbau von schnellwachsenden Hochertragssorten (High Yielding Varieties)
v. a. von Weizen, Reis und Mais > Hybridpfl. (Gentechnologie), Zuchtwahl
→ Grundlage: Weizensorten, die Anfang der 40er Jahre in Mexiko und Reissorten, die seit den 60er Jahren auf den Philippinen gezüchtet wurden
⇒ neues Saatgut steigert die Erträge nur unter best. Bedingungen: → sonst niedrige Erträge
> abhängig von ~
- Einsatz von Kunstdüngemitteln → muß in best. Mischungen durch den Bauern gekauft werden
- ausreichende, regelmäßige Bewässerung durch Bewässerungsanlagen, wie z.B. mechanische Tiefbrunnen (Foto: S. 171 oben) Grafik: „Schwerpunkte der GR“
→ intensive Bewässerung notwendig, um maximale Menge an Kunstdünger aufzunehmen
- verstärkter Einsatz von Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden , da importierte Arten = wesentl. anfälliger für Krankheiten, Insekten, Pilzbefall und andere Umwelteinflüsse (empfindl.) → aufgrund mangelnder Durchlüftung
- Mechanisierung/ moderne Bearbeitungsmethoden => M4 Lb. S. 170
> Gebrauch von modernen landwirtsch. Maschinen ( Bewässerungspumpe, Traktor, Mähdrescher)
- Ausbau der Infrastruktur: des Straßen- und Bewässerungsnetzes, starke Vergrößerung der Anbauflächen (nur in bewässerten Gebieten; also Geb., die sich für die GR eignen)
- Verbesserung der Lagerungs- und Vermarktungsorganisation
Erfolge/Vorteile:
- erhebliche Steigerung der Getreideproduktion (von 74 Mio t (1966) auf 131 Mio t (1978))
⇒ Verbesserung der Ernährungssituation
> bi s zu 7 mal höhere Erträge als bisher; höhere Hektarerträge
- neue Reissorten: kürzere Halme (Knickfestigkeit), aufrechte Blätter (bessere Aufnahme von Sonnenlicht), mehr Kalorien im Korn, kürzere Reifezeiten (100-130 d) => mehrere Ernten (bis zu 3)
- Übergang von der Subsistenzwirtschaft (Eigenversorgungswirtschaft) zur Produktion für den Weltmarkt
→ Indien: vom Hungerland zum Weizenexporteur
Probleme/Nachteile: > enorm hoher Energieverbrauch der Technik → fossile Energie = teuer
- Abhängigkeit von der Versorgung mit Treibstoff, Düngemitteln und Unkrautvertilgern d.h.: Abhängigkeit von Saatgutproduzenten (profitieren), Chemieunternehmen (aus dem Ausland)
- Verlust der Pflanzenvielfalt (Vernichtung herkömmlicher Getreidearten) → genet. Verarmung der Tier- und Pflanzenwelt → FAO (Konservierung der Pfl.sorten)
- erzeugter Reis wird durch den Einsatz der Agrartechnologie teurer (steigende Prod.kosten)
→ Reis wird für die armen Bev.schichten unerschwinglich → nach wie vor Hunger und Unterernährung in Indien → Reg. 1978: neues Hilfsprogramm: durch verbilligte Grundnahrungsmittel u. zusätzl. Beschäftigungsmöglichkeiten Armut in den Dörfern bekämpfen → jährlich vom Staat ca. 10 - 15 % der Getreideprod. zu staatl. festgesetzten Preisen aufgekauft => in „fair-price“ shops zu niedrigen Preisen weitergegeben
- Bedarf an Krediten um die neue Anbautechnik zu finanzieren
> Felder durch Realteilung zu gering/klein für Maschineneinsatz
⇒ Kleinbauern: schlechte Ernte: Rückzahlungsschwierigkeiten (hohe Zinsen)
Ernte zu niedrigen Preisen an „money lender“, Landverkauf
anstatt Verkauf zur günstigen Jahreszeit → Zinsraten
zu b.: Anbau von cash crops (Zuckerrohr, Baumwolle, Gemüse => für Stadt, Industrie oder Export) → kein
Besitz von erforderl. Düngemitteln → geringer Ertrag
→ beim Verleiher als Arbeiter (unter Mindestlohn)
=> kaum Innovationsbereitschaft
Ruin
rapide Verarmung der ländl. Bev. / Massenarmut auf dem Land
Stadt-Land-Flucht (Slums in den Städten füllen sich)
⇒ Mittel- und Großbauern: begünstigt (Auch durch den Staat) → Geld für Mechanisierung aus Pachterhöhung bzw. Kündigung von Pachtverträgen zur Ausdehnung ihrer Nutzfläche
> Fläche: seit brit. Kolonialzeit kontrolliert eine kl. Gruppe von Landbe sitzern einen großen Teil der Nutzfläche
→ Kleinbauern: Landverlust → Kleinbauern immer ärmer, Großbauern immer reicher
Vergrößerung d. regional. und Einkommensungleichheiten
weitere Verschärfung der sozialen Unterschiede
- Arbeitsplatzverluste durch den Einsatz von Maschinen → (qualifizierte) Landarbeiter verlassen arme Gebiete und wandern in wohlhabende Regionen bzw. Stadt ab (höheres Lohnniveau)
- Saatgut der Hybridpfl. muß jedes Jahr neu gekauft werden, da nicht vermehrungsfähig
- fehlende Beratung und Ausbildung der Bauern:
- durch übermäßigen Einsatz von Düngemitteln (Düngemittel müssen genau abgestimmt sein):
- Unfruchtbarkeit des Bodens durch Bodennitrierung und unzureichende Fruchtfolgen
- durch übermäßigen Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln:
- Grundwasservergiftung (Anreicherung von Pestizidrückständen in der Nahrung → Zunahme von Krebserkrankungen und Erbgutschädigungen)
- schnelle Resistenz der Schädlinge → noch mehr Pestizide
- Pestizide vernichten auch nat. Feinde der Insekten → noch schnellere Vermehrung der Insekten (durch ganzjährige Bewässerung: auch Wegfall der Brutzyklusunterbrechungen der Insekten)
- durch intensive Bewässerung: → beträchtl. Ausweitung der bewässerten Flächen
- Senkung des Grundwasserspiegels
- Versalzung und Versumpfung des Bodens
> anderen: z.T: schlechte Böden => ferrallitische
- GR: nur in 1/3 aller Indischen Distrikte (114) erfüllbar = „Intensive Districts“
z.B.: Punjab, fruchtbare Deltagebiete, Monsungebiete <
Staat/ Reg. fördert nur bes. fortschrittliche/ gut bewässerte Gebiete und leistungsfähige Mittel- u. Großbetriebe (mit kostenlosem Saatgut, Beratung, günstige Kredite) => Terra 2 S. 122 oben
⇒ reiche Gebiete immer reicher, arme Gebiete (bleibt alles so wie es war) immer ärmer
- hauptsächl. Anbau von Weizen, Reis u. Mais (obwohl nur bei wenigen Früchten „revolutionäre“ Ertragssteigerung) → Produktion von Hirse und Grundnahrungsmitteln, wie Hülsenfrüchten stagniert oder ist rückläufig, da verdrängt => Diagramm „Vergleich Getreide/ Hülsenfrüchte“ > jedoch: besonders wichtig für Ernährung der überwiegend vegetarisch lebenden Hindus als Eiweiß- und Fettlieferant
grüne Revolution mehr Nach- als Vorteile → Ziele nicht in dem Umfang erreicht, in dem es wünschenswert gewesen wäre, aber Reserven in: Verbesserung der Anbautechnik, Verringerung der Nachernteverluste, umfassende Aufklärung und Beratung der Landwirte (intensive Kommunikation zw. Forschung u. Praxis, moderne Beratungssysteme u. ständige Weiterbildung), Verminderung des Düngemittel- und des Wasserbedarfs, Ausweitung der GR auf bisher vernachlässigte Kulturpfl. (Hülsenfrüchte, Gerste, Sorghum), Maßnahmen gegen die zunehmende Verarmung des Großteils der Bev. - die Landbev., z.B.: Kreditprogramme, Vermarktungseinrichtungen, landwirtsch. Preispolitik und Agrarverfassung bzw. Boden- und Sozialreform (Kastenwesen → nur best. Kasten dürfen Land besitzen und bestellen)
Quellen:
- Klett „Fundamente“ (1994)
- Westermann „Heimat und Welt“ (1997)
- Klett „Terra Geogr. 2“ (1991)
Häufig gestellte Fragen zur Grünen Revolution in Indien
Was waren die Ziele der indischen Regierung bezüglich der Grünen Revolution?
Die Ziele umfassten eine schnelle und nachhaltige Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion ohne wesentliche Änderungen der Agrarstruktur, die dauerhafte Überwindung von Armut und Hunger (betroffen war die Hälfte der ländlichen Bevölkerung Indiens), eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der armen Landbewohner und den Abbau der Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten (Selbstversorgung).
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen der Grünen Revolution ergriffen?
<Es wurden moderne Agrarwissenschaft und Agrartechnik eingeführt, einschließlich des Anbaus von schnellwachsenden Hochertragssorten (HYV), insbesondere von Weizen, Reis und Mais. Es erfolgte der Einsatz von Kunstdüngemitteln, der Aufbau von Bewässerungsanlagen, der verstärkte Einsatz von Pestiziden und die Mechanisierung der Landwirtschaft. Der Ausbau der Infrastruktur (Straßen- und Bewässerungsnetze) und die Verbesserung der Lagerungs- und Vermarktungsorganisation waren ebenfalls wichtige Maßnahmen.
Welche Erfolge wurden durch die Grüne Revolution erzielt?
Es gab eine erhebliche Steigerung der Getreideproduktion, wodurch sich die Ernährungssituation verbesserte. Die Hektarerträge stiegen beträchtlich, und es wurden neue Reissorten mit kürzeren Halmen und Reifezeiten eingeführt, die mehrere Ernten ermöglichten. Indien entwickelte sich vom Hungerland zum Weizenexporteur.
Welche Probleme und Nachteile brachte die Grüne Revolution mit sich?
Die Grüne Revolution führte zu einer hohen Abhängigkeit von Treibstoff, Düngemitteln und Unkrautvertilgern, wodurch Saatgutproduzenten und Chemieunternehmen profitierten. Es kam zu einem Verlust der Pflanzenvielfalt und einer genetischen Verarmung. Die steigenden Produktionskosten führten dazu, dass Reis für arme Bevölkerungsschichten unerschwinglich wurde. Kleinbauern hatten Schwierigkeiten, Kredite zur Finanzierung der neuen Anbautechnik zu erhalten, und waren oft gezwungen, Land zu verkaufen. Die Mechanisierung führte zu Arbeitsplatzverlusten und einer Vergrößerung der regionalen und Einkommensungleichheiten. Zudem trugen übermäßiger Düngemitteleinsatz zu Bodenunfruchtbarkeit und Grundwasservergiftung bei, und die intensive Bewässerung führte zu Versalzung und Versumpfung des Bodens.
Warum profitierten nicht alle indischen Regionen und Bauern gleichermaßen von der Grünen Revolution?
Die Grüne Revolution war hauptsächlich in gut bewässerten und fortschrittlichen Gebieten (wie Punjab und fruchtbare Deltagebiete) durchführbar. Der Staat förderte vor allem leistungsfähige Mittel- und Großbetriebe, wodurch sich die regionalen Ungleichheiten verstärkten. Kleine Bauern hatten oft nicht die finanziellen Mittel oder das Wissen, um von den neuen Technologien zu profitieren, was zu einer weiteren Verarmung führte.
Welche langfristigen Auswirkungen hatte der Einsatz von Pestiziden?
Der übermäßige Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln führte zu Grundwasservergiftung und einer Anreicherung von Pestizidrückständen in der Nahrung, was zu einer Zunahme von Krebserkrankungen und Erbgutschädigungen führte. Zudem entwickelten Schädlinge schnell Resistenzen, was den Einsatz noch größerer Mengen an Pestiziden erforderlich machte. Die Pestizide vernichteten auch natürliche Feinde der Insekten, was zu einer noch schnelleren Vermehrung der Insekten führte.
Welche alternativen Lösungsansätze werden vorgeschlagen, um die negativen Auswirkungen der Grünen Revolution zu mildern?
Vorgeschlagen werden u.a. die Verbesserung der Anbautechnik, Verringerung der Nachernteverluste, umfassende Aufklärung und Beratung der Landwirte, Verminderung des Düngemittel- und Wasserbedarfs, Ausweitung der GR auf bisher vernachlässigte Kulturpflanzen (Hülsenfrüchte, Gerste, Sorghum) sowie Maßnahmen gegen die zunehmende Verarmung des Großteils der Landbevölkerung, wie z.B. Kreditprogramme, Vermarktungseinrichtungen, landwirtschaftliche Preispolitik und Agrarverfassung bzw. Boden- und Sozialreform.
- Quote paper
- Maria Friebel (Author), 2000, Grüne Revolution in Indien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97840