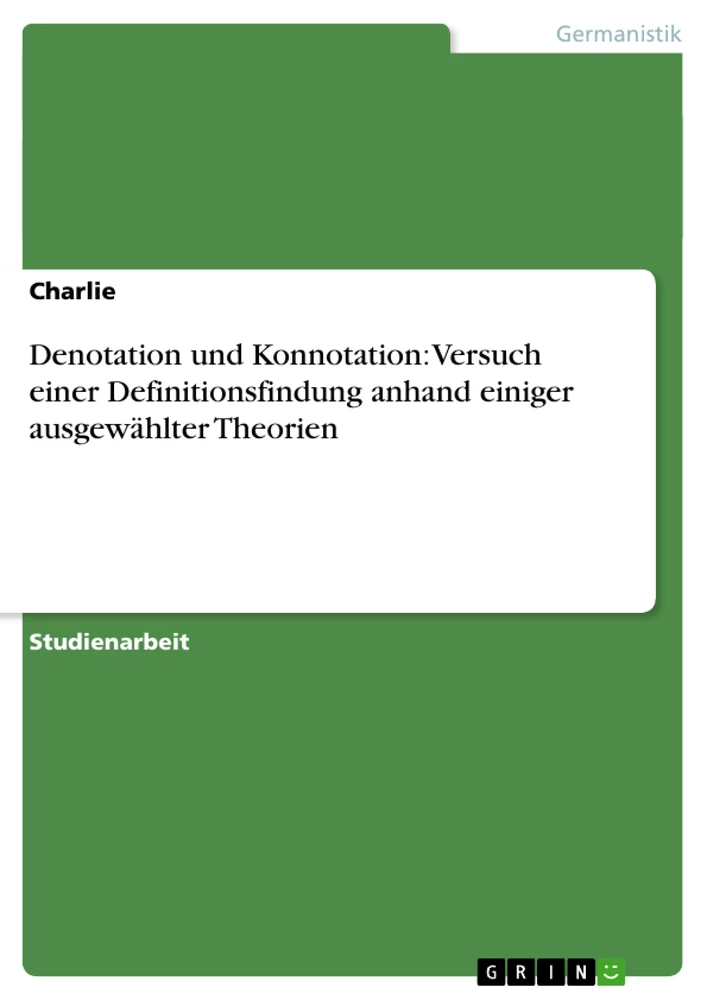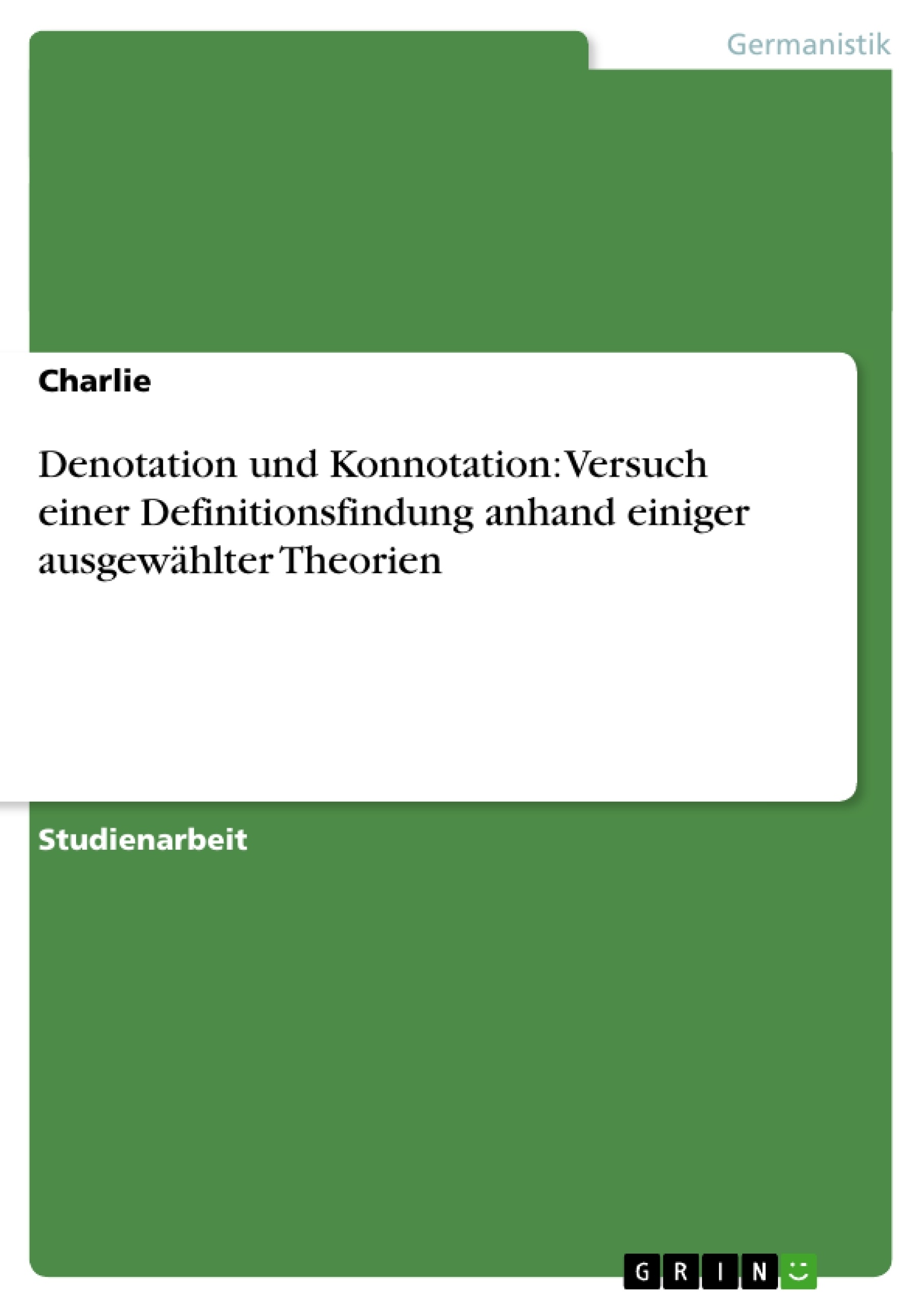Sprache ist mehr als nur die Summe ihrer Worte – sie ist ein komplexes Geflecht aus Bedeutungsebenen, das unsere Kommunikation prägt. Doch was genau verbirgt sich hinter den Begriffen Denotation und Konnotation, die in der Linguistik immer wieder für Diskussionen sorgen? Diese Arbeit nimmt Sie mit auf eine spannende Reise in die Welt der Semantik, um das oft missverstandene Verhältnis zwischen wörtlicher Bedeutung und subjektiver Assoziation zu ergründen. Ausgehend von grundlegenden Definitionen und der Vorstellung verschiedener theoretischer Ansätze, wie jene von John Lyons, Albert Newen und Gerda Rössler, wird die Frage aufgeworfen, ob eine einheitliche Bestimmung dieser zentralen Begriffe überhaupt möglich ist. Entdecken Sie, wie Denotation und Konnotation unsere Wahrnehmung von Sprache beeinflussen und wie sie in der alltäglichen Kommunikation subtile Botschaften vermitteln. Die Analyse zeigt, dass Denotation als Kernbedeutung eines Wortes fungiert, während Konnotation emotionale, kulturelle und persönliche Assoziationen hervorruft. Die Untersuchung verschiedener Theorien offenbart jedoch auch die Schwierigkeit, eine klare Trennlinie zwischen beiden Konzepten zu ziehen, da sie oft eng miteinander verwoben sind. Lassen Sie sich von einer kritischen Auseinandersetzung mit etablierten linguistischen Modellen inspirieren und gewinnen Sie neue Einblicke in die vielschichtige Natur der sprachlichen Bedeutung. Diese Arbeit plädiert für eine differenzierte Betrachtung der Denotation und Konnotation, die sowohl die individuellen Interpretationen als auch den kulturellen Kontext berücksichtigt, und regt dazu an, die bestehenden Definitionen zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, um ein tieferes Verständnis für die Macht der Sprache zu entwickeln. Ein Muss für alle, die sich für Linguistik, Semantik und die subtilen Nuancen der Kommunikation interessieren, bietet diese Arbeit eine fundierte und zugleich anregende Einführung in ein faszinierendes Forschungsfeld. Tauchen Sie ein in die Welt der Sprachwissenschaft und entdecken Sie die verborgenen Dimensionen der Bedeutung! Diese aufschlussreiche Analyse ist ein wertvoller Beitrag zur Bedeutungstheorie und bietet neue Perspektiven für Linguisten, Sprachwissenschaftler und alle, die sich mit der Semantik von Sprache auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Zum Gegenstand der Arbeit
1.1. Definition: Was ist Denotation?
1.2. Definition: Was ist Konnotation ?
2. Theoretische Ansätze zu Denotation und Konnotation
2.1 Der Denotationsbegriff nach John Lyons und Albert Newen
2.2 Rösslers Konnotationstheorie
3. Abschlussbemerkung
4. Bibliographischer Anhang
1. Einleitung: Zum Gegenstand der Arbeit
Innerhalb der Linguistik, und insbesondere im Bereich der Semantik, findet man zahlreiche Fachtermini, die zwar oft das Gleiche bezeichnen, aber von verschiedenen Wissenschaftlern im Laufe des letzten Jahrhunderts unterschiedlich aufgefasst und beschrieben worden sind. Zu diesen Begriffen gehören unter anderem auch die Denotation und die Konnotation. Diese sind mehrfach zum Gegenstand linguistischer Theorien mit unterschiedlichen Ansätzen geworden. Ziel dieser Arbeit soll es deshalb sein, nach einer Erläuterung der jeweiligen Einzelbegriffe festzustellen, ob diese wirklich eine so zentrale Rolle in der Semantik spielen, dass sie solch einer Vielzahl an Theorien und wissenschaftlicher Arbeiten bedürfen.
1.1. Was ist Denotation?
Unter Denotation versteht man im allgemeinen Sinne die Lexikondefinition eines Wortes. Der Begriff leitet sich ursprünglich von lat. denotatio ab, was soviel wie Bezeichnung bedeutet. Im engen Zusammenhang mit dieser Definition steht der Terminus der denotiven Bedeutung. Unter dieser werden hierbei ,,die begrifflichen Kernbedeutung(en) eines Lexems, die Gesamtheit der [...] semantischen Merkmale"(Glück 2000:142) verstanden. Im Gegensatz zu dieser abstrakten Lexikondefinition gelten Denotationen allgemeinsprachlich als ein Bestandteil von Kommunikation. Sie entstehen ,,aus dem Kontext der Rede [...] und [nehmen Bezug] auf ein Stück der wirklichen oder erdachten Welt" (Blanke 1973:18). Aufgrund dieser Bezugnahme, dem sogenannten Referieren, auf Dinge oder Geschehnisse in der unmittelbaren Umwelt, sehen sich Linguisten, und insbesondere John Lyons, auf dessen Denotationsbegriff in einem späteren Kapitel dieser Arbeit noch eingegangen werden wird, veranlasst, die Denotation auch als referenzielle Bedeutung zu bezeichnen (vergl. Blanke 1973:18).
1.2. Definition: Was ist Konnotation ?
Nicht der referenziellen, sondern der affektiven oder emotiven Bedeutung ist die Konnotation zuzuordnen, die allgemein als Gegenbegriff zur Denotation verstanden wird (Blanke 1973:19). Ihr Name leitet sich ab von lat. connotatio, was soviel wie Mitbezeichnung bedeutet. Dies ist der Teil des Lexems, der ein bestimmtes Bild oder einen Emotion beim Hörer auslöst. Diese Assoziationen können sowohl positiver als auch negativer Art sein. Der Begriff entstammt ursprünglich der philosophischen Schule der Scholastiker und wird erstmals 1843 von John Stuart Mill in der Linguistik verwendet, in seiner Arbeit Systems of Logic (Garza-Cuaron 1978:61) ; sowie Glück 2000:367). Dieser setzt Konnotation gleich mit dem Begriff der Bedeutung,,understood as the characteristic, the group of characteristics or notation that define a term" (Garza-Cuaron 1978:62). Im Gegensatz zu Mill unterscheidet die neuere Linguistik innerhalb des Konnotationsbegriffs zudem noch die Unterklassen ,,Nebensinn", d.h. alle nicht definierten, gegenstandsbezogenen Merkmale", ,,evaluative, emotive, appellative Werte des Begriffs", ,,sprachsystematische Assoziationen", sowie den Sprachstil in Abhängigkeit von Kontext und Situation (vergl. Glück:367). Konnotationen entstehen demnach aus ,,der Intention des Sprechers [...], [die] eine wertende und emotionale Einstellung beinhaltet" (Blanke 1973:19). Diese vom Sprecher mehr oder weniger (un)bewusste Übermittlung seiner Einstellung zu Kommunikationsinhalten und die damit verbundene Gesprächslenkung wird unter anderem von Gerda Rössler in der von ihr selbst aufgestellten Konnotationstheorie thematisiert, die ebenfalls in dem sich anschließenden zweiten Teil meiner Ausführungen besprochen werden wird.
2. Theoretische Ansätze zu Denotation und Konnotation
Nachdem ich im ersten Teil meiner Arbeit eine einführende und eher allgemeingehaltene Definition der Begriffe Denotation und Konnotation gegeben habe, möchte ich nun anhand zweier ausgewählter Beispiele eine nähere Eingrenzung des Gegenstandes vornehmen. Es handelt sich hierbei um den Denotationsbegriff, wie er von dem englischen Linguisten John Lyons sowie dem deutschen Sprachforscher Albert Newen, welcher sich an Lyons anlehnt, verstanden wird und die von Gerda Rössler 1979 aufgestellten Konnotationstheorie. Ich werde diese in den folgenden Abschnitten meiner Arbeit nun kurz darstellen und dabei einige Kritikpunkte hervorheben. Den Abschluss meiner Ausführungen soll dann die Antwort auf die Frage bilden, ob man eine einheitliche Definition der Begriffe Denotation und Konnotation innerhalb der modernen Linguistik finden kann.
2.1. Der Denotationsbegriff nach John Lyons und Albert Newen
Der englische Linguist John Lyons fasst, verglichen mit dem oben zitierten John Stuart Mill, den Begriff der Denotation enger und bezieht diesen auf zwei andere Kernbegriffe der Semantik, die Referenz und den Sinn,,it is clear that sense and denotation are interdependent" (Lyons 1981:152). Es besteht also eine wechselseitige Beziehung zwischen beiden Termini, d.h. Lyons geht nicht von Denotation als neutrale Bezeichnung für eine Menge an Lexemen aus, sondern das Lexem muss immer einen Sinnhintergrund und somit eine Referenz aufweisen. Grundlage dieser These ist das von Lyons selbst 1977 entwickelte Modell zur Bedeutung (Lyons 1977:50), in welchem er sowohl die Denotation als auch die Referenz der deskriptiven Bedeutung unterordnet. Unter deskriptiver Bedeutung versteht man Aussagen, die ,,explizit bejaht oder verneint werden können" (Vater 1997:170). Die Referenz ist hingegen situationsbezogen, dass heißt sie bezieht sich nach Lyons ,,auf das Verhältnis von sprachlichem Ausdruck und dem, wofür [...] dieser in einer bestimmten Äußerungssituation steht" (Vater 1997:171). Im Gegensatz zu der kontextabhängigen Referenz ist die Denotation allgemeiner zu verstehen, auch wenn sie, wie bereits erwähnt, ebenfalls an einen Sinn gebunden ist. Für Lyons bedeutet Denotation eine Möglichkeit an Referenzen, ein sogenanntes Referenzpotenzial (Vater 197:172), ,,das wie der Sinn an ein Lexem gebunden ist und all das bezeichnet, worauf ein Lexem referieren kann" (Vater 197:172). Als Beispiel nennt er das Lexem Kuh, welches, bezogen auf Lexeme wie Bulle oder Kalb, mit diesen eine Sinneinheit bildet. Geht man hingegen bei Kuh als Teil einer Gruppe Tier aus, so ist Kuh eine Denotation, ,,cow denotes a class of entities which is a proper subclass of a class of entities denoted by animal; which differ fron the class of entities denoted by bull" (Lyons 1981:152).
An dieser Stelle möchte ich jedoch einen Einwand vorbringen: auch wenn ich Lyons Ansatz, dass Denotationen immer, ähnlich wie Referenzen, einen Sinngehalt haben, nachvollziehen und mich diesem durchaus anschließen kann, ist es dennoch für mich anhand seiner Argumentation nicht einleuchtend, wo genau er die Unterscheidung zwischen beiden Termini, dem der Referenz und dem der Denotation, eigentlich macht. Mir erscheint es eher so, als ob er beide im Grunde genommen als völlig identisch ansieht. Daher bevorzuge ich die Überlegungen von Albert Newen in der von ihm 1996 veröffentlichten Monographie Kontext, Referenz und Bedeutung, in welcher dieser sich ebenfalls unter anderem mit dem Denotationsbegriff auseinandersetzt. Allerdings ersetzt er diesen innerhalb seiner Argumentation durch den Terminus der attributiven Kennzeichnung und erläutert diese folgendermaßen:
Eine Kennzeichnung wird in einer Äußerung attributiv verwendet, wenn der Sprecher sie benutzt, um eine Aussage über ein Objekt zu machen, dem die mit der Kennzeichnung ausgedrückte Eigenschaft zukommt. Im Falle einer attributiven Verwendung legt alleine das Referenzobjekt fest, d.h. das mit der Kennzeichnung bezeichnete Objekt ist genau das Objekt, welches als einziges die Kennzeichnung erfüllt (Newen 1997:29).
Denotation ist demnach etwas Eindeutiges. Sie bezieht sich auf das, was sie bezeichnet. Wichtig in diesem Zusammenhang ist für Newens Ansatz, der sich im wesentlichen auch auf den Kripkes bezieht, ,,dass es zur Sprachkompetenz gehört, dass eine [Denotation] in dieser Verwendung genau ein Objekt bezeichnet, und zwar das, auf das die [Denotation] zutrifft" (Newen 1997:30). Als Beispiel nennt Newen folgendes Situation: im Laufe der Ermittlung an einem Mordfall, äußert ein Sprecher den Satz:
(1) ,,Der Mörder von Schmidt [Schmidt ist hier Synonym für irgendeinen Toten] ist verrückt" (Newen 1997:29)
Newens Erläuterung zu dieser Aussage ist, dass ,,die Kennzeichnung ,der Mörder von Schmidt' attributiv verwendet [wird]" (Newen 1997:29). Der Teilsatz ,,der Mörder von Schmidt" ist also eine Denotation, weil, so Newen weiter, ,,die Kennzeichnung die Person [bezeichnet], die den [...] Mord begangen hat" (Newen 1997:29), aber sie bezieht sich nicht auf eine bestimmte Person, sondern auf ,, wer immer es auch war" (Newen 1997:29). Newen geht also, im Gegensatz zu Lyons, von einer neutralen Bedeutung der Denotation aus, da diese auf alles referiert, was mit einer Situation oder einem Objekt zu tun hat; sie ist aber nicht ausschließlich an dieses gebunden, sodass kein direkter Referenzbezug entseht.
Dieser von Albert Newen entwickelte Ansatz nähert sich demzufolge wieder der ursprünglichen Definition von Denotation an, der reinen Bezeichnung eines Lexems (vergleiche Kapitel 1.1. dieser Arbeit), weshalb ich diesen Ansatz letztendlich bevorzugen würde, da er eine allgemeingültige Definition des Begriffes erleichtert, während Lyons Theorie, basierend auf einem gleitenden Übergang zwischen Referenz und Denotation, eine solche eher erschwert.
2.2. Rösslers Konnotationstheorie
Gerda Rössler geht bei ihrer Theorie zunächst von der Grundthese aus, das die Konnotation bislang zu Unrecht bloß als reine Mit- und Nebenbedeutung, als Gegenpol zur Denotation, von der Linguistik aufgefasst worden ist (s. Braselmann (1981:95). Hauptanliegen ihrer Arbeit ist es daher, ,,die Rolle der Konnotation [...] für das Gelingen oder für den Misserfolg sprachlicher Äußerungen" (Rössler in: Braselmann 1981:95) darzustellen. Ansatz ihrer Theorie sind dabei drei, sich auf das von Ferdinand de Saussure entwickelten semiotischen Zeichenmodell beziehende Grundaspekte.
Rösslers Theorie liegt die Annahme zugrunde, dass sich Konnotationen aus einem pragmatischen, einem kommunikationstheoretischen und einem semantischen Teilbereich zusammensetzen (vergl. Braselmann 1981:96f). Bezogen auf de Saussure heißt das, dass Konnotationen im semiotischen Sinne Teilaspekte der pragmatischen Dimension des sprachlichen Zeichens sind. Rössler erklärt dies damit, dass ,,das sprachliche Zeichen semiotisch [als] ein gegebenes Etwas [gesehen wird], das für Etwas anderes steht [...] und von jemanden verstanden wird" (Rössler in: Braselmann 1981:96).
Allgemeinsprachlich heißt dies, dass bei der Konnotation bewusst ein bestimmtes Lexem verwendet wird, um etwas Anderes auszusagen. Der Hörer wird somit durch die Wortwahl des jeweiligen Sprechers manipuliert. Diese These findet sich auch in Rösslers zweitem, dem sogenannten kommunikationstheoretischen Ansatz, wieder, in welchem Rössler feststellt, dass ,,das sprachliche Zeichen kommunikationstheoretisch als Etwas Prozessuales [betrachtet wird], das im Zusammenhang mit bestimmten Kommunikationsphasen, sogenannten Transformationen [...] erst zum Zeichen wird (Rössler in: Braselmann 1981:96). Demnach hängen Konnotationen stark vom jeweiligen Kommunikationspartner ab und gewinnen erst während eines Gespräches an Bedeutung und somit an Inhalt. Es stellt sich allerdings bereits hier die Frage, worin genau der Unterschied zwischen dem pragmatischen und dem kommunikationstheoretischen Ansatz nach Rössler besteht. Geht sich nicht jedes Mal davon aus, dass Konnotationen bewusst vom Sprecher gewählt werden, um sein Gegenüber zu beeinflussen? In beiden Fällen wird durch das sprachliche Zeichen etwas Anderes ausgesagt als es auf den ersten Blick scheint. Der einzige Unterschied zwischen Ansatz I. und II. scheint mir zu sein, dass sie aus pragmatischer Sicht die Konnotation allgemein als ein doppeldeutiges Zeichen voraussetzt, während sie aus kommunikationstheoretischer Sicht davon ausgeht, dass sich erst im Laufe einer Kommunikation, genauer im Laufe einer ,,verbalen Kommunikation" (Braselmann 1981:96), das jeweilige Konnotationsverständnis entwickelt. Stellt sich dann wiederum die Frage, wo dann der Unterschied zum dritten und letzten Aspekt des von Rössler entwickelten Konnotationsmodells, dem semantischen Ansatz, besteht, denn dort heißt es, dass ,,vom semantischen Standpunkt das sprachliche Zeichen als Komplex von kleineren Bedeutungselementen aufgefasst wird, von denen in der verbalen Kommunikation jeweils eine bestimmte Menge aktualisiert wird" (Rössler in: Braselmann 1981:96). Aus semantischer Sicht sind demnach Konnotationen die von vielen Kommunikationsfaktoren abhängigen Aktivierungen eines oder mehrerer Bedeutungselemente von sprachlichen Zeichen. Aber ist das nicht wieder die gleiche, bereits zuvor in These I und auch II. gemachte Feststellung, nämlich dass Konnotationen, je nach Kommunikationssituation- und Partner unterschiedlich wirken und verstanden werden? Auch die hier schon mehrfach zitierte Petra Braselmann, die sich vorwiegend mit Konnotationen aus Sicht der Kommunikationsforschung beschäftigt, kommt in ihrer Analyse des Rösslerischen Modells zu diesem Schluss, indem sie bemerkt, dass wenn [ein] Zeichen semiotisch gesehen von jemanden verstanden wird und Konnotation im semiotischen Sinne eine pragmatische Dimension zuerkannt wird, so [...][besteht] kaum ein Unterschied zum Prozessualen des kommunikationstheoretischen Aspektes, da Verstehen ein Prozess ist, der mittels Situation, Kontext und Gesprächpartner einem gegebenen Zeichen aktuelle Bedeutung verleiht (Braselmann 1981:98).
Ich kann mich dieser Aussage nur anschließen. Meiner Meinung ist es sowohl unnötig, wenn nicht sogar falsch, Konnotationen in drei unterschiedliche Bereiche, Pragmatik, Kommunikationstheorie und Semantik, zu unterteilen, da alle drei Bereiche mehr oder weniger eng miteinander verknüpft sind und eine erfolgreich durchgeführte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartnern nur stattfinden kann, wenn alle drei Bereiche gleichermaßen aktiviert sind und eine stabile Einheit bilden. Ich würde deshalb eher davon abraten, das hier vorgestellte Modell als Grundlage für eine allgemeingültige Definition der Konnotation heranzuziehen; dennoch halte ich es für angebracht, Rösslers Thesen sozusagen als ein Gegenbeispiel oder eine falschverstandene Auffassung von Fachtermini an dieser Stelle einmal vorzustellen und zur Diskussion zu stellen.
3. Abschlussbemerkung
Bereits dieser von mir in meiner Arbeit vorgenommene kurze und noch recht allgemein gehaltene Einstieg in das ,,weite Feld" der Semantik (vergl. Bünting 1971:160) hat wohl gezeigt, wie vielfältig und unterschiedlich allein das Begriffspaar Denotation und Konnotation vorwiegend in der modernen Linguistik aufgefasst worden ist. Es lässt sich wohl keine allgemein gültige Definition aufstellen, da, wie weiter oben in Bezug auf Lyons festgestellt worden ist, diese Begriffe immer mit anderen Termini in einer wechselseitige Beziehung gesehen werden müssen. Dennoch sollte es Aufgabe der Sprachforschung bleiben, sich mit diesem Begriffspaar zu beschäftigen, allerdings, eher in der Weise, die vorhandenen Termini und Theorien zu diesem Gebiet einander anzugleichen und Doppelverwendungen von Begriffen wie Referenz und Denotation auszuräumen, um so dem Interessierten einen leichteren Einstieg in die Materie zu erleichtern und um vielleicht auf diese Weise eine wenigstens einigermaßen gültige Definition für Denotation und Konnotation zu finden.
4. Bibliographischer Anhang
Blanke, Gustav H. (1973). Einführung in die semantische Analyse. München: Max Hueber.
Braselmann, Petra M.E. (1981). Konnotation - Verstehen - Stil. Operationalisierung sprachl. Wirkungsmechanismen dargest. an Lehn=elementen im Werke Maurice Dekobras. Frankfurt am Main etc: Peter Lang GmbH.
Garza-Cuaron, Beatriz (1991): Connotation and meaning. Approaches to semiotics. Berlin/New York: Mouton de Cruyter.
Glück, Helmut (Hg) (2000). Metzler Lexikon Sprache. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler.
Kripke, S.A.. Sprecherreferenz und semantische Referenz. In : Wolf, Ulrike (Hg.) (1985). Eigennamen. Dokumentation einer Kontroverse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.208-258
Lyons, John (1977). Semantics. 2 Bände. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyons, John (1997). Language and Lnguistics. Cambridge: Cambridge University Press [1. Auflage 1981].
Newen, Albert (1996). Kontext, Referenz und Bedeutung: eine Bedeutungstheorie singulärer Therme. Paderborn etc: Schöningh.
Rössler, Gerda (1979). Konnotationen. Untersuchungen zum Problem der Mit- und Nebenbedeutungen. Wiesbaden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit über Denotation und Konnotation?
Die Arbeit untersucht die Begriffe Denotation und Konnotation innerhalb der Linguistik, insbesondere der Semantik. Ziel ist es, nach einer Erläuterung der Einzelbegriffe festzustellen, ob diese eine zentrale Rolle in der Semantik spielen und die Vielzahl an Theorien rechtfertigen.
Wie wird Denotation definiert?
Allgemein wird Denotation als die Lexikondefinition eines Wortes verstanden. Sie leitet sich von lat. denotatio (Bezeichnung) ab und steht im Zusammenhang mit der denotiven Bedeutung, den begrifflichen Kernbedeutungen eines Lexems.
Wie unterscheidet sich die allgemeinsprachliche Verwendung von Denotation von der Lexikondefinition?
Allgemeinsprachlich entstehen Denotationen aus dem Kontext der Rede und beziehen sich auf die wirkliche oder erdachte Welt (Blanke). Linguisten wie John Lyons bezeichnen die Denotation auch als referenzielle Bedeutung aufgrund dieser Bezugnahme auf Dinge oder Geschehnisse.
Was ist Konnotation?
Konnotation wird allgemein als Gegenbegriff zur Denotation verstanden und der affektiven oder emotiven Bedeutung zugeordnet. Sie leitet sich ab von lat. connotatio (Mitbezeichnung) und löst beim Hörer bestimmte Bilder oder Emotionen aus.
Welche Unterklassen werden innerhalb des Konnotationsbegriffs unterschieden?
Die neuere Linguistik unterscheidet innerhalb des Konnotationsbegriffs die Unterklassen "Nebensinn", "evaluative, emotive, appellative Werte des Begriffs", "sprachsystematische Assoziationen" sowie den Sprachstil in Abhängigkeit von Kontext und Situation (Glück).
Was ist der Denotationsbegriff nach John Lyons?
John Lyons fasst Denotation enger und bezieht diesen auf Referenz und Sinn. Er sieht eine wechselseitige Beziehung zwischen diesen Termini und ordnet sowohl Denotation als auch Referenz der deskriptiven Bedeutung unter.
Was versteht Albert Newen unter dem Begriff Denotation?
Albert Newen ersetzt den Begriff Denotation durch den Terminus der attributiven Kennzeichnung. Eine Kennzeichnung wird attributiv verwendet, wenn der Sprecher sie benutzt, um eine Aussage über ein Objekt zu machen, dem die mit der Kennzeichnung ausgedrückte Eigenschaft zukommt. Denotation ist demnach etwas Eindeutiges. Sie bezieht sich auf das, was sie bezeichnet.
Was ist Rösslers Konnotationstheorie?
Gerda Rössler geht davon aus, dass Konnotation bisher zu Unrecht bloß als reine Mit- und Nebenbedeutung aufgefasst worden ist. Sie versucht, die Rolle der Konnotation für das Gelingen oder für den Misserfolg sprachlicher Äußerungen darzustellen. Ihre Theorie basiert auf drei Grundaspekten: Pragmatik, Kommunikationstheorie und Semantik.
Welche Kritik wird an Rösslers Konnotationstheorie geäußert?
Kritiker bemängeln, dass die Unterteilung der Konnotation in Pragmatik, Kommunikationstheorie und Semantik unnötig ist, da diese Bereiche eng miteinander verknüpft sind und eine erfolgreiche Kommunikation nur stattfinden kann, wenn alle Bereiche gleichermaßen aktiviert sind.
Zu welchem Schluss kommt die Arbeit bezüglich einer allgemeingültigen Definition von Denotation und Konnotation?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sich keine allgemein gültige Definition aufstellen lässt, da diese Begriffe immer in einer wechselseitigen Beziehung mit anderen Termini gesehen werden müssen. Es sollte aber Aufgabe der Sprachforschung bleiben, die vorhandenen Termini und Theorien anzugleichen, um Doppelverwendungen von Begriffen wie Referenz und Denotation auszuräumen.
- Arbeit zitieren
- Charlie (Autor:in), 2000, Denotation und Konnotation: Versuch einer Definitionsfindung anhand einiger ausgewählter Theorien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97834