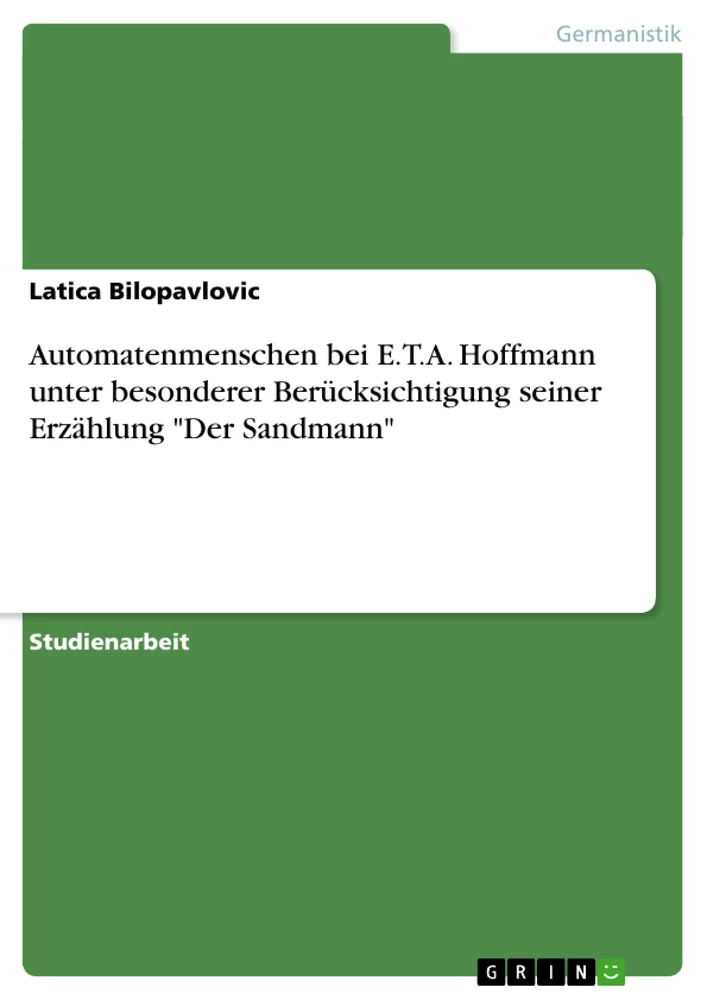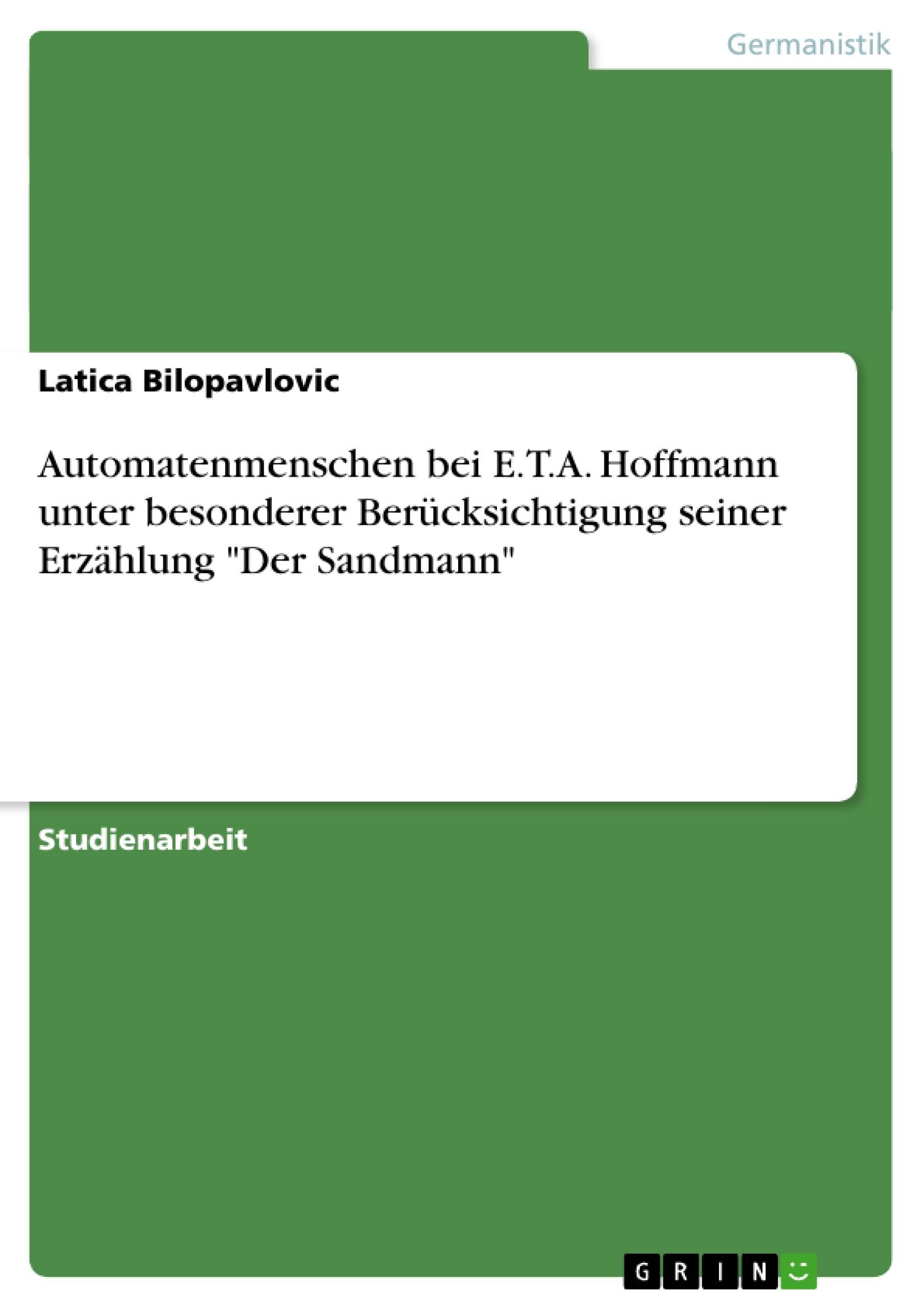Die Erzählung Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann erschien 1816 im ersten Teil des Erzählzyklus Nachtstücke. Im ganzen Zyklus herrscht das typisch romantische Interesse für die "Nachtseiten der Natur", für das Unheimliche, Krankhafte und Verbrecherische vor. Der Sandmann ist die bekannteste Erzählung der Sammlung. Sie handelt über den Physikstudenten Nathanael, der bereits mit einem Bürgermädchen, Clara, verlobt, sich am Studienort in die Tochter eines Professors, die schöne Olympia, verliebt, bis sich herausstellt, dass Olympia kein Mensch, sondern ein Automat ist, eine "leblose Puppe". Diese Täuschung erlebt Nathanael als eine Bedrohung seiner Identität schließlich so stark, dass sie ihn in den Wahnsinn und Tod treibt.
Die frühe Rezeption des Sandmann war weitgehend durch das abwertende Urteil des Aufklärers Walter Scott geprägt und bis tief ins 20. Jahrhundert kaum beachtet. Der Erzählung wurde auch Uneinheitlichkeit vorgeworfen, während heute hingegen die Multiperspektivität der Darstellung im positiven Sinne als ein konstitutives Merkmal des Textes angesehen wird. Sigmund Freud analysiert den Sandmann in seiner Studie über das Unheimliche und bringt die Angst vor dem Augenraub mit der Kastrationsangst in Verbindung. Die Diskussion, die daraus erwachsen ist, macht Hoffmanns erstes Nachtstück zu einer seiner meist besprochenen Erzählungen, beliebt bei den Interpreten verschiedenster wissenschaftstheoretischer Ausrichtung. Ich werde mich in dieser Hausarbeit größtenteils im weiteren Sinne dem Problem des Automatenmenschen, das mir heutzutage sehr aktuell scheint, widmen, und zu erörtern versuchen, was eigentlich so unheimlich und grauenvoll an Automaten ist.
INHALT
- DER SANDMANN, SEINE REZEPTION UND INTERPRETATIONSMÖGLICHKEITEN
- FASZINATION VON AUTOMATEN IN WIRKLICHKEIT UND LITERATUR
- DER AUTOMAT IM ZEITALTER DER ROMANTIK UND HOFFMANNS EINSTELLUNG ZU AUTOMATEN
- AUTOMATENMENSCH IM SANDMANN
_ VERSCHWOMMENE GRENZE ZWISCHEN AUTOMATEN UND MENSCHEN
_ GESELLSCHAFTKRITIK IM SANDMANN
_ DER WEG VON CLARA ZU OLIMPIA
~ Die Grenze zwischen Einbildungskraft und Realität. Nathanael und Clara
~ Nathanael und Olimpia. Liebe zum Automaten
- SCHLUSSWORT
- LITERATURVERZEICHNIS
DER SANDMANN, SEINE REZEPTION UND INTERPRETATIONSMÖGLICHKEITEN
Die Erzählung Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann erschien 1816 im ersten Teil des Erzählzyklus Nachtstücke. Im ganzen Zyklus herrscht das typisch romantische Interesse für die "Nachtseiten der Natur", für das Unheimliche, Krankhafte und Verbrecherische vor. Der Sandmann ist die bekannteste Erzählung der Sammlung. Sie handelt über den Physikstudenten Nathanael, der bereits mit einem Bürgermädchen, Clara, verlobt, sich am Studienort in die Tochter eines Professors, die schöne Olympia, verliebt, bis sich herausstellt, dass Olympia kein Mensch, sondern ein Automat ist, eine "leblose Puppe". Diese Täuschung erlebt Nathanael als eine Bedrohung seiner Identität schließlich so stark, dass sie ihn in den Wahnsinn und Tod treibt.
Die frühe Rezeption des Sandmann war weitgehend durch das abwertende Urteil des Aufklärers Walter Scott geprägt und bis tief ins 20. Jahrhundert kaum beachtet. Der Erzählung wurde auch Uneinheitlichkeit vorgeworfen, während heute hingegen die Multiperspektivität der Darstellung im positiven Sinne als ein konstitutives Merkmal des Textes angesehen wird. Sigmund Freud analysiert den Sandmann in seiner Studie über das Unheimliche und bringt die Angst vor dem Augenraub mit der Kastrationsangst in Verbindung. Die Diskussion, die daraus erwachsen ist, macht Hoffmanns erstes Nachtstück zu einer seiner meist besprochenen Erzählungen, beliebt bei den Interpreten verschiedenster wissenschaftstheoretischer Ausrichtung. Ich werde mich in dieser Hausarbeit größtenteils im weiteren Sinne dem Problem des Automatenmenschen, das mir heutzutage sehr aktuell scheint, widmen, und zu erörtern versuchen, was eigentlich so unheimlich und grauenvoll an Automaten ist.
FASZINATION VON AUTOMATEN IN WIRKLICHKEIT UND LITERATUR
Das Begehren nach der Belebung des Unbelebten ist uralt. Automaten1 wurden schon im Altertum als Mechanismen gebaut, die Bewegungen und Verrichtungen lebender Wesen nachahmten (künstliche Menschen). Später entstanden automatische Uhren mit Figurenwerk, z.B am Straßburger Münster 1352 und an der Frauenkirche in Nürnberg ("Männleinlaufen"). Spätestens im 16. Jahrhundert tauchten die ersten Musikautomaten auf. Besonders die Renaissance- und Barockzeit hatten eine Vorliebe für Automaten. Im 18. Jahrhundert wurden die Automaten von J. de Vaucanson, der neben einem mechanischen Flötenspieler (1738) eine gehende, fressende und verdauende Ente schuf, und der Schreiber-Automat (1760) von P.
Jaquet-Droz bekannt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts verlosch das Interesse an solchen mechanischen Automaten; sie blieben allerdings für die Literatur ein faszinierendes Thema. In der Literatur spiegelt sich diese Fazination der Menschen durch künstliche Figuren und ihr Wunsch, unbelebte Gegenstände zum Leben zu erwecken, im großen Maße wider, was auch die umfangreiche Bibliographie unter dem Namen MaschinenMenschen 2 zeigt, wo die zahlreichen Werke, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, aufgezeichnet sind. Bereits in der Antike, in Homers Ilias, ist die Rede von Hephaistos, der zur Verstärkung der kretaischen Kampfkraft einen Erzriesen erschaffen habe. Es sind Mythen überliefert von mechanisch singenden Vögeln, selbstbewegten Wächtern und weissagenden Götterstatuen. Der Universalgelehrte Albertus Magnus soll sich einen Diener aus Messing, Holz und Leder konstruiert haben. Diesen hat allerdings der Legende nach Thomas von Aquin zerstört in der Überzeugung, der mechanische Mensch könne nur ein Werk des Teufels sein. Es folgen literarische Fantasien um Homunculi und Golems, von Goethes Homunculus und Marry Shelleys bekanntem Monster namens Frankenstein bis zu Schreckvisionen der neueren Literatur wie Orwells 1984, wo geisterhafte Televisoren allgegenwärtig und allwissend sind, und dem weniger bekannten Werk RUR des tschechischen Autors Karel apek, wo Roboter erfolgreich den Aufstand gegen ihre Ausbeuter proben, das Werk, in dem das Wort "Roboter"3 zum ersten Mal erscheint und in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeht.
DER AUTOMAT IM ZEITALTER DER ROMANTIK UND HOFFMANNS EINSTELLUNG ZU AUTOMATEN
Im 17. und 18. Jahrhundert kam es zur schnellen Entwicklung der Naturwissenschaften und Technik, was mit der Idee der Beherrschung der Natur eng verbunden ist. Im Rationalismus und in der Aufklärung kommt das grenzenlose Vertrauen in die Fähigkeit des menschlichen Verstandes zum Ausdruck, die Wahrheit zu erkennen. Die bürgerlichen Denker streben danach, "in den gesellschaftlichen Verhältnissen eine natürliche Ordnung und sogar eine wissenschaftlich definierbare Gesetzmäßigkeit des Geschehens zu erkennen"4. Die Welt wurde mit einer pünktlichen Uhr verglichen (Brockes) und der französische Arzt Joulien Offray de La Mettrie geht in seiner Abhandlung L'homme machine aus dem Jahre 1748 so weit, dass er den Menschen mit der Maschine gleichstellt. Die Generation der Romantiker teilt nicht mehr diese Begeisterung und diesen Fortschrittsglauben. Schon Rousseau, ihr großer Vorbild, rief "Zurück zur Natur!" aus, und zog den "Naturmenschen" dem durch Konventionen der Gesellschaft gebundenen "Zivilisationsmenschen" vor. Anfangs des 19. Jahrhunderts, mit der Erfindung der Dampfmaschine, begann die erste industrielle Revolution mit der durch sie verursachten zunehmenden Enthumanisierung. Nun begannen die Menschen, den Maschinen immer mehr zu ähneln. Mit der Ausweitung der Mechanisierung mußten sie sich immer mehr dem von der Technik vorgegebenen Rhythmus anpassen, und das Individuum wurde auf ein funktionierendes Rädchen im Produktionsprozeß reduziert - eine Tendenz, die bis heute nicht angehalten wurde. "Der aufklärerische Glaube an die Bändigung »irrationaler« Gewalten und an freundliche, beflissene Automaten war allmählich Bedrohungsängsten und Aversionen gewichen"5.
E.T.A. Hoffmann gehört zu den frühen Warnern vor den Gefahren der Technisierung. Er interessierte sich früh für Automaten und diese Thematik beschäftigt ihn in vielen Werken. Er besuchte die damals populären Automatensammlungen und las auch viel darüber. So entstand die Geschichte "Die Automate", der erste umfassende Beitrag des Schriftstellers zu einer zeitgenössischen und noch immer aktuellen Thematik. Ich möchte hier nicht ausführlich auf den Inhalt eingehen, so viel sei aber gesagt, dass hier vom Besuch zweier "akademischer Freunde" in einer Ausstellung mit einem "redende(n) Türken" erzählt wird. Im Gegensatz zur allgemeinen Begeisterung und Bewunderung dieses "Kunstwerkes", äußern sich die beiden sehr negativ dazu: "Mir sind [...] alle solche Figuren, die dem Menschen nicht sowohl nachgebildet sind, als das Menschliche nachäffen, diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines toten Lebens, im höchsten Grade zuwider." 6 Die Einstellung des Autors dazu ist auch später immer wieder aus Worten seiner Helden vernehmbar: "Schon die Verbindung des Menschen mit toten, das Menschliche in Bildung und Bewegung nachäffenden Figuren zu gleichem Tun und Treiben hat für mich etwas Drückendes, ja Entsetzliches." 7 In Die Automate mißbilligte der bekannterweise musikalisch begabte, auch als Komponist, Kapellmeister und Musikrezensent tätige Autor vor allem die seelen- und gefühllose Musikmechanik: "Aber vollends die Maschinenmusik ist für mich etwas Heilloses und Greuliches" 8 ; "Der gr öß te Vorwurf, den man dem Musiker macht, ist, dass er ohne Ausdruck spiele, da er dadurch eben dem eigentlichem Wesen der Musik schadet oder vielmehr in der Musik die Musik vernichtet, und doch wird der geist- und empfindungsloseste Spieler noch immer mehr leisten als die vollkommenste Maschine, da es nicht denkbar ist, dass nicht irgend einmal eine augenblickliche Anregung aus dem Innern auf sein Spiel wirken sollte, welches natürlicherweise bei der Maschine nie der Fall sein kann." 9
AUTOMATENMENSCH IM SANDMANN
VERSCHWOMMENE GRENZE ZWISCHEN AUTOMATEN UND MENSCHEN
Während in Die Automate vom Anfang an den Protagonisten klar ist, dass sie mit einem Automaten zu tun haben, die Maschine also klar von der Gesellschaft abgetrennt ist (obwohl jedoch der Zusammenhang zwischen der Mechanik der Maschine und ihrer Fähigkeit, sinnvoll zu sprechen, ungewiß ist), wird in Der Sandmann ein Automat in die Gesellschaft "eingeschmuggelt", was fast von niemandem bemerkt wird. Nathanael verliebt sich ja sogar in einen Automaten. "In Die Automate besteht das Rätsel der Maschine in ihrem Funktionieren und in der Verbindung zu dem sich durch sie äußernden Sprecher; im Sandmann besteht das Rätsel der Maschine in der Frage, wie sich Maschine und Mensch überhaupt noch unterscheiden lassen. Die Gefahr am Automaten ist nicht nur die, dass man ihn mit einem lebendigen Menschen verwechseln könnte, sondern vielmehr die, dass es mit der Zunahme seiner Perfektion immer schwieriger wird, überhaupt Differenzkriterien zwischen Mensch und Maschine anzugeben."10 Eben diese Vollkommenheit des Automaten hat etwas Unheimliches, weil Unmenschliches an sich. So wird Olimpia als "himmlisch-schön" beschrieben, mit einem "wunderschön geformten Gesicht", während über Clara gesagt wird, dass sie "keineswegs für schön gehalten werden konnte". Claras Augen bzw. ihr "heller Blick" und ihr "ironisches Lächeln" werden aber gelobt; eben diese Qualitäten fehlen dem "Wachsgesicht" Olimpias:
"Wunderlich ist es doch, dass viele von unsüber Olimpia ziemlich gleich urteilen. Sie ist uns [...] auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Ihr Wuchs ist regelm äß ig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr! - Sie könnte für schön gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich möchte sagen, ohne Sehkraft wäre. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehm richtigen geistlosen Takt der singenden Maschine und ebenso ist ihr Tanz. Uns ist diese Olimpia ganz unheimlich geworden, wir mochten nichts mit ihr zu schaffen haben, es war uns, als tue sie nur so wie ein lebendiges Wesen und doch habe es mit ihr eine eigne Bewandtnis." 11 - so durchschaute Nathanaels Freund Sigmund das Automatenhafte an Olimpia. Ihr Körper und ihr Gesicht sind beinahe zu regelmäßig, wie auch ihre Bewegungen. "Das Menschliche" bedeutet immer auch "das Mangelhafte", "das Unvollkommene" und "das Unregelmäßige". Paradoxerweise wird Vollkommenheit von Menschen immer angestrebt, aber wenn sie erreicht worden wäre, würde das als "unmenschlich" gelten, weil Menschen eben nicht perfekt sind. Diese Erkenntnis hat im Sandmann paradoxe Folgen: " [ ... ] die Geschichte mit dem Automat hatte tief in ihrer Seele [der "hochzuverehrenden Herren"] Wurzel gefaßt und es schlich sich in der Tat abscheuliches Mißtrauen gegen menschliche Figuren ein. Um nun ganzüberzeugt zu werden, daßman keine Holzpuppe liebte, wurde von mehreren Liebhabern verlangt, dass die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, dass sie beim Vorlesen sticke, stricke, mit dem Möpschen spiele u.s.w., vor allen Dingen aber, dass sie nicht bloßhöre, sonder auch manchmal in der Art spreche, dass dieses Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetze." 12 Das Denken und Fühlen wird also als nur dem Menschen angehörig beschrieben. Das ist aber nicht so leicht bemerkbar, wie das Beispiel von Olimpia zeigt, die unter den Menschen eine Zeitlang "funktionierte" - in sinnentleerten Gesprächen der Teezirkeln reichte ihr bescheidener Wortschatz durchaus aus. "An der Fähigkeit zu kommunizieren läßt sich dieser Unterschied [zwischen Mensch und Maschine] in Hoffmanns Erzählung Der Sandmann jedenfalls nicht mehr festmachen, denn die Kommunikation wird darin als etwas Äußerliches, nicht notwendig mit menschlichem Empfinden in Zusammenhang stehendes beschrieben. Dass jemand spricht, muß nicht unbedingt voraussetzen, dass er auch denkt und fühlt."13 Die im Sandmann -Zitat beschriebene Unsicherheit der Herrschaften ist eben ein Beweis dafür, dass es um eine Gesellschaft geht, wo die Grenzen zwischen Menschen und Automaten verschwimmen und wo man nicht mehr weiss, ob man es mit einem menschlichen Automaten oder mit einem automatisierten Menschen zu tun hat. "Da es in der Kommunikation aber keine feststehenden Kriterien gibt, ob sie einem Menschen oder einer Maschine zuzurechnen ist, hat das absurde Konsequenzen: » In den Tees wurde unglaublich gegähnt und niemals genieset, um jedem Verdacht zu begegnen. « Automatismen wird mit Automatismen begegnet. Die dargestellte Gesellschaftsform mit all ihren Teezirkeln und Konventionen versucht zwar, Automaten auszuschließen, in Wirklichkeit aber begünstigt sie das Automatenwesen."14
GESELLSCHAFTKRITIK IM SANDMANN
Sowohl die höfische Etikette in den Hofgesellschaften des 18. Jahrhunderts, als auch die Sitten und Umgangsformen des aufsteigenden Bürgertums im 19. Jahrhundert sind Errungenschaften der Zivilisation, die den Menschen durch ihren Zwang in gewissem Grade zum Automaten macht. Deshalb ist es kein Wunder, dass die schöne Olimpia nicht sofort als bloße Puppe entpuppt wurde: "Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige Dünne des Leibes schien von zu starkem Einschnüren bewirkt zu sein. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel; man schrieb es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte." 15
Es ist bekannt, dass Romantiker Kleinbürger - "Philister" - verachteten und sich über sie auch gerne lustig machten. "Begabung, poetische Sensibilität, Kunst, das alles lag im Zeitalter einer sich verfestigenden, auf Nützlichkeitsdenken ausgerichteten bürgerlichen Gesellschaft im Bereich des Unsicheren und Unkonventionellen, der aufkommenden Bohème, und so ist es kein Wunder, dass sich im Bewußtsein ästhetisch empfindlicher Naturen der Gegensatz zwischen bürgerlicher Pragmatik oder auch kleinbürgerlicher Beschränktheit und individueller künstlerischer Weltsicht als ein - soziale Verhältnisse überhöhender - gleichsam anthropologischer Zwiespalt darstellte: »Philister« und »Künstler« standen typologisch einander gegenüber. [...] Bezeichnend für seine [Hoffmanns] Erzählkunst ist jedoch der Umstand, dass der genannte Gegensatz nicht nur pathetisch oder sentimental ausgetragen wird (wie bei anderen Vertretern der europäischen Romantik), sondern auf eine sehr eigentümliche Weise humoristisch und grotesk."16
Der Sandmann kann also sehr wohl als eine Gesellschaftkritik verstanden werden, besonders wenn einem bekannt ist, wie Hoffmann bereits 1869 in seinen Briefen über "Maschinenmenschen, die mich umlagern mit platten Gemeinplätzen" sowie über "dieästhetischen Cretins mit automatischer Bewegung ohne inneres Leben" 17 klagte. "Literarisch attackierte er solche Zeitgenossen als Philister, geist- und seelenlose Individuen ohne Individualität."18
DER WEG VON CLARA ZU OLIMPIA
Die Grenze zwischen Einbildungskraft und Realität. Nathanael und Clara
Im breiteren Sinne des Wortes ist auch Nathanael ein "Künstler"; selbst wenn er nur ein mediokrer Dichter sein sollte, - "Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig" 19 - "er ist doch ohne Zweifel aus solchem Zeug wie das zu Künstlern"20 ; er ist also ein empfindsamer Mensch mit großer Einbildungskraft, während die bürgerliche Clara "einen gar hellen scharf sichtenden Verstand" 21 besitzt und "von vielen kalt, gefühllos, prosaisch gescholten [wird]"22. Nicht ganz ohne Ironie wird Claras "ruhiges, weiblich besonnenes Gemüt" beschrieben und es wird kaum als Kompliment verstanden, daß ihrem Naturell "das ruhige häusliche Glück" entspreche, sie wird aber durchaus nicht als eine negative Gestalt beschrieben, besonders wenn man den scharfen Sarkasmus berücksichtigt, mit dem Hoffmann sonst die "heiratswütigen" Bürgerstochter angreift. Nathanael und Clara stellen aber immerhin zwei verschiedene, entgegengesetzte Prinzipien, zwei unterschiedliche Sichtweisen dar, was allmählig zu ihrer Trennung führt. Mit dem Auftauchen von Coppola an Nathanaels Studienort werden die grausamen Erinnerungen aus der Kindheit wieder gegenwärtig, er fürchtet sich vor einem "bösen Prinzip" und "dunklen Mächten". Clara lehnt die in seinem Brief dargestellten Erlebnisse als bloße Phantasterei ab, findet für alles eine vernünftige Erklärung und findet, dass "alles Entsetzliche und Schreckliche, wovon Du sprichst, nur in Deinem Innern vorging, die wahre wirkliche Außenwelt aber daran wohl wenig teilhatte" 23. Sie versucht, ihn auf diese vernünftige Weise zu ermutigen: "Seiüberzeugt, dass diese fremden Gestalten nichtsüber Dich vermögen; nur der Glaube an ihre feindliche Gewalt kann sie Dir in der Tat feindlich machen" 24 "Im Brief Nathanaels und in dessen Erwiderung durch Clara stehen sich die bereits aus dem Werk E.T.A. Hoffmanns bekannten Verständnisweisen der Realität gegenüber. Mit der These, dass die Aussenwelt nur die Projektionsfläche für subjektive Vorstellungen sei, vertritt Clara eine allegorische Auffassung. Die Erscheinungen der Außenwelt erhalten lediglich durch subjektive Deutungen einen Wert, der ihnen an sich nicht zukommt. Im Gegensatz dazu steht die symbolische Betrachtungsweise Nathanaels, der überzeugt ist, dass ihm in der Gestalt von Coppola/Coppelius ein höheres Prinzip in endlicher Gestalt entgegengetreten sei."25 Inwieweit sich in Nathanaels Darstellungen die objektive Realität oder die subjektiven Eindrücke eines Wahnsinnigen widerspiegeln, ist nicht mit Sicherheit feststellbar. "Der fiktive Sandmann wird aus der Mythe in die Realität versetzt, der reale Coppelius ins Mythische überhöht, und nie ist sicher zu entscheiden, welche seiner Eigenschaften und Verhaltensweisen mehr der Einbildung, welche mehr der Erfahrung entstammen."26 "Beide Erklärungsmodelle, das metaphysische Nathanaels und das psychologische Claras, scheinen, obwohl sie einander ausschließen, von der Geschichte belegt zu werden. [...] Das zu seiner Vernichtung geschmiedete Komplott läßt sich jedoch auch - und das spricht für Claras Position - als bloße Konstruktion eines »im Innern zerissenen« Menschen begreifen."27 Hoffmann läßt die Grenze zwischen Realität und Einbildungskraft nie ganz klar sein; sehr bedächtig hegt er die Zweideutigkeit und läßt damit mehrere Möglichkeiten der Interpretation zu. "Bezeichnend für Hoffmann, der lediglich die »Fantasie des Lesers« anrucken und »fortschwingen« lassen wollte."28 Im Sandmann geht er dann so weit, dass er sogar das Vorhandensein des Automaten in Frage stellt: "Der Professor der Poesie und Beredtsamkeit [...] sprach feierlich: » Hochzuverehrende Herren und Damen! merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie - eine fortgeführte Metapher! « " 29
Die vernünftigen Äußerungen Claras und ihr Mangel an Interesse für Nathanaels Dichtung führen zu ihrer Entfernung: "sein Verdrußü ber Claras kaltes prosaisches Gemüt stieg höher, Clara konnte ihren Unmutüber Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nichtüberwinden, und so entfernten sich beide im Innern immer mehr von einander, ohne es selbst zu bemerken." 30 Die Kulmination der Auseinandersetzung erfolgt nach der Empörung Claras gegen Nathanaels immer düsterer werdende Dichtung - "wirf das tolle - unsinnige - wahnsinnige Märchen ins Feuer." 31, worauf er sie als "lebloses, verdammtes Automat!" 32 beschimpft und, paradoxerweise, seine emotionale Erfüllung eben in einem Automaten findet.
Nathanael und Olimpia. Liebe zum Automaten
Wie kam es dazu, dass sich Nathanael, sich von einer Frau abwendend, die er für kalt und gefühllos hielt, gerade in einen wirklichen Automaten, der ja ein Inbegriff der Seelen- und Gefühllosigkeit ist, verliebt? Einer solchen pathologischen Liebe liegt ohne Zweifel sein Narzißmus zu Grunde. Vielmehr als ihre Schönheit zieht ihn nämlich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit an, ihre Fähigkeit, ihm schweigend zuzuhören. " [...] er lebte nur für Olimpia, bei der er täglich stundenlang saßund von seiner Liebe [...] fantasierte, welches alles Olimpia mit großer Andacht anhörte. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben. [...] und das alles las er der Olimpia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. Aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht, sie sah nicht durchs Fenster, sie fütterte keinen Vogel, sie spielte mit keinem Schoßhündchen, mit keiner Lieblingskatze, sie drehte kein Papierschnitzchen, oder sonst etwas in der Hand, sie durfte kein Gähnen durch einen leisen erzwungenen Husten bezwingen - Kurz! Stundenlang sass sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen [...] " 33 Ihre Fähigkeit, seine eigene Persönlichkeit zu spiegeln - dies macht Olimpia für Nathanael attraktiv. Indem er seine Seele in ihre innere Leere versetzt, belebt er die mechanische Holzpuppe. In ihr "liebt er nichts anderes als sein eigenes Ich, das von ihr reflektiert wird. Nur sie kann ihn ganz verstehen, denn in ihr regt sich keine andere Persönlichkeit, sondern sie wirft ihn auf sich selbst zurück."34 Ihn stört nicht ihre äußerste Wortkargheit, ganz im Gegenteil, ihr Schweigen ist für ihn ein Zeichen ihres absoluten Verständnisses ("nur von dir, von dir allein werd' ich ganz verstanden" 35 ), ihre wenigen und unbedeutenden Worte offenbaren ihm ihr "herrliches, tiefes Gemüt": "Sie spricht wenig Worte, das ist wahr; aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der innern Welt voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits." 36 Ihr Wort `Ach' vermag für ihn alles das auszudrücken, wonach er auf der Suche ist. Während er bei Clara, die seine Dichtung nicht mehr mag bzw. "nicht versteht" auf Kritik und Ablehnung stößt, gegen die er sich nicht zu behaupten weiß, ist Olimpia für ihn "ein ideales Publikum, das ihm die benötigte Anerkennung gibt, und sie ist doch zugleich nichts Eigenes und Abgrenzbares, sondern nur sein Spiegel."37 Deßhalb ist sie für ihn so begehrenswert. Er spricht es sogar konkret aus: "Du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt"; oder: "nur in Olimpias Liebe finde ich mein Selbst wieder" 38. All das zeugt davon, dass Nathanael mit seiner Eitelkeit und "hoffnungslose[n] Ichbezogenheit"39 für eine echte Liebe nicht reif genug ist und dass deswegen seine Beziehung mit Clara von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, sogleich ihre Individualität zum Vorschein gekommen wäre. "Wieder erweist sich die Besessenheit, die Krankheit Nathanaels, als völlige Monomanie. Das mechanische, notwendig verständnislose Seufzen der Puppe, [...] verwechselt er mit hingegeben liebevollem Zuhören, weil die völlige Leere und Passivität des weiblichen Partners als Ideal, das seiner isolierten Sebstsucht bequemste Verhalten ist, seinem Wunschtraum entspricht."40 "Wie ihm als Kind die direkte, körperhaft-sinnliche Teilhabe an seiner Umwelt mit Drohungen und Zwangsmaßnahmen untersagt wurde, so dass er auf sich selbst verwiesen war, wendet er sich als Erwachsener jeder möglichen Liebespartnerin auf indirekte Weise (vermittels eines Gedichtes oder eines Fernglases) zu, um sich, wieder auf sein Ich konzentriert, in ihr zu spiegeln. Die quasi stumme Olimpia ist eine ideale Projektionsfläche."41 Jetzt ist folglich ganz klar, warum ihn die Zerstörung Olimpias in Wahnsinn und schließlich in den Selbstmord getrieben hat - ihre grausame Zerstörung war aufgrund seiner narzißtischen Liebe gleichsam die Selbstzerstörung, Zerstörung seines eigenen Ichs. "Da er in ihrer Liebe sein Selbst wiederfindet, muß ihre Zertrümmerung seine eigene Vernichtung nach sich ziehen."42
SCHLUSSWORT
In dieser Hausarbeit hielt ich nicht für nötig, ausführlich auf den Inhalt einzugehen und ich habe auch nicht alle möglichen Gesichtspunkte berücksichtigt und viele Fragen, die sich nach der Lektüre aufwerfen, zu beantworten versucht, weil ich mich ausführlicher mit der Problematik der Maschinenmenschen beschäftigen wollte, wie schon der Titel besagt. Ob es der Autor beabsichtigt oder nicht, spiegeln sich die geschichtliche, politische und gesellschaftliche Situation des jeweiligen Zeitalters, die damit verbundenen Probleme und die Erfahrungswelt des Autors in der Literatur wider, so auch in Hoffmanns Erzählung Der Sandmann, die aber nichtsdestoweniger an ihrer Aktualität eingebüßt hat. Ich fühlte mich von der Aktualität dieses schon fast zwei Jahrhunderte alten Werkes am meisten angetan und gerade deswegen fand ich es für einen Interpretationsversuch interessant. "Hoffmanns Visionen von der Ununterscheidbarkeit gewisser Erdenbürger und Androiden, die nur so tun »wie ein lebendiges Wesen«, haben sich in den vergangenen 180 Jahren als schauderhaft zukunftsträchtig erwiesen. [...] Erstaunlich, wieviel dieser Schriftsteller von den negativen Folgen einer systematisch erfaßbaren und automatisierten Lebenswelt ahnte und beispielhaft gestaltete."43 Das Klonen hat in der letzten Zeit sehr viel Staub aufgewirbelt, von einigen Begeisterten gepriesen, von vielen aber auch als ein Werk des Teufels beschimpft, wie im bereits genannten Fall von Thomas von Aquin. Eins ist aber sicher - wir leben in einer Zeit, wo die Angst vor künstlichen Menschen berechtigter denn je zu sein scheint, weil es nur noch die Frage der Zeit ist, wann auch der Mensch geklont wird (obwohl sehr wohl auch anzunehmen ist, dass das schon geschehen ist). Diese Tatsache erweckt unheimliche Gefühle, weil man sich der möglichen, ja anzunehmenden Überlegenheit der Automaten bewußt ist.
Aber auch im allegorischen Sinne, also als Kritik Hoffmanns an einer im hohen Grade automatisierten Gesellschaft, ist Der Sandmann aktuell, denn wegen der immer unübersehbareren Bürokratie einerseits, und wegen der ständig größeren Auseinanderentwicklung der Wissenschaften andererseits - weshalb die meisten Menschen unabwendbar zu "Fachidioten" werden - hat man heute mehr Gründe denn je, sich als nur ein Rädchen eines mehr oder weniger gut funktionierenden (Staats)apparates zu fühlen. Und letztendlich vermag uns Der Sandmann, bzw. die Erklärung der Liebe Nathanaels zu Olimpia, Aufschluss über die Möglichkeit der aus der Erfahrung bekannten, aber schwer zu fassenden Beziehungen einiger Menschen mit den "lebenden Puppen" zu geben.
LITERATURVERZEICHNIS
- E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1998
- E.T.A. Hoffmann, Spukgeschichten, Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1996
- E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Erläuterungen und Dokumente, von Rudolf Drux, Philipp Reclam jun. Stuttgart 1994
- Eberhard Hilscher, Hoffmanns poetische Puppenspiele und Menschmaschinen, TEXT + KRITIK. Zeitschrift für Literatur. SONDERBAND, München 1992
- Nikolai Vogel, E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann" als Interpretation der Interpretation, Münchener Studien zur literarischen Kultur in Deutschland, Band 28, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main · Bern· New York
- Brunhilde Janßen, Spuk und Wahnsinn, Zur Genese und Charakteristik phantastischer Literatur in der Romantik, aufgezeigt an den "Nachtstücken" von E.T.A. Hoffmann, Europäische Hochschulschriften, Reihe I, Deutsche Sprache und Literatur, Bd./Vol. 907, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main · Bern· New York
- Ernst von Schenck, E.T.A. Hoffmann, Ein Kampf um das Bild des Menschen, Verlag Die Runde, Berlin 1939
- Peter von Matt, Die Augen der Automaten, E.T.A. Hoffmanns Imaginationslehre als Prinzip seiner Erzählkunst, Max Niemeyer Verlag Tübingen 1971
- Stefan Ringel, Realität und Einbildungskraft im Werk E.T.A. Hoffmanns, Böhlau Verlag Köln · Weimar · Wien, 1997
- Stefan Piontek, Das Problem des Automatenmenschen am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Nachtstück "Der Sandmann", Hausarbeiten.de, 1994
- Viktor Žmega (Hrsg.), Kleine Geschichte der deutschen Literatur, Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Beltz Athenäum Verlag, Weinheim, 1997
- Viktor Žmega (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literatur, Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Band I/2 (Kapitel: Die Romantik: Wirkungen der Revolution und neue Formen literarischer Autonomie), Beltz Athenäum Verlag, Weinheim, 1996
- Brockhaus Enzyklopädie
[...]
1 gr. autómatos = "sich selbst bewegend", "aus eigenem Antrieb"
2 Dotzler, Gendolla, Schäfer: MaschinenMenschen, Eine Bibliographie; Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1992 (Bibliographien zur Literatur- und Mediengeschichte; Bd.1)
3 tschech. robota = Fronaarbeit
4 Viktor Žmega (Hrsg.): Kleine Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart", S.79
5 E. Hilscher: Hoffmanns poetische Puppenspiele und Menschmaschinen
6 Die Automate, S.12
7 Die Automate, S.33
8 Die Automate, S. 33
9 Die Automate, S. 34
10 Nikolai Vogel: E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann" als Interpretation der Interpretation, S. 61
11 Der Sandmann, S.33
12 Der Sandmann, S. 37, 38
13 Nikolai Vogel: E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann" als Interpretation der Interpretation, S.61
14 Nikolai Vogel: E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann" als Interpretation der Interpretation, S. 63
15 Der Sandmann, S.29
16 Viktor Žmega (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literatur, Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Band I/2, S. 164, 165
17 E. Hilscher: Hoffmanns poetische Puppenspiele und Menschmaschinen
18 E. Hilscher: Hoffmanns poetische Puppenspiele und Menschmaschinen
19 Der Sandmann, S. 22
20 Peter von Matt: Die Augen der Automaten, S.79
21 Der Sandmann, S. 20
22 Der Sandmann, S. 20
23 Der Sandmann, S. 13
24 Der Sandmann, S. 15
25 Stefan Ringel: Realität und Einbildungskraft im Werk E.T.A. Hoffmanns
26 E.T.A. Hoffman, Der Sandmann, Erläuterungen und Dokumente, S. 54
27 E.T.A. Hoffman, Der Sandmann, Erläuterungen und Dokumente, S. 51, 52
28 E. Hilscher: Hoffmanns poetische Puppenspiele und Menschenmaschinen
29 Der Sandmann, S. 37
30 Der Sandmann, S. 22
31 Der Sandmann, S. 24
32 Der Sandmann, S. 24
33 Der Sandmann, S. 33, 34
34 B.Janßen, Spuk und Wahnsinn, S.175
35 Der Sandmann, S. 34
36 Der Sandmann, S. 33
37 B.Janßen, Spuk und Wahnsinn, S.176
38 Der Sandmann, S. 31; 33
39 Schenck, Ein Kampf um das Bild des Menschen, S. 320
40 Schenck, Ein Kampf um das Bild des Menschen, S. 320
41 E.T.A. Hoffman, Der Sandmann, Erläuterungen und Dokumente, S. 53
42 E.T.A. Hoffman, Der Sandmann, Erläuterungen und Dokumente, S. 53
Häufig gestellte Fragen zu Der Sandmann
Worum geht es in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann?
Der Sandmann handelt von Nathanael, einem Physikstudenten, der in seiner Kindheit traumatische Erlebnisse mit einer Figur namens Coppelius hatte. Diese Erlebnisse prägen sein Leben und führen dazu, dass er in der scheinbar lebendigen Puppe Olimpia eine ideale Geliebte sieht. Die Erzählung thematisiert die Grenzen zwischen Realität und Einbildungskraft, die Gefahren der Technisierung und Automatisierung sowie die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft.
Was sind die Hauptthemen in Der Sandmann?
Zu den Hauptthemen gehören: Die Faszination von Automaten, die verschwimmenden Grenzen zwischen Mensch und Maschine, die Kritik an einer erstarrten Gesellschaft, die Auseinandersetzung zwischen Einbildungskraft und Realität, die Liebe zum Automaten als Ausdruck von Narzissmus und die Gefahren der Technisierung.
Welche Rolle spielen Automaten in der Erzählung?
Automaten symbolisieren die zunehmende Mechanisierung und Entfremdung in der Gesellschaft. Olimpia, der Automat, wird von Nathanael idealisiert, da sie ihm ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt und seine narzisstischen Bedürfnisse befriedigt. Sie verkörpert aber auch die Gefahren der Gefühlskälte und Seelenlosigkeit, die durch Automatisierung entstehen können.
Wer sind die wichtigsten Charaktere in Der Sandmann und wie stehen sie zueinander?
Die wichtigsten Charaktere sind:
- Nathanael: Der Protagonist, ein sensibler und von seiner Fantasie getriebener Student, der traumatische Kindheitserlebnisse hat und sich in den Automaten Olimpia verliebt.
- Clara: Nathanaels Verlobte, eine vernünftige und bodenständige Frau, die Nathanaels Fantasien kritisch gegenübersteht und für ihn die Realität verkörpert.
- Coppelius/Coppola: Eine ambivalente Figur, die sowohl als unheimlicher "Sandmann" aus Nathanaels Kindheit als auch als Mechaniker und Verkäufer von Augen auftritt und Nathanaels Ängste auslöst.
- Olimpia: Ein Automat, der von Professor Spalanzani konstruiert wurde und von Nathanael als lebendige Frau wahrgenommen wird. Sie wird zum Objekt seiner narzisstischen Liebe.
Was ist die Bedeutung des Begriffs "das Unheimliche" im Zusammenhang mit Der Sandmann?
Sigmund Freud analysiert Der Sandmann in seinem Essay "Das Unheimliche". Er verbindet die Angst vor dem Augenraub mit der Kastrationsangst und sieht im Automaten eine Bedrohung der menschlichen Identität. Das Unheimliche entsteht durch die Wiederkehr von etwas Vertrautem in einer entfremdeten und beängstigenden Form.
Wie kritisiert Der Sandmann die Gesellschaft?
Die Erzählung kritisiert die bürgerliche Gesellschaft für ihre Erstarrung, ihre Konventionen und ihre Tendenz zur Automatisierung des Individuums. Olimpia kann in der Gesellschaft "funktionieren", weil die Kommunikation oft oberflächlich und sinnentleert ist. Die Erzählung warnt vor einer Gesellschaft, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen.
Was bedeutet die Zerstörung Olimpias für Nathanael?
Die Zerstörung Olimpias bedeutet für Nathanael den Verlust seines idealisierten Selbstbildes und seiner narzisstischen Projektion. Da er in Olimpia nur sein eigenes Ich liebt, ist ihre Zerstörung gleichbedeutend mit der Zerstörung seiner eigenen Identität, was ihn in den Wahnsinn und Selbstmord treibt.
Welche Interpretationsmöglichkeiten gibt es für Der Sandmann?
Der Sandmann kann auf verschiedene Weise interpretiert werden: als psychologische Studie über die Auswirkungen traumatischer Kindheitserlebnisse, als Kritik an der Mechanisierung der Gesellschaft, als Auseinandersetzung mit den Grenzen zwischen Realität und Einbildungskraft, als Darstellung narzisstischer Liebe und als Warnung vor den Gefahren der Technisierung.
Welche Rolle spielt die Fantasie in der Erzählung?
Die Fantasie spielt eine zentrale Rolle. Nathanaels überbordende Fantasie lässt ihn die Welt anders wahrnehmen und verzerrt seine Realitätssicht. Clara hingegen steht für Vernunft und Realitätssinn. Die Spannung zwischen Fantasie und Realität ist ein zentrales Thema der Erzählung.
- Quote paper
- Latica Bilopavlovic (Author), 1999, Automatenmenschen bei E.T.A. Hoffmann unter besonderer Berücksichtigung seiner Erzählung "Der Sandmann", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97832