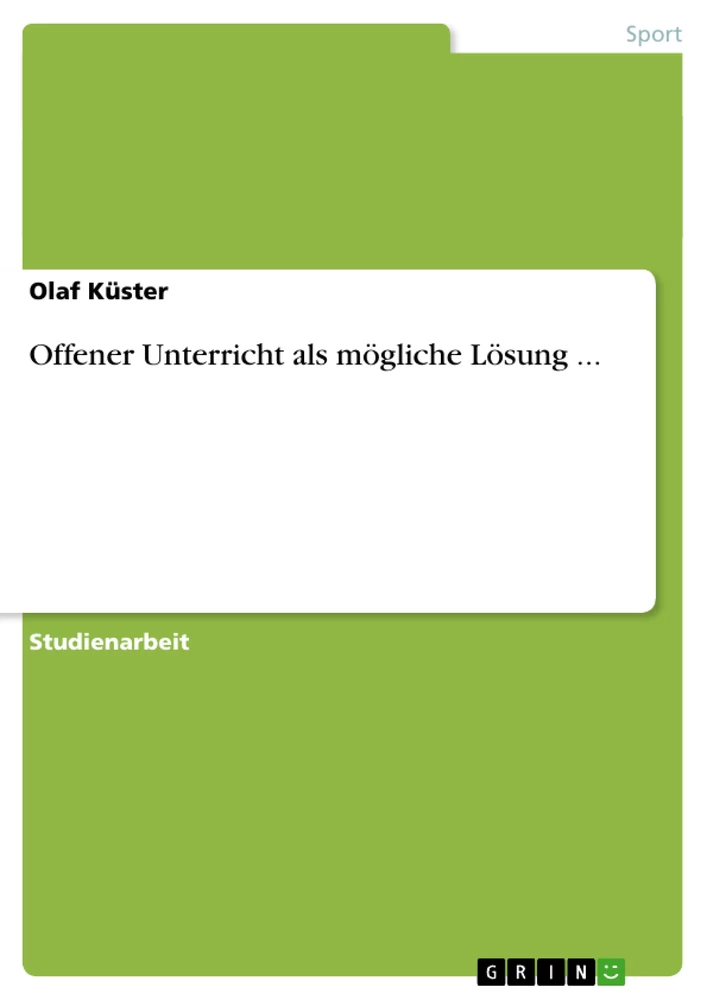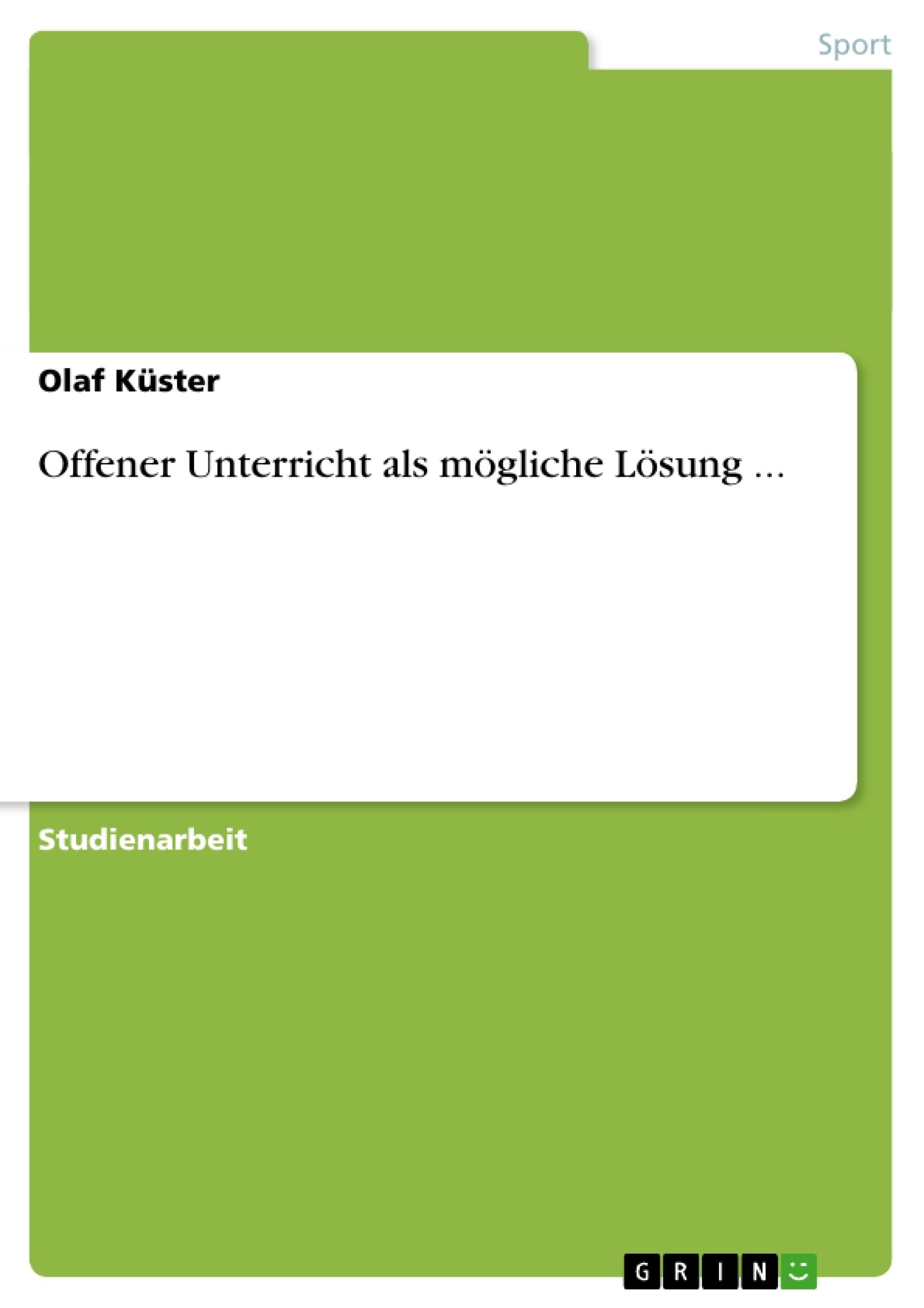Stell dir vor, du stehst in einer Sporthalle, umgeben von erwartungsvollen Gesichtern, und die Frage brennt in dir: Wie gestalte ich den perfekten Sportunterricht? Ein Unterricht, der nicht nur körperliche Fitness fördert, sondern auch die Freude an der Bewegung weckt und nachhaltig prägt. Dieses Buch ist dein Schlüssel zu einer neuen Perspektive auf den Sportunterricht. Es beleuchtet die zentralen fachdidaktischen Konzepte – vom Sportartenprogramm nach Söll über die Handlungsfähigkeit nach Kurz bis zur Körpererfahrung nach Funke – und zeigt, wie diese in der Praxis Anwendung finden können. Doch damit nicht genug: Der Fokus liegt auf dem offenen Unterricht, einer innovativen Methode, die Schüler aktiv in die Gestaltung des Unterrichts einbezieht und ihre Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit fördert. Entdecke, wie du starre Strukturen aufbrechen und einen dynamischen, schülerzentrierten Unterricht schaffen kannst, der den individuellen Bedürfnissen und Interessen jedes Einzelnen gerecht wird. Erfahre, wie du die neuen Richtlinien im Sportunterricht optimal umsetzt und eine Lernumgebung schaffst, in der sich Schüler entfalten und ihre Begeisterung für Sport entdecken können. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle Sportlehrer, Referendare und Pädagogen, die ihren Unterricht lebendiger, effektiver und nachhaltiger gestalten wollen. Es bietet praktische Anleitungen, innovative Ideen und fundierte theoretische Grundlagen, um den Sportunterricht zu einem positiven und prägenden Erlebnis für Schüler und Lehrer zu machen. Lass dich inspirieren und gestalte einen Sportunterricht, der mehr ist als nur Bewegung – ein Unterricht, der Werte vermittelt, Kompetenzen fördert und die Freude am Sport entfacht. Werde zum Architekten eines bewegenden Lernerlebnisses und entdecke die unendlichen Möglichkeiten des offenen Sportunterrichts! Die Konzepte von Söll, Kurz, Funke und Volkamer werden praxisnah analysiert, um Lehrern einen klaren Leitfaden für ihren Unterricht zu bieten. Der offene Unterricht wird als ideale Lösung für einen zeitgemäßen Sportunterricht präsentiert, der die individuellen Bedürfnisse der Schüler in den Mittelpunkt stellt. Methoden zur Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen werden ebenso thematisiert wie die Förderung sozial-kommunikativen Lernens. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Ressource für alle, die den Sportunterricht von einer traditionellen Leibesübung zu einem ganzheitlichen und motivierenden Erlebnis transformieren möchten. Es zeigt, wie man die Schüler aktiv einbezieht, ihre Selbstständigkeit fördert und ihre Begeisterung für Sport und Bewegung nachhaltig weckt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definition des Sportunterrichts
3 Die fachdidaktischen Konzepte
3.1 Das Sportartenprogramm nach SÖLL
3.2 Die Handlungsfähigkeit nach KURZ
3.3 Die Körpererfahrung nach FUNKE
3.4 Die Entpädagogisierung
4 Offener Unterricht
4.1 Ziel des offenen Sportunterrichts
5 Diskussion
6 Literatur
1 Einleitung
Im tagtäglichen Sportunterricht kann der ausführende Lehrer sich von vier fachdidaktischen Konzepten distanzieren oder sich daran orientieren. Sportlehrer/innen folgen nicht einem jener Konzepte auf dem Weg in die Praxis, sondern formen sich ihren persönlichen Orientierungsrahmen mit einer Mischung aus Alltagserfahrung und Handlungswissen, aus Richtlinien, Routinen, Rezepten und wohl auch aus fachdidaktischen Konzeptbausteinen (BALZ 1992, 13). Dem hinzuzufügen bleibt noch die Erfahrung aus der eventuell eigenen Sportkarriere des Lehrkörpers.
Die Frage, die sich ein/e Sportlehrer/in in der 2. Ausbildungsphase mit größter Wahrscheinlichkeit immer öfter stellt, ist die nach dem richtigen Handeln und Unterrichten in einer Sporteinheit.
Wie schaffe ich es, wenigstens einem der fachdidaktischen Konzepte annähernd treu zu bleiben, die Richtlinien zu erfüllen?
Wie gestalte ich meinen Unterricht so attraktiv, dass sich alle Schüler und Schülerinnen bewegen, Freude am Sport finden und alle eine körperlich und psychisch optimale Entwicklung machen?
Denn eines steht mit Sicherheit nach wie vor fest: Eine Unterrichtsstunde im Fach Sport bedeutet nur selten 45 Minuten Unterricht, zumeist sind es nur 35 Minuten, wenn überhaupt. Glücklich kann sich derjenige oder die diejenige schätzen, die eine Doppelstunde Sport zur Verfügung hat.
Je umfangreicher die individuelle Kenntnis sportdidaktischer Arbeiten und Fragestellungen ist, um so mehr stellt sich die Aufgabe, unter den verschiedenen Angeboten abzuwägen. Oder gibt es eine ganz einfache Lösung, die nur noch niemand gefunden hat?
Ich persönlich plädiere für den offenen Sportunterricht. Die Schüler und Schülerinnen werden hier direkt mit eingebunden, können und dürfen den Unterricht und die Inhalte mit gestalten.
In meiner Arbeit möchte ich versuchen, den offenen Sportunterricht als mögliche Lösung für einen optimalen Sportunterricht nach den neuen Richtlinien darzustellen. Gerade in bezug auf die neuen Richtlinien im Sport scheint mir diese Unterrichtsform als die geeignetste zur Umsetzung des Faches Sport in der Schule zu sein. Dagegen bilden meiner Meinung nach die vier fachdidaktischen Konzepte nach SÖLL, VOLKAMER, KURZ und FUNKE einen undurchdringlichen Weg durch einen Dschungel von Unterrichtsmöglichkeiten, gerade für Referendare und Referendarinnen.
2 Definition des Sportunterrichts
„Sportunterricht soll als Unterricht in verschiedenen sportlichen Aktivitäten zur Förderung der körperlichen Entwicklung und des Wohlbefindens des Einzelnen dienen. Sport-(und Schwimm-)unterricht wird im Allgemeinen in Schulen und Vorschulen erteilt und ist in manchen Ländern ein Pflichtfach. Grundlage der Leibeserziehung, wie der Sportunterricht früher bezeichnet wurde, sind neben der Umsetzung körperlicher Übungen und gemeinschaftsfördernder Spiele die Erkenntnisse der Sportpädagogik. Wichtiger als die Heranbildung körperlicher Höchstleistungen als Rekrutierung für den Leistungssport erscheint nach modernem Verständnis die Vermittlung der Freude an der Bewegung im Sinne eines lebenslang betriebenen Breitensports, der die allgemeine Gesunderhaltung der Bevölkerung zum Ziel hat. Dies schließt die Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf individuell unterschiedliche Leistungspotentiale ein, um Frustrationserlebnisse und schließlich Motivationsverlust zu vermeiden. Durch Bewegungsarmut (in Verbindung mit anderen „Zivilisationssünden”) entstehen hohe volkswirtschaftliche Folgekosten.
In der Antike bestand der Sportunterricht aus Gymnastik, um Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer zu trainieren. Für die Griechen war der menschliche Körper ein Tempel von Geist und Seele, der durch Sport gesund und funktionstüchtig erhalten wurde. Die Leibesertüchtigung, wie sie mit dem Turnvater Jahn und seiner um 1810 gegründeten Bewegung populär wurde, übte wegen der damit verbundenen Werte wie Disziplin und Ehrgeiz seit jeher auch auf autoritäre Herrschaftssysteme eine besondere Faszination aus, so vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus.
Heute werden im Sportunterricht häufig Spiele eingesetzt. Sie tragen neben der Steigerung der körperlichen Fitness vor allem dazu bei, soziale Verhaltensweisen auszubilden. Da Spiele die Zusammenarbeit in einer Mannschaft erfordern, fördern sie nach Meinung der Befürworter den Teamgeist, der für das Arbeiten in Gruppen wichtig ist. Dem steht allerdings auch eine darwinistische Komponente gegenüber, die den schwächsten Mitgliedern einer Gruppe explizit zum Ausdruck gebrachte Geringschätzung, Minderwertigkeitsgefühle und ein Gefühl des Ausgestoßenwerdens einbringt“ (MS Encarta 2000).1
3 Die fachdidaktischen Konzepte
In den Diskussionen um den Sportunterricht in der Praxisumsetzung stehen vier relativ trennscharfe fachdidaktische Konzepte im Mittelpunkt:
- Das Sportartenprogramm nach SÖLL
- Die Handlungsfähigkeit nach KURZ
- Die Körpererfahrung nach FUNKE
- Die Entpädagogisierung nach VOLKAMER
3.1 Das Sportartenprogramm nach SÖLL
Die Aufgabe des Schulsports besteht nach Söll darin, konditionelle und motorische Fähigkeiten auszubilden, damit sich die Schüler und Schülerinnen für den Sport außerhalb der Schule qualifizieren. Der Sportunterricht soll zu einem lebenslangem Sporttreiben anregen. Lernerfolg, Bewegungsoptimierung und quantifizierbare sportliche Leistungen fungieren als Prüfgrößen (vgl. BALZ 1992, 14).
Zu den traditionellsten Sportarten gehören in dieses Konzept natürlich Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, Gymnastik/Tanz, Spiele wie Fußball, Handball, Volleyball und mehr. Sie werden unterrichtet nach den festgelegten internationalen Wettkampf- und Regelsystemen, und werden nur alters- und institutionsspezifisch abgeschwächt, die „sportmotorische Leistung bleibt jedoch zentraler Maßstab“ (BALZ 1992, 15).
3.2 Die Handlungsfähigkeit nach KURZ
Die Leitidee greift unter der Prämisse, menschliches Handeln als sinngeleitetes und sinnbedürftiges Tun zu fassen, deutlich weiter. Im Mittelpunkt der Handlungsfähigkeit stehen bestimmte Sinnperspektiven, die sich im Sport erschließen lassen und die für jedes Individuum individuell bedeutsam und pädagogisch wertvoll sein können. Insgesamt sind dies sechs Sinnperspektiven: Leistung, Gesundheit, Geselligkeit, Spannung, Eindruck und Ausdruck. Schüler und Schülerinnen, die in der Lage sind, aus der Vielfalt der sportlichen Sinnbezüge einige ihnen angemessene Formen zu finden und diese im Sporttreiben befriedigen, gelten als handlungsfähig (vgl. BALZ 1992, 14). Zudem schließt die Handlungsfähigkeit auch kognitive Aspekte des Sport-Begreifens und soziale Aspekte des sportlichen Miteinanders ein.
Die Anforderungen des Sportunterrichts wird den Anforderungen des Entwicklungsstandes und der Motivationslage von Schülern und Schülerinnen angepaßt. Dies erfordert eine ständige Veränderungsbereitschaft und Variationsfähigkeit der Lehrer und Lehrerinnen.
3.3 Die Körpererfahrung nach FUNKE
Der Sportunterricht soll den Schülern Erfahrungen des Körpers und Erfahrungen mit dem Körper - also materiale, soziale, symbolische - als Lerngelegenheiten bieten (vgl. FUNKE 1983, 7).
Schüler und Schülerinnen werden als „aktive Gestalter“, als „Subjekt ihres Tuns und nicht als Objekt seiner Lebensverhältnisse“ gesehen (vgl. FUNKE 1991, 15).
Gegenstände der Erfahrung im Sportunterricht sind vorrangig der Körper und die Bewegung. Die Aufgabe des Sportunterrichts besteht in der Ausbildung einer individuell unverwechselbaren Bewegungsidentität. Es verbietet denselben festgelegten Sport für alle. Gerätespielplätze, Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Bewegungskünste spielen eine zentrale Rolle im Konzept der Körpererfahrung.
3.4 Die Entpädagogisierung nach VOLKAMER
Prinzipiell gesehen spricht man hier von einem fachdidaktischem Konzept, beklagt wird jedoch in der Entpädagogisierung die Didaktisierung des Sportunterrichts, also die Überlagerung und Überforderung des autotelischen Sports durch pädagogische Zielorientierungen wie Gesundheits- oder Sozialerziehung (BALZ 1992, 15). Möglichst zwanglos soll den Schülern und Schülerinnen die Herausforderung des Sports mit all seinen Reizen vermittelt werden. Das selbstbestimmte Leisten und Können rückt in den Mittelpunkt. Schüler und Schülerinnen können selbst entscheiden, ob sie etwas leisten wollen oder können, Verantwortung gegenüber sich selbst und Selbstvertrauen werden somit entscheidend gefördert.
Sport wird als freiwilliges, folgenloses, körperbetontes Handlungsgeschehen begriffen, das sich auf die Lösung beliebig gesetzter Aufgaben richtet.
4 Offener Unterricht
Offener Unterricht wird meist in Form von Impulsen durch den Lehrer oder die Lehrerin geleitet. Er entspricht ungefähr dem Unterricht in einer Grundschule, wenn der Lehrkörper durch Impulsfragen auf Antworten und Eindrücke der Kinder hinaus will. Ferner gibt es im Gegensatz zur geschlossenen Unterrichtsform kein festgelegtes Lernziel, sondern die Schüler und Schülerinnen arbeiten an der Planung und Gestaltung der Stunde mit. Diese Vorgehensweise soll die eigenverantwortliche, spontane Handlungsfähigkeit durch selbständiges Organisieren von Bewegungen sichern.
KURZ lieferte 1993 fünf gute Gründe für eine Öffnung des Sportunterrichts:
1. Nicht alle wertvollen Unterrichtsergebnisse sind planbar.
2. Für kein Ziel gibt es den optimalen Lernweg.
3. Jede Unterrichtsgruppe besteht aus Individuen.
4. Es gibt kein ganzheitliches Lernen.
5. Schüler sollen in ihrer Selbständigkeit gefördert werden.
FUNKE lieferte bereits 1991 vier Argumente für einen offenen Unterricht:
1. In den Sportunterricht soll ein Initiativ- und Verständigungscharakter einfließen, weil dies unserem Menschenbild entspricht. Der Mensch ist als aktiver Gestalter seiner selbst und seiner Lebenswelt zu sehen. Er ist „Subjekt seines Tuns und nicht Objekt seiner Lebensverhältnisse“ (FUNKE 1991, 15).
2. Da wir in einem demokratischen Staat leben, soll auch zum Verstehen und Handeln in einer Demokratie beigetragen werden.
3. Gegenüber einer Erziehung zur Kreativität ist die Anpassungserziehung an das Gegebene zweitrangig (vgl. FUNKE 1991, 15).
4. Kein Mensch bewegt sich so wie der andere (ebd. , 15). Empirische Untersuchungen aus Sport- und Psychomotorik bestätigen diese Aussage. BALZ u.a. bestätigen dies: „ Die Vorstellung einer eindeutigen, für alle verbindlichen Normbewegung muß aufgegeben werden“ (1997, 22).
Beide, KURZ und FUNKE, betonen aber auch, daß es bestimmte Grade der Offenheit gibt. Diese ergeben sich jeweils aus der Verständigung der Beteiligten. Im Laufe einer Unterrichtseinheit soll somit mit den Schülern und Schülerinnen gesprochen, diskutiert und abgestimmt werden, wie und warum bestimmte Bewegungen und Spiele durchzuführen sind. Dies setzt allerdings voraus, daß „der Lehrer nicht selbst das Programm ist“ (KURZ 1993, 205), sondern die Schüler und Schülerinnen haben zum Teil selbst die Programmvorgabe abzurufen, die Erfolgskontrollen durchzuführen und den Übergang zum nächsten Lernschritt zu entscheiden. Die Schüler und Schülerinnen sollen sich also selbst untereinander kontrollieren und entscheiden, wie lange ein Lernschritt beizubehalten ist.
Ein Kriterium darf dabei aber nicht vernachlässigt werden: Die Auswahl der Sportart. Die Wirkung des Unterrichts hängt nämlich oft nur zum geringen Teil von den Inhalten ab, denn auch die Methode bestimmt die Wirkung (KURZ 1993, 208).
4.1 Ziel des offenen Sportunterrichts
Der offene Unterricht soll dazu beitragen, daß die Schüler und Schülerinnen mehr aus dem Sportunterricht mitnehmen als nur „sich bewegt zu haben“. Denn oft kommt die Bemerkung: „Im Sport lernt man nichts“. Wahrscheinlich denkt auch der größte Teil der Schülerschaft so, vielleicht (und hoffentlich) aber auch ein kleinerer.
Durch die eigenen Ideen sollen die Schüler und Schülerinnen Spaß am Sport finden und sich auch mal an die Sportarten heranwagen, die sie sonst vielleicht nie ausprobieren würden. Und diejenigen, die bisher gar keine Lust zur sportlichen Bewegung haben (z.B. Übergewichtige), sollen durch den offenen Sportunterricht bessere Möglichkeiten finden, sich für den Sport zu begeistern. Denn in dieser Unterrichtsform fällt es ihnen sicher leichter, persönliche Erfolge zu erringen, sei es durch Bewegungsmuster oder nur durch die Mitarbeit bei der Gestaltung des Unterrichts.
Weiterhin wird durch den offenen Unterricht eine größere Anregung geschaffen, sich auch außerschulisch für den Sport oder eine bestimmte Sportart zu begeistern.
5 Diskussion
Im letzten Jahr stand eine Frage im Brennpunkt der Diskussion: Sport in der Schule - wozu? Sportpädagogen streiten darüber, ob der Sportunterricht im Sinne einer Erziehung zum Sport oder im Sinne einer Erziehung durch den Sport zu gestalten sei (CACHAY 1999, 97). Genau wie CACHAY plädiere ich für eine Erziehung durch den Sport. Natürlich erreiche ich mit einer Erziehung der Schüler und Schülerinnen zum Sport ein wesentliches Ziel: die Möglichkeit zum lebenslangen Sporttreiben und die damit verbundene (eigene) positive Gesundheitsförderung und die Steigerung meines (subjektiven) Wohlbefindens. Was natürlich den Kostenträgern von Krankengeldern sehr entgegenkäme. Nicht umsonst wurden vor einigen Jahren Fitness-Studios von Krankenkassen subventioniert, wenn sie entsprechende Gesundheitsangebote anboten und durchführten. Das es dabei aber ebenfalls zu einer Kostenexplosion kam, damit wurde wahrscheinlich nicht gerechnet, aber es wurde ja auch viel Schindluder getrieben, was hier aber nicht näher zu erläutern ist.
Der wesentlichere Grund aber für die Aufhebung der pragmatischen Reduzierung des Erziehungsverständnisses liegt in der Begründung des Faches Sport in der Schule (vgl. CACHAY 1999, 97). Diese kann nur gelingen, wenn die erzieherischen Leistungen dieses Faches für Individuum und Gesellschaft hervorgehoben werden. Man darf auf eine Erziehung durch den Sport nicht verzichten: „Sport in der Schule nur um des Sports außerhalb der Schule willen ist im Kampf um schulische Pflichtstunden kein überzeugendes Argument“ (CACHAY 1999, 97). Nur durch seine besonderen erzieherischen Leistungen für Individuum und Gesellschaft kann das Schulfach Sport ausreichend begründet werden.
Mit der Entwicklung der neuen Richtlinien 2000 (LANDESINSTITUT FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG 1997) ist meines Erachtens den Sportpädagogen ein Schritt zur optimalen Begründung für das Unterrichtsfach Sport in der Schule gelungen. Sechs Perspektiven bilden das Fundament der neuen Richtlinien:
A) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern
B) Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten
C) Etwas wagen und verantworten
D) Das Leisten erfahren und reflektieren
E) Gemeinsam handeln, Wettkämpfen und sich verständigen
F) Die Fitness verbessern, Gesundheitsbewußtsein entwickeln
Weiter werden in den neuen Richtlinien folgende Methoden und Formen des selbständigen Arbeitens propagiert:
- Methodisch-strategisches Lernen
- Methoden der Analyse von Bewegungsabläufen
- Methoden der Analyse von Spielhandlungen
- Exakte Beobachtung und Beschreibung von Bewegungshandlungen
- Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen
- Erproben und Experimentieren
- Sozial-kommunikatives Lernen
- Arbeit in der Gruppe
- Verbesserung von Arbeits-, Gesprächs- und Kooperationstechniken
- Bereitschaft und Fähigkeit der Absprache
- Verständigung unter den Beteiligten
- Verantwortliche Übernahme von Aufgaben
- Übernahme von Leitungsaufgaben im Lern- und Übungsprozess
Und genau hier ist der offene Unterricht anzusetzen. Denn wie zuvor schon erwähnt, hat offener Unterricht zum Ziel, daß die Schüler und Schülerinnen mehr aus dem Sportunterricht mitnehmen als nur „sich bewegt zu haben“. Selbständigkeit, Verantwortung, Kreativität, Teamfähigkeit (als soziales Miteinander) sind die vorherrschenden Ziele des offenen Unterrichts in der Schule. Und genau hierin steckt die Begründung für das Fach Sport in der Schule, warum der Sportunterricht nicht vom Lehrplan gestrichen werden darf: Sport erzieht die Menschen nicht zum Ausführen außerschulischen Sports, sondern zum gegenseitigem Miteinander, zur Interaktion. Nur der offene Sportunterricht erfüllt die Kriterien der neuen Richtlinien, die vier fachdidaktischen Konzepte können dies nur teilweise.
Bleibt als Abschluß nur noch die Frage: Wie gestalte ich den offenen Unterricht mit den Schülern und Schülerinnen so, daß ich nicht nur 35 Minuten über die Inhalte und kurzfristigen Änderungen einer Unterrichtseinheit diskutiere und rede, sondern auch noch dazu komme, daß sich meine Schüler und Schülerinnen bewegen?
Und genau hier ist die Ausbildung im Sportstudium anzusetzen. Die praktische Ausbildung in den einzelnen Sportarten sollte meiner Meinung nach überdacht werden, denn hier wird der angehende Lehrer/die angehende Lehrerin auf den Weg gebracht, von dem die neuen Richtlinien runter wollen: stupides Erziehen zum Sport.
6 Literatur
BALZ, E.: Fachdidaktische Konzepte oder: Woran soll sich der Schulsport orientieren? In: Sportpädagogik 16 (1992) 2, 13 - 22.
BALZ, E. u.a.: Schulsport - wohin? Sportpädagogische Grundfragen. In: Sportpädagogik 1 (1997), 14 - 24.
CACHAY, K.: Sport in der Schule - wozu? In: Sportunterricht 3 (1999), 97.
FUNKE, J.: Unterricht öffnen - offener Unterricht. In: Sportpädagogik 15 (1991) 2, 12 - 18.
KURZ, D.: Wie offen soll und darf der Sportunterricht sein? In: BIELEFELDER SPORTPÄDAGOGEN: Methoden im Sportunterricht, Schorndorf 1989, 199 - 212.
LANDESINSTITUT FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG SOEST: Vorschläge zur Curriculumrevision im Schulsport in Nordrhein-Westfalen. Soest 1997.
www.learn-line.de: Neue Richtlinien für den Sport in der Grundschule.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des vorliegenden Dokuments zum Sportunterricht?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über den Sportunterricht, inklusive Definitionen, fachdidaktische Konzepte, die Idee des offenen Unterrichts und eine Diskussion über die Rolle des Sports in der Schule. Es enthält auch ein Inhaltsverzeichnis und ein Literaturverzeichnis.
Welche fachdidaktischen Konzepte werden im Dokument vorgestellt?
Das Dokument stellt vier fachdidaktische Konzepte vor: das Sportartenprogramm nach SÖLL, die Handlungsfähigkeit nach KURZ, die Körpererfahrung nach FUNKE und die Entpädagogisierung nach VOLKAMER.
Was versteht man unter dem Sportartenprogramm nach SÖLL?
Nach Söll besteht die Aufgabe des Schulsports darin, konditionelle und motorische Fähigkeiten auszubilden, damit sich die Schüler für den Sport außerhalb der Schule qualifizieren. Ziel ist die Anregung zu einem lebenslangen Sporttreiben.
Was bedeutet Handlungsfähigkeit nach KURZ im Kontext des Sportunterrichts?
Handlungsfähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, aus der Vielfalt der sportlichen Sinnbezüge (Leistung, Gesundheit, Geselligkeit, Spannung, Eindruck und Ausdruck) passende Formen zu finden und diese im Sporttreiben zu befriedigen. Es schließt auch kognitive und soziale Aspekte mit ein.
Was beinhaltet die Körpererfahrung nach FUNKE?
Die Körpererfahrung nach FUNKE betont die Bedeutung von Erfahrungen des Körpers und Erfahrungen mit dem Körper als Lerngelegenheiten. Der Sportunterricht soll zur Ausbildung einer individuell unverwechselbaren Bewegungsidentität beitragen.
Was ist die Entpädagogisierung nach VOLKAMER?
Die Entpädagogisierung kritisiert die Didaktisierung des Sportunterrichts und die Überlagerung des Sports durch pädagogische Zielorientierungen. Ziel ist es, den Schülern möglichst zwanglos die Herausforderung des Sports mit all seinen Reizen zu vermitteln.
Was ist offener Unterricht im Sport?
Offener Unterricht wird durch Impulse des Lehrers geleitet und ermöglicht den Schülern die Mitgestaltung des Unterrichts und der Inhalte. Ziel ist die Förderung eigenverantwortlicher und spontaner Handlungsfähigkeit.
Welche Argumente für einen offenen Sportunterricht werden im Dokument genannt?
Das Dokument führt Argumente von KURZ und FUNKE an, die die Vorteile des offenen Unterrichts in Bezug auf Planbarkeit, individuelle Lernwege, Selbstständigkeit und die Berücksichtigung individueller Bewegungsweisen hervorheben.
Was sind die Ziele des offenen Sportunterrichts?
Der offene Unterricht soll dazu beitragen, dass die Schüler mehr aus dem Sportunterricht mitnehmen als nur "sich bewegt zu haben". Er soll Spaß am Sport fördern, die Bereitschaft zur Ausprobieren neuer Sportarten erhöhen und die Möglichkeit bieten, persönliche Erfolge zu erzielen.
Welche Rolle spielen die neuen Richtlinien (2000) im Kontext des Sportunterrichts?
Die neuen Richtlinien bilden das Fundament für eine optimale Begründung des Unterrichtsfachs Sport in der Schule und betonen die Bedeutung von Wahrnehmungsfähigkeit, Bewegungserfahrungen, körperlichem Ausdruck, Risikobereitschaft, Leistungserfahrung, gemeinsamem Handeln und Gesundheitsbewusstsein.
Welche Methoden und Formen des selbständigen Arbeitens werden in den neuen Richtlinien propagiert?
Die neuen Richtlinien propagieren methodisch-strategisches Lernen, die Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen, exakte Beobachtung und Beschreibung von Bewegungshandlungen, die Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen, das Erproben und Experimentieren sowie sozial-kommunikatives Lernen, Arbeit in der Gruppe und die Übernahme von Leitungsaufgaben.
Wie wird die Bedeutung des Sports in der Schule begründet?
Die Bedeutung des Sports in der Schule wird durch seine erzieherischen Leistungen für Individuum und Gesellschaft begründet. Der Sportunterricht soll nicht nur zum Sporttreiben anregen, sondern auch gegenseitiges Miteinander, Interaktion, Selbstständigkeit, Verantwortung, Kreativität und Teamfähigkeit fördern.
- Quote paper
- Olaf Küster (Author), 1999, Offener Unterricht als mögliche Lösung ..., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97803