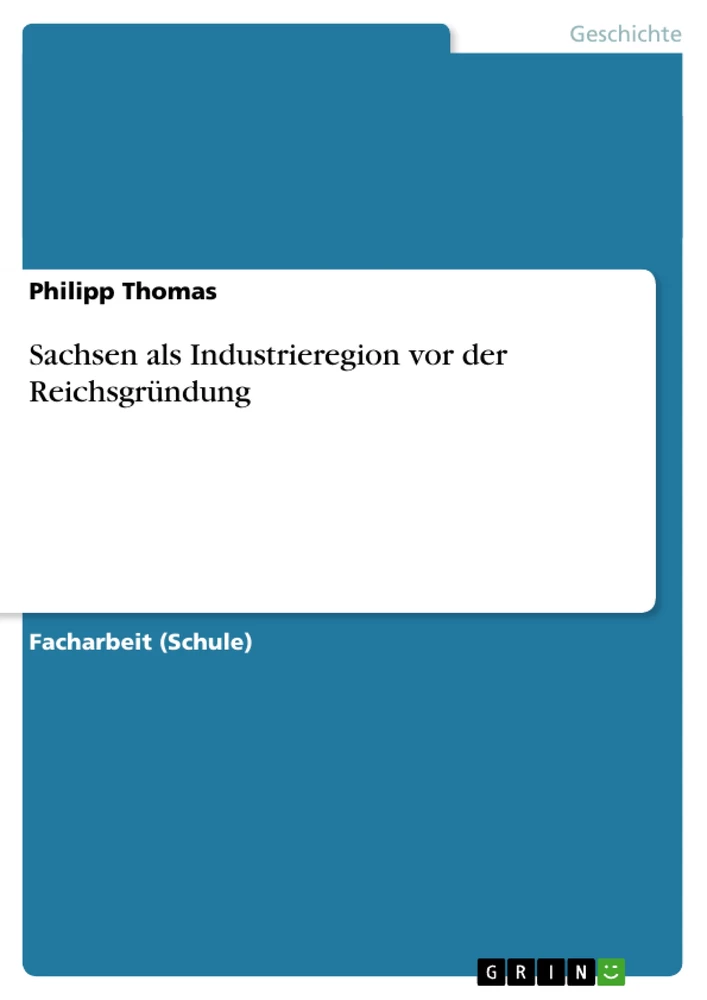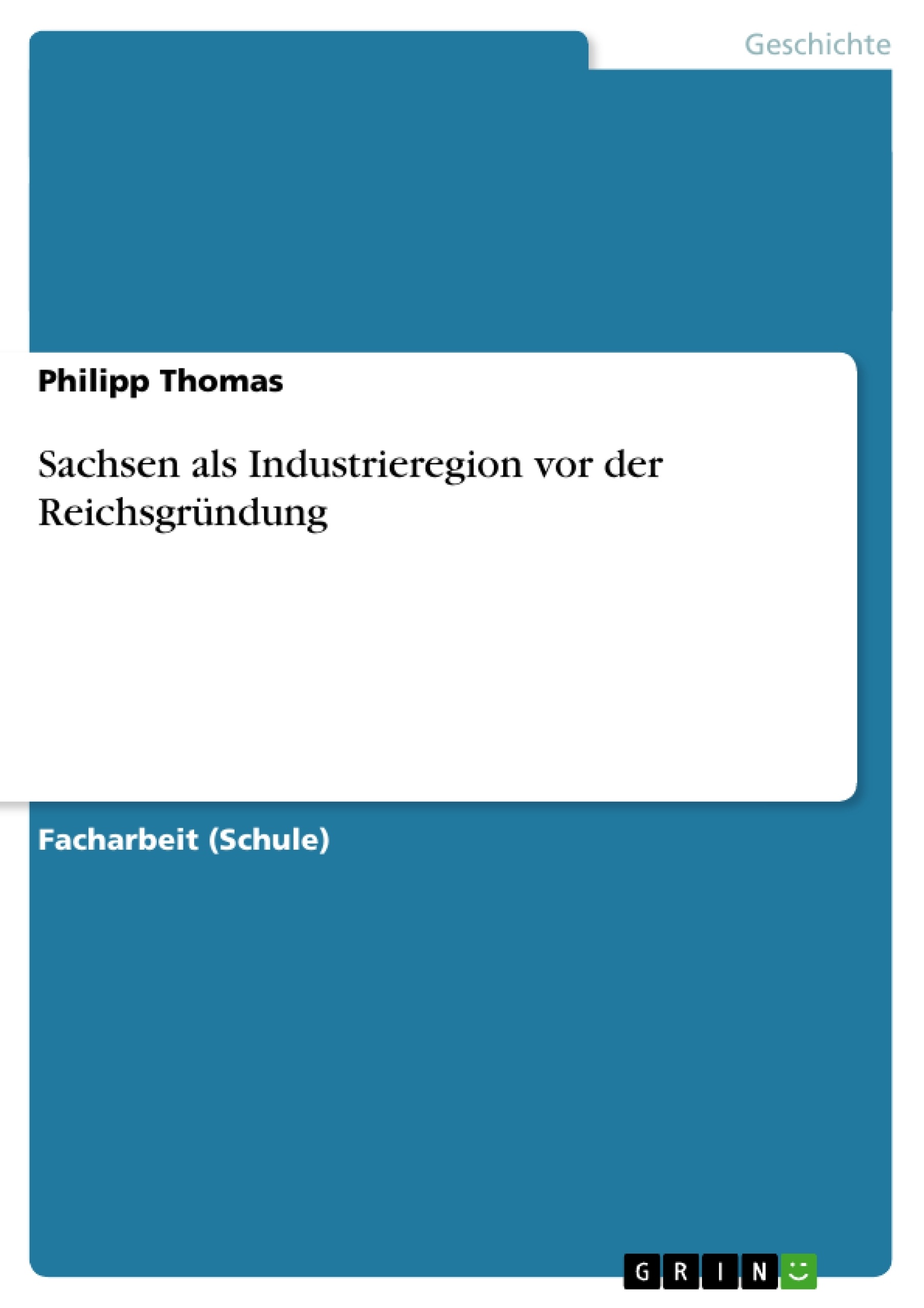Inhalt
1. Die industrielle Revolution in Sachsen
1.1. Allgemeines
1.2. Die Textil- und Baumwollindustrie
1.3. Einsatz der Dampfmaschine
1.4. Maschinenbau in Chemnitz und Leipzig
1.5. Die erste Lokomotive "Saxonia" und ihre Auswirkungen
1.6. Einfluss der Industriellen Revolution auf die Landwirtschaft
1.7. Die Großbourgeoisie und ihr Einfluss
1.8. Soziale Unsicherheit und Bevölkerungsentwicklung durch die Industrielle Revolution
2. Unternehmerportraits
2.1. Richard Hartmann
2.2. Gustav Harkort
3. Staatliche Wirtschaftspolitik
4.Bankwesen in Sachsen während der Industrialisierung
5.Quellen
1.1. Allgemeines
- langer weg bis zur völligen Industrialisierung
- erster bedeutender Schritt zur Industrialisierung war durchgängige Industrialisierung der Baumwollspinnerei
- Sachsen gewerblich hoch entwickelt aber relativ klein hart getroffen von
Industrialisierung, da sich nicht wie in England alles unter Nat.-Staat vollzog sondern unter staatl. Zersplitterung besonders bedeutsam, dass Sachsen zu den dt. Staaten gehörte, die den Deutschen Zollverein 1834 ins Leben riefen
1.2. Die Textil- und Baumwollindustrie
- durch Wegfall der Zollgrenzen wurde Sachsen's Textilindustrie ein großer innerdeutscher Markt geöffnet
- ( von 1834 - 37 stieg Zahl der Baumwollspinnereien von 91 130 von 1834 - 39 entstanden 102 neue Betriebe in der Wollspinnerei)
- Textilindustrie konnte Aufschwung nehmen, obwohl:
- Abhängigkeit von Rohstoffimporten
- Schwere zeitweilige Absatzkrisen und
- Härteste Konkurrenz durch England
- Aufschwung nur möglich durch billigst Löhne für Arbeiter
- 1846 etwa 60% der Baumwollspindeln des gesamten Zollvereins in Sachsen, aber meist kleine Spinnereien mit veralteter Technik
- bis 1848 kaum engl. Spinnmaschinen eingesetzt
- Baumwoll- und Wollweberei basierte Mitte des 19. Jhdts. Fast völlig auf Handarbeit in Verlag und Manufaktur
- Mech. Webstuhl fand gerade Eingang
- Neue Produktionsverfahren der Veredlung setzten sich durch (Bleichen, Färben, Drucken)
- Textilien aus Sachsen beherrschten Zollvereinsmarkt und fanden trotz engl. Markt auch Absatz in USA und Orient
- PROFIL DER SÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT EINDEUTIG DURCH TEXTILINDUSTRIE GEPRÄGT!
- Sachsen war in Mitte des 19. Jhdts. Zentrum der Textilindustrie
- 1846 waren in ihr ¾ der Arbeiter beschäftigt
- in den 60er Jahren setzte sich der mech. Webstuhl immer mehr durch (1861-3000; 1875-17000)
- in der Baumwollind. wuchs die Spindelzahl von 1846-1861 um ca. 50%
- dennoch liefen in Sachsen jetzt nur noch 1/3 aller Spindeln des Zollvereins, da viele Spinnereibesitzer vor der Anschaffung der teuren Selfaktor-Spinnmaschinen zurückschreckten, solange bei den extrem niedrigen Arbeitslöhnen noch genügend Profit gescheffelt wurde
- die niedr. Löhne waren Grund für das nur langsame Vordringen des mech. Webstuhls
1.3. Einsatz der Dampfmaschine
- Mechanisierung erhielt wesentliche Impulse durch Dampfmaschine ( von 1830 - 1846 stieg die Anzahl von 24 197 )
- billige Wasserkraftmaschinen überwogen bei weitem Dampfmaschine diente oft nur als
Reservekraftspender ( zu teuer )
- Durch Einsatz der Dampfmaschine Standortsverlagerungen der Fabriken von Tälern und Flüssen
Hinein in die Städte wegen großem Angebot an Arbeitskräften oder in die Nähe von Kohlerevieren
- nichts zeigt das Tempo der Ind. deutlicher, als das sprunghafte Anwachsen der Zahl der Dampfmaschinen (1861 mit mehr als 1000 5x so hoch wie 1846)
- Verlag und Manufaktur waren endgültig durch die Fabrik als dominierende Produktionsstätte überflügelt worden
- der zwickauer Bezirk mit dem "sächsischen Manchester" Chemnitz als Mittelpunkt war das größte Industrierevier und das industr. Herz Sachsens
- Leipzig und DD entwickelten sich durch die Ind. ihrer Vorstädte auch zu Industriezentren
1.4. Maschinenbau in Chemnitz und Leipzig
- als Anhängsel zur Textilind. entstanden
- begann sich mit vortschreitender Ind. als profilbestimmender Wirtschaftszweig für Sachsen zu entwickeln
- Chemnitz war Hochburg der Maschinenbauind.
- Chemnitzer Maschinenbau beschäftigte in 24 Fabriken rund 5000 Arbeiter
- Maschinenbaufabrik von Richard Hartmann, die Maschinenbau-Compagnie entwickelte sich zu leistungsfähigem Betrieb ( beshäftigte 1845 350 Arbeiter)
- Mehr als ¾ der in Sachsen gebauten Dampfmaschinen kamen aus 8 Chemnitzer Werkstätten
- Prof. Johann Andreas Schubert machte mit der von ihm geleiteten Maschinenbau
Aktiengesellschaft durch den Bau der 1. Lokomotive "Saxonia" auf sich aufmerksam
- Schwach entwickelt war jedoch die Rohstoffbasis für die Schwerindustr.
- Eisenförderung war sehr gering (3% der Zollvereinsstaaten) Hochofenförderung nur 1%
- Revolutionierende Veränderungen im Montanbereich ( Bergbau, Hüttenwesen) langsam durchgesetzt
- Erschließung des Zwickauer und Lugau-Oelsnitzer Steinkohlerevier erhöhte das Steinkohleaufkommen beträchtlich
- Bei Zwickau wurde das damals größte und modernste Hüttenwerk Sachsens, die Königin Marienhütte errichtet, das war nötig um die Schwerindustrie weiter voran zutreiben
- Sachsen erlangte im sich zunehmend spezialisierenden Maschinenbau eine starke Position (besonders Chemnitz)
- in L und DD siedelten sich ebenfalls Maschinenbaufabriken an
wie z.B.: landwirtschaftl. Maschinenfabrik von Rudolf Sack in Plagwitz und 1. Nähmaschinenfabr. von Clemens Müller
- Einen wichtigen Schritt leitete Johann Zimmermann in Chemnitz ein, als er begann Bohr-, Fräs- und Hobelmaschinen zu produzieren Mitbegründer des dt. Werkzeugmaschinenbaus
- Auf Weltausstellung 1862 in London zeigte sich, dass sächs. Werkzeugmaschinen mit den engl. Maschinen mithalten konnten und sie teilweise sogar übertrafen (Folie)
1.5. Die erste Lokomotive "Saxonia" und ihre Auswirkungen
- sächsische Wirtschaft verdankt ihren Aufschwung der führenden Rolle Sachsens im dt. Eisenbahnbau dessen Vorkämpfer Friedrich List war
- F.L. warb leidenschaftlich für Bau einer Eisenbahn von Lpzg. Nach DD als Grundlage für das dt.
Eisenbahnsystem (Friedrich List: Volkswirtschaftler und Politiker, Vorkämpfer des dt. Eisenbahnbaus und Propagandist des dt. Zollvereins )
- führende Vertreter der Lpzg. Handelsbourgeoisie, wie Wilhelm Seyfferth, Albert Dufour-Feronce
und Gustav Harkort griffen Projekt auf und begannen ohne nennenswerte Erfahrungen den Bau der 1. dt. Fernbahn
- 2 Jahre Planung, 3 Jahre Bauzeit (mit Brücke über Elbe bei Riesa und 1. Eisenbahntunnel bei Oberau)
- Schienen und Lokomotiven aus England importiert
- ERÖFFNUNG am 8. April 1839 (1840 Leipzig-Magdeburg, 1847 Leipzig-Nürnberg)
- Die 1. Lokomotive wurde durch den Maschinenbauunternehmer Prof. Johann Schubert gebaut
- "Saxonia" weihte Strecke nicht ein fuhr nur hinter engl. Loks hinterher
- Weitere Bahnbauten verbanden die L-DD Bahn mit: Bayern, Schlesien und Provinz Sachsens
- Man begann den erzgebirgischen Raum und Gewerbebereich südl. Oberlausitz an Eisenbahnnetz anzuschließen
- (Bau Schuberts der Göltschtalbrücke und Elstertalbrücke ) (Folie)
- Bedeutung der Eisenbahnstrecke L-DD sieht man daran, das die transportierten Güter fast um das 40-fache gestiegen sind
- Viele gewerbereiche Regionen wurden erst nach Anschluss an Eisenbahnstrecke von Ind. erfasst
- 1870 besaß Sachsen das dichteste Eisenbahnnetz D's (Folie)
1.6. Einfluss der Industriellen Revolution auf die Landwirtschaft
- In der Landwirtschaft brach sich, ausgelöst durch das Agrarreformgesetz von 1832, der Kapitalismus als unverzichtbarer Bestandteil der bürgerl. Umwälzung ebenfalls Bahn
- Ablösung der Bauern von den Feudallasten verlief keineswegs reibungslos (bis 1848 erst von 2/5 der Feudallasten losgakauft)
- rasch steigender Bedarf an landwirtschaftl. Produkten ( Bev.wachstum und hoher Industrialisierungsgrad)
- Bev.wachstum und hoher Industrialisierungsgrad regte zu höheren erträgen an rasch formierendes Vereinswesen entstand
- Theodor Reuning war Pionier der sächs. Landwirtschaft trug wesentl. Zur Propagierung der rationellen und intensiven Wirtschaftsweise bei -Getreide bis zur 2. Hälfte der 40er Jahre ver3facht -Kartoffeln bis zur 2. Hälfte der 40er Jahre ver4facht
- Erträge in Sachsen lagen weit über dt. Niveau
- Dennoch musste Sachsen viel Getreide importieren
- Missernten 45/46 und Weltwirtschaftskrise 47 trafen Sachsen besonders hart, da eng mit Weltmarkt verbundene und wenig kapitalkräftige Wirtschaft besonders krisenanfällig war und die Landwirtschaft konnte schon in normalen Zeiten die Bevölkerung nicht mit Brotgetreide versorgen
- Teuerung und Spekulationen trieben die Preise in die Höhe ( mehr als 100% )
- Hart traf es Weber und Strumpfwirker, besonders hart traf es jedoch die Arbeitslosen, denn ganze Erwerbszweige lagen wegen des Absatzmangels am Boden
- Analog zu vielen anderen dt. Staaten wurde die Ablösung der Feudallasten beendet
- Ende der 50er Jahre waren die Feudalverhältnisse beseitigt Bauern mussten mehr als 85 Mio. Mark zahlen daher gingen viele Bauernwirtschaften mit Verschuldung in kapitalist. Zukunft
- auf ¾ der landwirtschaftl. Grundfläche dominierten mittel- und großbäuerliche Betriebe bildete günstige Basis für intens., kapital., landwirtschaftl. Produktion, mit hohen Erträgen in Ackerbau und Viehzucht
- weitere steigende Erträge bei Getreide und Kartoffeln
- 1871 war Sachsen dem Reich um etwa 20 Jahre in den Produktionserträgen vorraus
1.7. Die Großbourgeoisie und ihr Einfluss
- Mitte des 19. Jhdts. war Sachsen der einzige dt. Staat, in dem mehr als die Hälfte von Gewerbe und Industrie lebte ( In Preußen erst knapp ¼ )
- da, sächsische Wirtschaft stark auf Export und Import angewiesen und Verlag und Manufaktur dominierten, besaß die Handelsbourgeoisie in Sachsen sehr starke Positionen
- Ihre Hochburg bildete Leipzig, das nach Beitritt Sachsens zum Dt. Zollverein seine Stellung als dt. Ost-West Handelszentrum festigte
- auf Grund guter geogr. Lagerascher Aufstieg zum dt. Binnenhandelszentrum
- Eingriffe der kapitalkräftigsten Großkaufleute Leipzigs auf die Industrialisierung durch:
große Kapitalien im Eisenbahnbau, Bank- und Versicherungswesen, dem erzgebirgischen Steinkohle- und Mansfelder Kupferbergbau, der Eisenverhüttung, Maschinenbau und andere Unternehmen z.B.: Harkort
- Lpzg. Großkaufleute bemühten sich um den Bau des Suezkanals für Handelsweg nach China und
Orient
- Leipziger Großbourgeoisie trat für Freihandel ein und nutzten ihre Beziehungen zu Adelskreisen und
Staatsbürokratie, um die Regierungspolitik in diesem Sinne zu beeinflussen
- aufstrebende Industriebourgeoisie erlangte im Verlauf der Industrialisierung ein zunehmendes Gewicht
- aber noch immer brachte die Lpzg. Handels- und Bankbourgeoisie die gleiche
Steuersumme auf wie alle Fabriken, Banken und Kohlewerke Sachsens zusammen
- Im Gegensatz zur Freihandelspolitik wollten die Fabrikanten, besonders
Spinnereibesitzer die überlegene ausländ. Konkurrenz durch Schutzzölle abwehren und traten immer nachdrücklicher mit wirtschaftspol. Forderungen hervor
- in keinem anderen dt. Staat war innerhalb der Bourgeoisie die wirtschaftspol. Rivalität so ausgeprägt
1.8. Soziale Unsicherheit und Bevölkerungsentwicklung durch die Industrielle Revolution
- für städtisches Handwerk brachte die Indurev soziale Unsicherheit
- obwohl die Zünfte in den Städten bis 1861 fortbestanden, konnten sie den zunehmenden Einfluss des Kapitals auf das Handwerk nicht mehr aufhalten
- wegen der Niedrigpreise ihrer Fertigwaren stürzten die Verleger, Manufakturisten und Händler die Kleinmeister und deren Gesellen in finanziellen Ruin
- besonders im Textilgewerbe aber auch Schneider, Schuhmacher und Tischler
- viele Handwerksmeister sanken mit der Zeit ins Proletariat ab
- nur Bau- und Nahrungsmittelwesen profitierten vom ökonomischen Aufschwung
- der ersehnte Aufstieg zum Fabrikanten gelang nur wenigen Handwerkern
- die Masse der Gesellen führte bereits ein proletarisches Dasein unter oft unerträglichen Lebens- und Arbeitsverhältnissen
- in vielen industriellen Zentren gingen viele Handwerksgesellen ab in die Fabriken
- die Gesellen-Lohnarbeiter bildeten Mitte des 19. Jhdts. neben anderen Arbeitern einen beträchtlichen Teil der Arbeiterklasse
- für die Massenproduktion waren Kinder und Frauen gesuchte Arbeitskräfte
- sie waren billig, fingerfertig, galten als anstellig und waren weniger schwierig als ausgebildete männl. Facharbeiter Frauen- und Kinderarbeit war in der Textilindustrie weit verbreitet
- In den sächs. Spinnereien stellten 1840 Frauen (36%) und Kinder (24%) die Mehrheit der Arbeiter
- Löhne der Textilarbeiter z.B. in Chemnitz lagen weit unter dem Existenzminimum, da die Unternehmer unter dem Druck der überlegenen engl. Konkurrenz nur so Profit scheffeln konnten
- In Chemnitz verdiente ein Arbeiter z.B. 2 Taler und 18-20 Neugroschen, dass war 60% des Existenzminimums eines ledigen Berliner Arbeiters Arbeiterbewegungen entstanden
- neu entstehende Klasse meldete eigene Ziele an ( angedeutet durch Maschinenstürme und Streiks )
- besonders Eisenbahnarbeiter
- streikten geg. Lohndiktat der Bauunternehmer und Schikanen der Aufseher
- 1. Höhepunkt 3. Juli (7.) 1845 - Lohnstreik von etwa 900 Arbeitern in Riesa wurden auf Baustellen zu fast alltägl. Bild
- die Indurev rief umwälzende Veränderungen in der Bev. Struktur hervor ( von 1843- 1871 stieg die Einwohnerzahl um 1 Mio. auf 2,5 Mio.)
- 4/5 durch Geburtenüberschuss, der Rest durch Einwanderer
- größte Bev.dichte in D mit 171 Einwohnern pro m², dass übertraf England und Belgien
2. Unternehmerportraits
2.1. Richard Hartmann (Folie)
- 1809 im Elsaß geb.
- kein Erfinder nur Unternehmer
- nach seiner Schulzeit machte er Lehre zum Zeugschmied
- 1832 Wanderschaft, gelangte nach Chemnitz
- arbeitete Anfangs in der berühmten Maschinenbauwerkstätte von C.G. Haubold
- bewies dabei sein techn. Talent
- fertigte Werkzeuge und kleine Maschinen an, ohne theoret. Ausbildung zu besitzen
- später Lokomotivbaustudium bei Stephenson in England
- 1837 gründet Werkstatt zur Reperatur von Spinnereimaschinen
- 1839 neuer Partner, den Kaufmann August Götze
- Beginn der Produktion von Florteilen, Dampfmaschinen (1840), und Werkzeugmaschinen (Folie)
- 1842 Alleinunternehmer
- bereitet seit 1845 den Lokomotivbau vor
- stand vor Problem der Finanzierung, hatte Beziehungen zu einflussreichen Persönlichkeiten Staat stellte ihm 30000 Taler als Kredit zur Verfügung
- kaufte in England notwendige Arbeitsmaschinen ein
- produziert ab 1848 Lokomotiven 1. Lokom. 7.Februar 1848 "Glückauf" (Folie)
- sächs. Staatseisenbahn war Hauptabnehmer der Hartmannschen Lokomotiven
- Hartmann baute 87 Straßenwalzen und Lokomobile und 4611 Lokomotiven
2.2. Gustav Harkort
- 1795 in Harkorten geboren
- stammt aus traditionsreicher westfälischer Unternehmerdynastie
- jüngerer Bruder Friedrichs
- förderte Eisenbahnbau und Schiffverkehr in westl. Gebieten D's
- ging nach Lpzg. wurde Direktor der L-DD Eisenbahngesellschaft
- besaß englische Garnhandlung mit angeschlossenem Bankgeschäft
- seit 1846 war er Mitinhaber des Handelshauses Carlowitz, Harkort & Co in China
- gründete einige Unternehmen
- blieb bei Gründung von Unternehmen vielseitig
- Mitbegründer bei : 1838 Lpzg. Bank,1842 Maschinenwerkstatt und Eißengießerei in L., 1856 Allgemeine Dt. Credit-Anstalt,
- errichtete in L. Fabrik zur Herstellung von Galvanoplastik und Tonwaren
- Beeinflußte den Zwickauer Kohlenbergbau durch Finanzierung des Erzgebirgischen Steinkohlen-Aktienvereins
- unterstützte die Leipziger Künste (Kunstvereine, Museen)
- starb in L. 1865
3. Staatlich Wirtschaftspolitik
- besonders auf gewerbl. Sektor schuf die Regierung im Interesse der Erhaltung ihrer Macht freiere Spielräume für die kapital. Entwicklung
- Konzession ( Erlaubnis ) für Gründung von Fabriken wurde großzügiger erteilt, Zunftregeln wurden immer mehr gelockert
- Um 1850 passte die Regierung das Bankwesen an die kapit. Erfordernisse an
- 1856 erteilte sie die Konzession zur Gründung der Allg. Deutschen Credit-Anstalt (ADCA) in L. gehörte zu den ersten dt. Aktienbanken, die sich der Finanzierung kapital. Unternehmen widmete
- 15. Okt. 1861 Gewerbefreiheitseinführung Zünfte verloren alle Privilegien und Monopolrechte
- Eisenbahnstrecke DD-Z ist völlig befahrbar STAAT finanziert Eisenbahnbau jetzt selbst (1854 Länge Eisenbahnnetz: 520km - 1873: 1227 km)
- 1862 stimmt S. als 1. dt. Staat im Interesse seiner Industrie dem von Preußen im Namen des Dt. Zollvereins abgeschlossenen Freihandelsvertrag mit Fr. zu erschloss so seiner Industrie einen neuen bedeutenden Absatzmarkt damit wurde die Annahme des umstrittenen Vertrages eingeleitet, der den Anschluss Österreichs an den Zollverein endgültig verhinderte und den Kampf um die wirtschaftspolit. Hegemonie in D zu Gunsten Preußens entschied
- 1864 verlängert Sachsen als 1. Dt. Staat den Dt. Zollvereinsvertrag
- 1865 gründet Regierung eine Staatsbank die Sächsische Bank in DD, die mit 7 Filialen das ganze Land erfasste
4. Bankwesen in Sachsen während der Industrialisierung
- Aufgabe der Banken: Geldaufbewahrung, bargeldlose Überweisungen, Kreditvermittlungen und Finanzierung
- In D sind die Banken nicht nur im Kredit- und Einlagewesen tätig, auch im Wertpapierhandel
- historisch haben sich 3 Gruppen von Banken herausgebildet: 1. Private
Geschäftsbanken; 2. Öffentlich rechtliche Sparkassen; 3. Genossenschaftliche Volksund Raiffeisenbanken
- den Geschäftsbanken steht die Deutsche Bundesbank ( Sächsische Bank ) als Zentralbegriff gegenüber
- Kreditbanken: Kreditbanken sammeln Gelder (werden nicht verbraucht) leiten diese als Kredite weiter Unternehmen nutzen diese Kredite produktiv, so dass das Kreditwesen ein wichtiges Instrument der Wirtschaftspolitik ist
- Kreditpolitik der Notenbanken bewirkt eine mehr oder weniger große Geldschöpfung beeinflusst somit den Geldumlauf
- Aktiengesellschaften: ist Kapitalgesellschaft deren Aktionäre am Unternehmen beteiligt sind
- Wirtschaftliche Bedeutung der Aktiengesellschaften: großes Grundkapital, da viele Anleger größere wirtschaftl. Aufgaben können verwirklicht werden
- AG ist typische Form des Großunternehmens vorallem in Industrie, Banken und Versicherungen
DIE INDUSTRIALISIERUNG WÄRE NICHT VON STATTEN GEGANGEN,
WENN DIE BANKEN KEIN GELD AN DIE AKTIONÄRE GEGEBEN HÄTTEN. DIE AKTIONÄRE HATTEN ZWAR DIE IDEE, ABER NICHT DIE MITTEL DAZU, EINE INDUSTRIALISIERUNG AUF DIE BEINE ZU STELLEN
- 1838 Gründung der Lpzg. Bank 1. sächs. Notenbank auf Aktienbasis Beherrschung des sächs. Geldmarktes der Lpzg. Bourgeoisie noch fester
- um 1850 passt die Regierung zögernd das Bankwesen an die kapit. Erfordernisse an
- 1856 erteielte sie die Konzession zur Gründung der Allg. Dt. Credit-Anstalt
- 1865 gründete Regierung eine Staatsbank - die Sächs. Bank in DD
5. Quellen
- Geschichte Sachsens - Herausgegeben von Karl Czok; Verlag: Hermann Böhlhaus Nachfolger,Weimar 1989
- Günter Naumann - Sächsische Geschichte in Daten; Verlag: Koehler & Amelang, 1991, 1. Auflage
- Helmut M. Müller - Schlaglichter der deutschen Geschichte; Verlag: Bundeszentrale für politische Bildung, 1996; 3. überarbeitete und erweiterte Auflage
- Rudolf Forberger - Die Industrielle Revolution in Sachsen 1800-1861; Verlag: Akademie-Verlag Berlin DDR, 1982; Band 1, 1. und 2. Halbband
- Produktivkräfte in Deutschland 1800 bis 1870; Verlag: Akademie-Verlag Berlin DDR, 1990; Band 1
- Microsoft Encarta 1999
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Inhalt"?
Der Text behandelt die industrielle Revolution in Sachsen, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Textilindustrie, Maschinenbau, Eisenbahnbau und den Auswirkungen auf Landwirtschaft, Bevölkerung und soziale Strukturen liegt. Außerdem werden Unternehmerportraits und die staatliche Wirtschaftspolitik betrachtet.
Welche Rolle spielte die Textilindustrie in Sachsen während der Industrialisierung?
Die Textil- und Baumwollindustrie war ein entscheidender Faktor für die Industrialisierung Sachsens. Sie profitierte vom Wegfall der Zollgrenzen durch den Deutschen Zollverein, war jedoch abhängig von Rohstoffimporten und harter Konkurrenz aus England. Billige Löhne ermöglichten den Aufschwung, und Sachsen beherbergte 1846 etwa 60% der Baumwollspindeln des gesamten Zollvereins. Die Textilindustrie prägte das Profil der sächsischen Wirtschaft maßgeblich.
Wie wirkte sich der Einsatz der Dampfmaschine auf die Industrie in Sachsen aus?
Die Dampfmaschine gab der Mechanisierung wichtige Impulse. Obwohl billige Wasserkraft zunächst überwog, ermöglichte die Dampfmaschine die Verlagerung von Fabriken aus Tälern und Flussgebieten in Städte mit einem größeren Angebot an Arbeitskräften oder in die Nähe von Kohlerevieren. Das sprunghafte Anwachsen der Zahl der Dampfmaschinen verdeutlichte das Tempo der Industrialisierung.
Welche Bedeutung hatte Chemnitz für den Maschinenbau in Sachsen?
Chemnitz entwickelte sich zur Hochburg des Maschinenbaus in Sachsen. Die Chemnitzer Maschinenbauindustrie beschäftigte rund 5000 Arbeiter in 24 Fabriken. Die Maschinenbaufabrik von Richard Hartmann entwickelte sich zu einem leistungsfähigen Betrieb. Mehr als ¾ der in Sachsen gebauten Dampfmaschinen stammten aus Chemnitzer Werkstätten. Johann Andreas Schubert machte mit dem Bau der ersten Lokomotive "Saxonia" auf sich aufmerksam.
Wie trug der Bau der ersten Lokomotive "Saxonia" zur Industrialisierung Sachsens bei?
Der sächsische Eisenbahnbau, dessen Vorkämpfer Friedrich List war, trug wesentlich zum Aufschwung der sächsischen Wirtschaft bei. Die erste deutsche Fernbahn von Leipzig nach Dresden wurde eröffnet und verband später Bayern, Schlesien und die Provinz Sachsen. Viele gewerbereiche Regionen wurden erst durch den Anschluss an das Eisenbahnnetz von der Industrialisierung erfasst.
Wie veränderte sich die Landwirtschaft in Sachsen durch die Industrielle Revolution?
Die Landwirtschaft erlebte durch das Agrarreformgesetz von 1832 den Kapitalismus. Die Ablösung der Bauern von Feudallasten verlief nicht reibungslos. Der steigende Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten aufgrund von Bevölkerungswachstum und Industrialisierung regte zu höheren Erträgen an. Sachsen musste dennoch viel Getreide importieren. Nach der Beseitigung der Feudalverhältnisse dominierten mittel- und großbäuerliche Betriebe, was zu hohen Erträgen in Ackerbau und Viehzucht führte.
Welchen Einfluss hatte die Großbourgeoisie auf die Industrialisierung in Sachsen?
Da die sächsische Wirtschaft stark auf Export und Import angewiesen war, hatte die Handelsbourgeoisie in Sachsen eine sehr starke Position. Ihre Hochburg war Leipzig, das seine Stellung als deutsches Ost-West-Handelszentrum festigte. Leipziger Großkaufleute investierten in Eisenbahnbau, Bank- und Versicherungswesen, Steinkohlebergbau und Maschinenbau. Die aufstrebende Industriebourgeoisie gewann im Verlauf der Industrialisierung an Bedeutung.
Welche sozialen Auswirkungen hatte die Industrielle Revolution in Sachsen?
Die Industrielle Revolution brachte soziale Unsicherheit für das städtische Handwerk mit sich. Verleger, Manufakturisten und Händler ruinierten Kleinmeister und deren Gesellen durch niedrige Preise. Kinder- und Frauenarbeit war in der Textilindustrie weit verbreitet. Löhne lagen oft unter dem Existenzminimum. Es entstanden Arbeiterbewegungen, und Streiks wurden häufiger. Die Einwohnerzahl stieg durch Geburtenüberschuss und Einwanderung, was zu einer hohen Bevölkerungsdichte führte.
Wer waren Richard Hartmann und Gustav Harkort und welche Rolle spielten sie in der sächsischen Industrialisierung?
Richard Hartmann war ein bedeutender Maschinenbauunternehmer, der Lokomotiven produzierte und die sächsische Staatseisenbahn belieferte. Gustav Harkort, aus einer westfälischen Unternehmerdynastie stammend, förderte den Eisenbahnbau und war an der Gründung verschiedener Unternehmen in Leipzig beteiligt, darunter Banken und Maschinenwerkstätten.
Wie gestaltete sich die staatliche Wirtschaftspolitik in Sachsen während der Industrialisierung?
Die Regierung schuf im Interesse der Machterhaltung freiere Spielräume für die kapitalistische Entwicklung. Die Konzessionsvergabe für Fabrikgründungen wurde großzügiger gehandhabt, Zunftregeln gelockert und das Bankwesen an die kapitalistischen Erfordernisse angepasst. Die Gewerbefreiheit wurde eingeführt und der Eisenbahnbau gefördert. Sachsen schloss Freihandelsverträge ab und gründete eine Staatsbank.
Welche Bedeutung hatte das Bankwesen für die Industrialisierung in Sachsen?
Banken spielten eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung der Industrialisierung durch Geldaufbewahrung, bargeldlose Überweisungen, Kreditvermittlungen und Finanzierung. Kreditbanken sammelten Gelder und leiteten diese als Kredite weiter. Die Gründung der Leipziger Bank und der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt förderte die Kapitalbildung und Investitionen in Unternehmen.
- Quote paper
- Philipp Thomas (Author), 2000, Sachsen als Industrieregion vor der Reichsgründung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97755