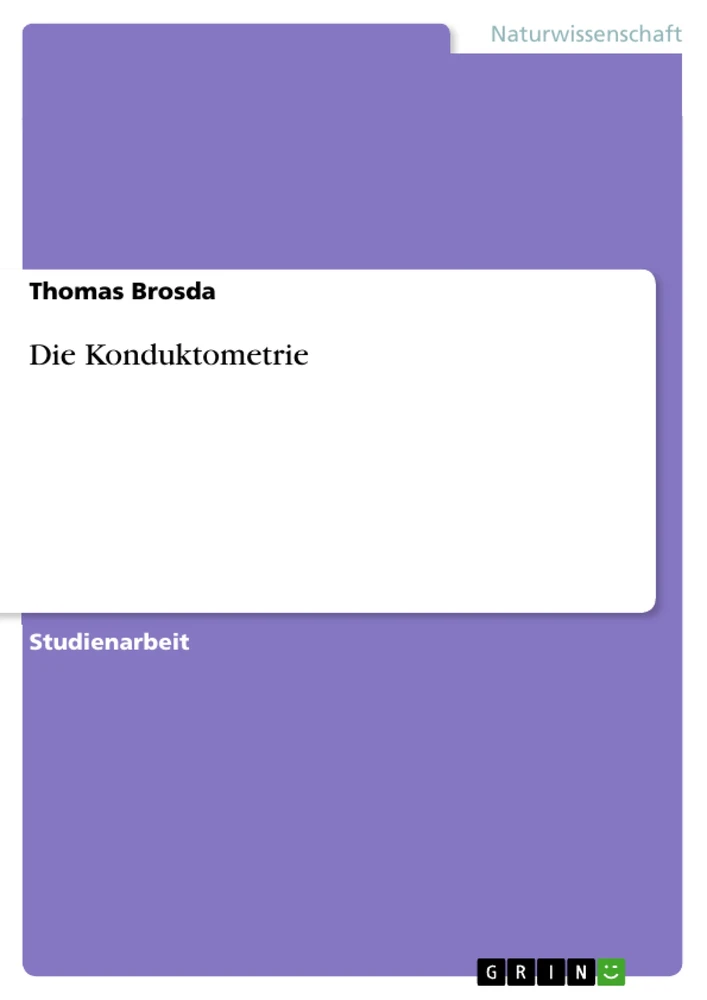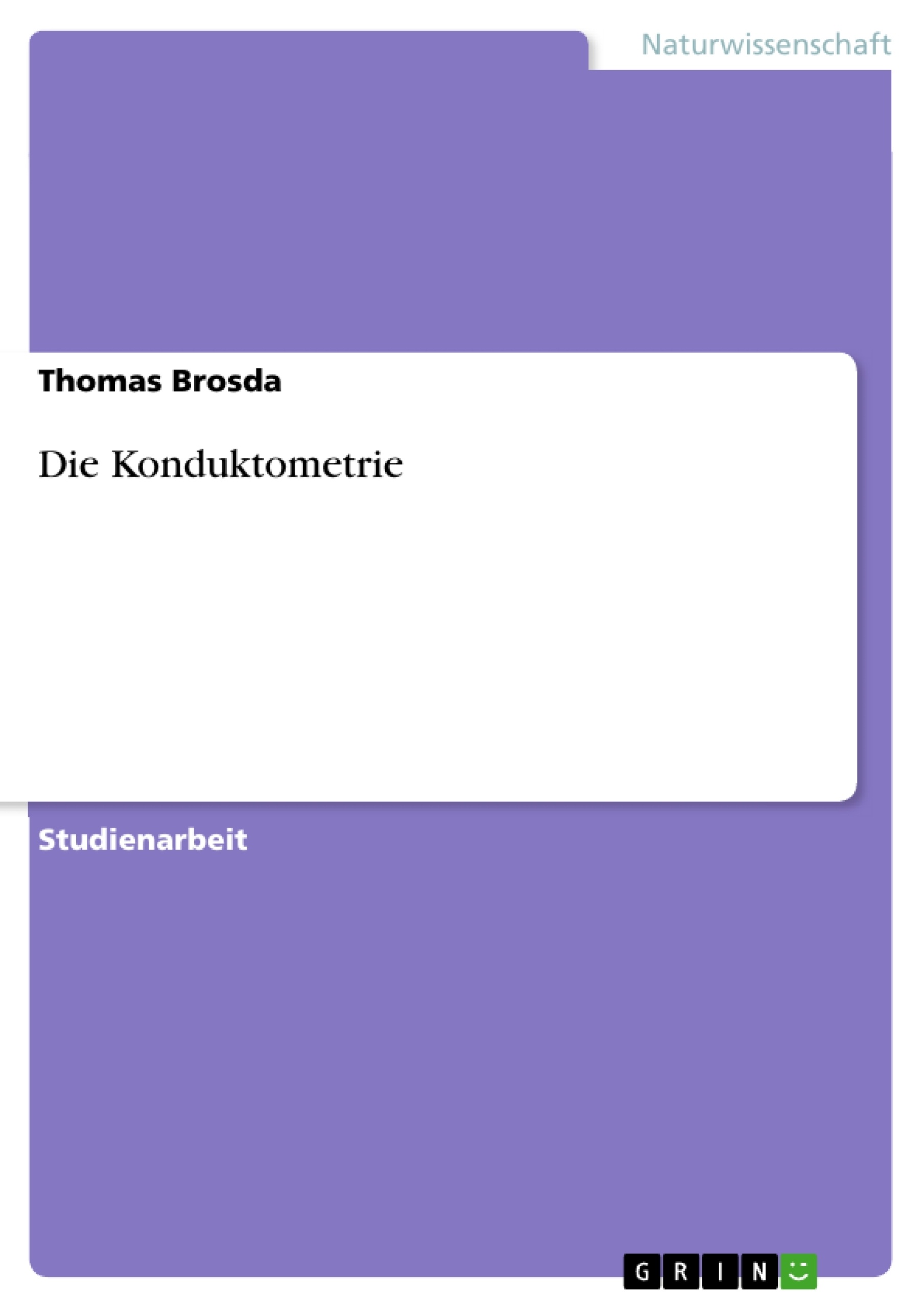Konduktometrie ist die Sammelbezeichnung für analytische Methoden, die zur Verfolgung von Reaktionsabläufen in Lösungen die elektrische Leitfähigkeit messen. Diese ist von der Konzentration der vorhandenen freien Elektronen abhängig. Zum Messen der Leitfähigkeit werden spezielle Gefäße benutzt, diese werden unter Punkt 4 genauer beschrieben.
Thomas Brosda
Die Konduktometrie
1. Allgemeine Grundlagen der Titrimetrie:
Bei derTitrimetriemißt man das Volumen einer Reagenslösung bekannter Konzentration, diese bezeichnet man dann alsMaßlösung. Nun wird derAnalyselösung(Probelösung) nur soviel der Maßlösung hinzugefügt wie zur chemischen Umsetzung des zu bestimmenden Stoffes nötig ist. Der Punkt an dem die Umsetzung vollendet ist wird alsÄquivalenzpunkt(Endpunkt) bezeichnet. Aus dem zugesetzten Volumen der Maßlösung und ihrer Konzentration kann man dann bei Kenntnis des Reaktionsablaufs die Masse der Analyselösung bestimmen.
Diesen gesamten Vorgang nennt man dannTitration.Es gibt bei der Titrimetrie mehrere Verfahren (chemischer und physikalischer Natur) der Endpunktbestimmung, es muß nur gewährleistet sein, dass die Reaktion eindeutig abläuft, dass es möglich ist eine Reagenslösung mit genauer Konzentration herzustellen und dass der Endpunkt zumindest annähernd genau bestimmt werden kann.
2. Konduktometrie:
Konduktometrie ist die Sammelbezeichnung für analytische Methoden, die zur Verfolgung von Reaktionsabläufen in Lösungen die elektrische Leitfähigkeit messen. Diese ist von der Konzentration der vorhandenen freien Elektronen abhängig. Zum messen der Leitfähigkeit werden spezielle Gefäße benutzt, diese werden unter Punkt 4 genauer beschrieben.
3. Einleitung zur konduktometrischen Titration:
Die konduktometrische Titration oder Leitfähigkeitstitration ist eine Maßanalyse mit physikalischer Endpunktbestimmung. Man betrachtet die Leitfähigkeit einer Lösung die durch titrieren einer Maßlösung entsteht. Diese Leitfähigkeit (_) wird in ein Koordinatensystem (in Abhängigkeit des Volumens [V] der Maßlösung) eingetragen. Diese Art der Titration ist besonders wirkungsvoll wenn sehr starke Elektrolyte an ihr teilnehmen, und wenig Ionen in er Lösung enthalten sind die sich nicht an der Reaktion beteiligen, so dass die Messung der Leitfähigkeit nicht verfälscht werden kann. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind ist die konduktometrische Titration als Endpunktbestimmung zu bevorzugen, da man den Äquivalenzpunkt direkt aus dem Koordinatensystem ablesen kann.
3. Allgemeine Grundlagen der konduktometrischen Titration:
Die Leitfähigkeit kann gemessen werden, da Säuren, Basen und Salze sich in wässrigen Lösungen lösen und dabei in Ionen zerfallen (elektrolytische Spaltung).
Nun wandern die Ionen in dem elektrischen Feld (die Kationen zur Katode [negativ], die Anionen zur Anode [positiv] ) und transportieren immer die selbe Elektrizitätsmenge (laut dem Faradayschen Gesetz pro Mol Äquivalentteilchen 96494 Coulomb).So ist die Leitfähigkeit abhängig von der Temperatur, der Bewegung der Ionen, der Anzahl der Ionen, der Menge der transportierten Elementarladungen der Ionen und der Polarität des Lösungsmittels. Trotz der Abhängigkeit von der Temperatur ist diese nur in Ausnahmefällen während der Titrationen zu beachten, da diese meist zeitlich auf wenige Minuten begrenzt sind.
4. Geeignete Titriergefäße:
Für die Leitfähigkeitsmessung eignen sich nicht alle Gefäße zur Aufnahme der Probelösung. Normalerweise wird ein Glasgefäß mit platinierter Platinelektrode (die Platinerung der Elektroden bewirkt eine Oberflächenvergrößerung und verhindert eine bei der Messung störende Polarisierung) verwendet. Ob man nun ein Titrationsgefäß mit fest installierten Elektroden verwendet oder eine Tauchmeßzelle in ein normales Becherglas taucht bleibt einem selbst überlassen, es muß nur eine geeignete Rührmöglichkeit vorhanden sein. Die Maßlösung gibt man durch eine Bürette oder Kolbenbürette zu. Umso schlechter die Lösung leitet umso größer sollten die Elektroden und umso kleiner soll ihr Abstand sein. Der Widerstand des Gefäßes sollte auch gut Meßbar sein, also sollte er nicht weniger als 30 und nicht mehr als einige tausend Ohm betragen. Der Widerstand ist die Widerstandskapazität (Z). Sie [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Z entspricht dem Widerstand den das Gefäß besäße wenn es mit einer Flüssigkeit der Leitfähigkeit 1 gefüllt wäre. Z heißt auch Zellkonstante. Um jene nicht zu verändern sollten die Elektroden tief genug in der Flüssigkeit sein, außerdem sollte man die Menge der Maßlösung gering halten. Jander und Jahr empfehlen auf 50ml Lösung nur 5ml Maßlösung. Darum ist es angebracht kleinere Büretten zu verwenden (Skala Einteilung in
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tauchmeßzelle & Leitfähigkeitsmeßgefäß
5. Verfahren der Leitfähigkeitsmessung:
Man muß um die Leitfähigkeit einer Lösung zu bestimmen, erst die Widerstandskapazität des Titriergefäßes errechnen. Da [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]ist muß man erst
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
den Widerstand des Meßgefäßes (R) messen. Dieses geschieht, bei Erwartung von besonders genauen Ergebnissen, mit der Wheatstoneschen Brückenschaltung. Bei dieser liegt die Spannung U an den Punkten A und B an der Meßbrücke an. Diese wird von den vier
Widerständen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]gebildet. Hierbei ist [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]der zu messende und [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]ein zu regelnder Widerstand. Der Stromkreis ist in die beiden Zweige ACB und ADB unterteilt, was bewirkt, das die gesamte Spannung sowohl an den Widerständen als auch an vollständig abfällt. Wenn man jetzt [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]so abstimmt, dass die beiden Punkte C und D das gleiche Potential besitzen (keine Spannungsdifferenz) gilt: [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], also [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] (nach den Kirchhoffschen Gesetzen). Die Spannung zwischen C und D wird nach der verstärkung durch einen Wechselstromverstärker V durch ein Galvanometer G gemessen. Also zeigt G keine Spannung wenn [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]richtig eingestellt ist (Nullindikation). Nun kann man nach ablesen von [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]den [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] mit der genannten Gleichung berechnen. Als Fehlerquelle bei sehr genauen Messungen muß der kapazitive Widerstand, der aufgrund des Wechselstromes an der Meßzelle auftritt, gesehen werden. Aber diesen kann man durch einen regelbaren Kondensator C, der parallel zu [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]geschaltet ist, kompensieren. Dann muß auch noch C so eingestellt werden, dass an G keine Spannung anliegt. Früher benutzte man anstatt eines Verstärkers und des Galvanometers einen Kopfhörer der auf ein Tonminimum eingestellt war, allerdings war diese Methode zu anstrengend, so das man nun die andere benutzt. Wenn man jetzt den Widerstand R gemessen hat, muß man Z mit einer Elektrolytlösung, deren Leitfähigkeit bekannt ist, errechnen. Nun kann man die Leitfähigkeit (_) der zu bestimmenden Lösung erfahren, indem man R neu mit Hilfe der oben erwähnten Methode misst und nun, da Z und R bekannt sind, _ nach der Gleichung [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]bestimmen. Das eben vorgestellte Verfahren ist sehr genau, aber auch sehr auf wendig. Heutzutage verwendet man bei konduktometrischen Analysen meist ein Verfahren das die Leitfähigkeit direkt anzeigt, da es bei der konduktometrischen Titration nur auf relative Meßwerte ankommt.
Bei diesem Verfahren fällt die Wechselspannung U an den Widerständen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]und R ab. Die Spannung die an R abfällt steuert einen Verstärker der auch die Spannung misst, ohne das Strom fließt (hochohmig) und regelt dadurch die Stromstärke I die in einem mit Gleichspannung betriebenen sekundär Kreis. So ändert sich mit dem Widerstand der Meßzelle auch die Stromstärke I. Die Signale die gemessen werden sind proportional zur Leitfähigkeit in der Zelle und können zum zeichnen der Titrationskurve direkt verwendet werden.
Vorteilhaft bei diesem Verfahren ist, dass man nicht nach jeder Zugabe der Maßlösung an eine Meßbrücke angeglichen werden muß. Sondern, dass die Leitfähigkeit (eigentlich ein Proportionales) sofort abzulesen ist. Die Genauigkeit der Messung hängt allerdings von der Genauigkeit des Verstärkers in den verschiedenen Meßbereichen ab.
6. Die Praktische Anwendung:
6.1 Säure - Base Titrationen:
Säure - Base Titrationen sind Neutralisationsvorgänge, diese beruhen darauf das die schnell wandernden Ionen durch langsamere Ionen ersetzt werden, oder das sich die Anzahl der Ionen verändert. Daher kann man Neutralisationsreaktionen besonders gut an Titrationen von starken Säuren und Basen konduktometrisch verfolgen, da die sich schnell bewegenden [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] - bzw. [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]- Ionen durch langsamer wandernde Kationen oder Anionen des entstehenden Salzes ersetzt werden. In einem solchen Fall erhält man ein Diagramm der Leitfähigkeit bei dem man den Äquivalenzpunkt sehr genau ablesen kann, da die Leitfähigkeit sinkt je mehr Base man zufügt, da ein Austausch der schnellen mit langsamen Ionen statt findet. Wenn man nun den Endpunkt erreicht hat steigt die Leitfähigkeit wieder, da der Überschuß der schnellen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] - Ionen nicht mehr umgewandelt werden kann. Nicht ganz so eindeutig läuft die Reaktion bei Titrationen schwacher Säuren oder Basen ab. Titriert man z.B. NaOH mit Essigsäure fällt die Leitfähigkeit auch steil ab da die [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]- Ionen durch langsame Acetationen ersetzt werden, doch nach erreichen des Endpunktes ändert sie sich fast gar nicht mehr, denn die Dissoziation der überschüssigen Essigsäure wird durch das vorhandene Acetat zurück gedrängt. Die Leitfähigkeitskurve wird komplizierter wenn man nun umgekehrt Essigsäure mit NaOH titriert. Zu Beginn nimmt die Leitfähigkeit ab, da das entstehende Salz die Dissoziation der noch vorhandenen Essigsäure zurückdrängt. Bald überwiegt aber die Salzkonzentration, so dass die Kurve durch ein Minimum geht. Dieses hängt aber von der Konzentration der Säure ab. Ein starker Knick entsteht wieder bei dem Neutralisationspunkt, der durch den Überfluß von NaOH hervorgerufen wird.
Daher läßt sich die konduktometrische Titration am vorteilhaftesten mit starken Säuren und Basen durch führen. Bei so genanten Verdrängungsvorgängen kann durch die Leitfähigkeitstitration sogar in Lösungen von Salzen schwacher Basen in starken Säuren durch Titration starker Basen die gebundene Base bestimmen. Und genauso andersherum in Lösungen von Salzen schwacher Säuren in starken Basen durch Titration starker Säuren die gebundene Säure.
6.2 Fällungstitrationen:
Die konduktometrische Variante der Fällungsanalyse ist sehr wichtig, da es viele viele Fällungsreaktionen gibt, für die ein geeigneter Indikator fehlt. Die Grundlagen kann man am Beispiel der Fällung der Bromidionen einer vorgelegten verdünnten Natriumbromidlösung durch die Silberionen einer Silberatcetat - Maßlösung verdeutlichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es entsteht Silberbromid ist aber schwer löslich und liefert deshalb keinen Beitrag zur in der Lösung enthaltenen Leitfähigkeit. Die gut leitenden Bromidionen werden durch die Acetationen, welche nicht so gut leiten, ersetzt. Also nimmt die Leitfähigkeit bis zum Ende der Reaktion ab. Nach dem Äquivalenzpunkt steigt sie wieder, da dann ein Überschuß an Reagenzlösung vorhanden ist. Für die Genauigkeit der Fällungsanlyse ist eine geringe Löslichkeit des gefällten Niederschlags nötig. Denn je geringer die Löslichkeit je genauer ist die Kurve, da dann sich das gebogene Übergangsstück der Kurve am Endpunkt verkleinert.
6.3 Titrationen bei erhöhten Temperaturen:
Bei Titrationen erreicht die Leitfähigkeit manchmal erst langsam nach jeder Zugabe von Maßlösung einen konstanten Wert. Dies läuft bei erhöhten Temperaturen häufig schneller ab, deswegen verwendet man bei schwer titrierbaren Substanzen häufig eine höhere aber gleichbleibende Temperatur. Hierfür verwendet man doppelwandige Titriergefäße mit einem Anschluß für einen Flußigkeitstermostaten. Die Maßlösung sollte mit einer Kolbenbürette zugegeben werden, da diese nicht empfindlich auf mögliche Druckveränderungen reagiert.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Konduktometrie"
Was ist Titrimetrie?
Titrimetrie ist ein Verfahren, bei dem das Volumen einer Reagenslösung bekannter Konzentration (Maßlösung) gemessen wird, um die Menge eines Stoffes in einer Analyselösung (Probelösung) zu bestimmen. Der Punkt, an dem die Reaktion vollständig ist, wird als Äquivalenzpunkt (Endpunkt) bezeichnet.
Was ist Konduktometrie?
Konduktometrie ist eine analytische Methode, bei der die elektrische Leitfähigkeit einer Lösung gemessen wird, um Reaktionsabläufe zu verfolgen. Die Leitfähigkeit hängt von der Konzentration der freien Ionen in der Lösung ab.
Was ist eine konduktometrische Titration?
Die konduktometrische Titration ist eine Maßanalyse mit physikalischer Endpunktbestimmung, bei der die Leitfähigkeit einer Lösung während der Titration gemessen und in einem Koordinatensystem (Leitfähigkeit gegen Volumen der Maßlösung) aufgetragen wird.
Welche Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche konduktometrische Titration wichtig?
Es ist wichtig, dass starke Elektrolyte an der Reaktion teilnehmen und wenig Ionen in der Lösung vorhanden sind, die sich nicht an der Reaktion beteiligen, um eine Verfälschung der Leitfähigkeitsmessung zu vermeiden.
Warum ist die konduktometrische Titration als Endpunktbestimmung nützlich?
Sie ermöglicht das direkte Ablesen des Äquivalenzpunktes aus dem Koordinatensystem.
Wovon ist die Leitfähigkeit abhängig?
Die Leitfähigkeit ist abhängig von der Temperatur, der Bewegung der Ionen, der Anzahl der Ionen, der Menge der transportierten Elementarladungen der Ionen und der Polarität des Lösungsmittels.
Welche Titriergefäße sind für die Konduktometrie geeignet?
In der Regel werden Glasgefäße mit platinierter Platinelektrode verwendet. Es muss eine geeignete Rührmöglichkeit vorhanden sein. Die Elektroden sollten ausreichend tief in die Flüssigkeit eintauchen und die Menge der Maßlösung gering gehalten werden.
Wie wird die Leitfähigkeit gemessen?
Zunächst muss die Widerstandskapazität des Titriergefäßes bestimmt werden. Dies kann mit einer Wheatstoneschen Brückenschaltung erfolgen, um den Widerstand des Messgefäßes zu messen. Anschließend wird die Leitfähigkeit der zu bestimmenden Lösung mithilfe der ermittelten Widerstandskapazität und des gemessenen Widerstands berechnet.
Was sind die Vorteile moderner Verfahren zur Leitfähigkeitsmessung?
Moderne Verfahren zeigen die Leitfähigkeit direkt an, wodurch das aufwendige Anpassen einer Messbrücke nach jeder Zugabe der Maßlösung entfällt. Die Genauigkeit hängt von der Genauigkeit des Verstärkers in den verschiedenen Messbereichen ab.
Wie funktionieren Säure-Base-Titrationen konduktometrisch?
Säure-Base-Titrationen beruhen auf Neutralisationsvorgängen, bei denen schnell wandernde Ionen durch langsamere Ionen ersetzt werden oder sich die Anzahl der Ionen verändert. Bei der Titration starker Säuren und Basen sinkt die Leitfähigkeit, bis der Äquivalenzpunkt erreicht ist, und steigt dann wieder an.
Wie funktionieren Fällungstitrationen konduktometrisch?
Fällungstitrationen werden konduktometrisch durchgeführt, wenn kein geeigneter Indikator vorhanden ist. Die Leitfähigkeit nimmt ab, bis der Äquivalenzpunkt erreicht ist, da gut leitende Ionen durch weniger gut leitende ersetzt werden. Nach dem Äquivalenzpunkt steigt die Leitfähigkeit wieder an.
Warum werden Titrationen manchmal bei erhöhten Temperaturen durchgeführt?
Bei schwer titrierbaren Substanzen laufen Reaktionen bei erhöhten Temperaturen häufig schneller ab. Daher werden doppelwandige Titriergefäße mit einem Anschluss für einen Flüssigkeitsthermostaten verwendet.
- Quote paper
- Thomas Brosda (Author), 2000, Die Konduktometrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97672