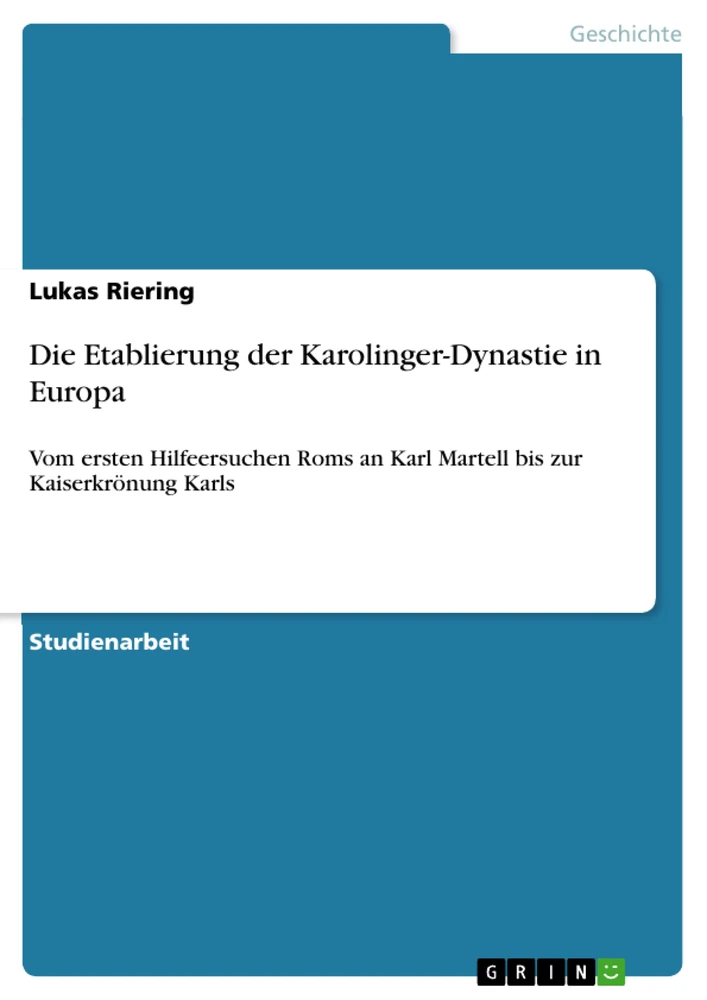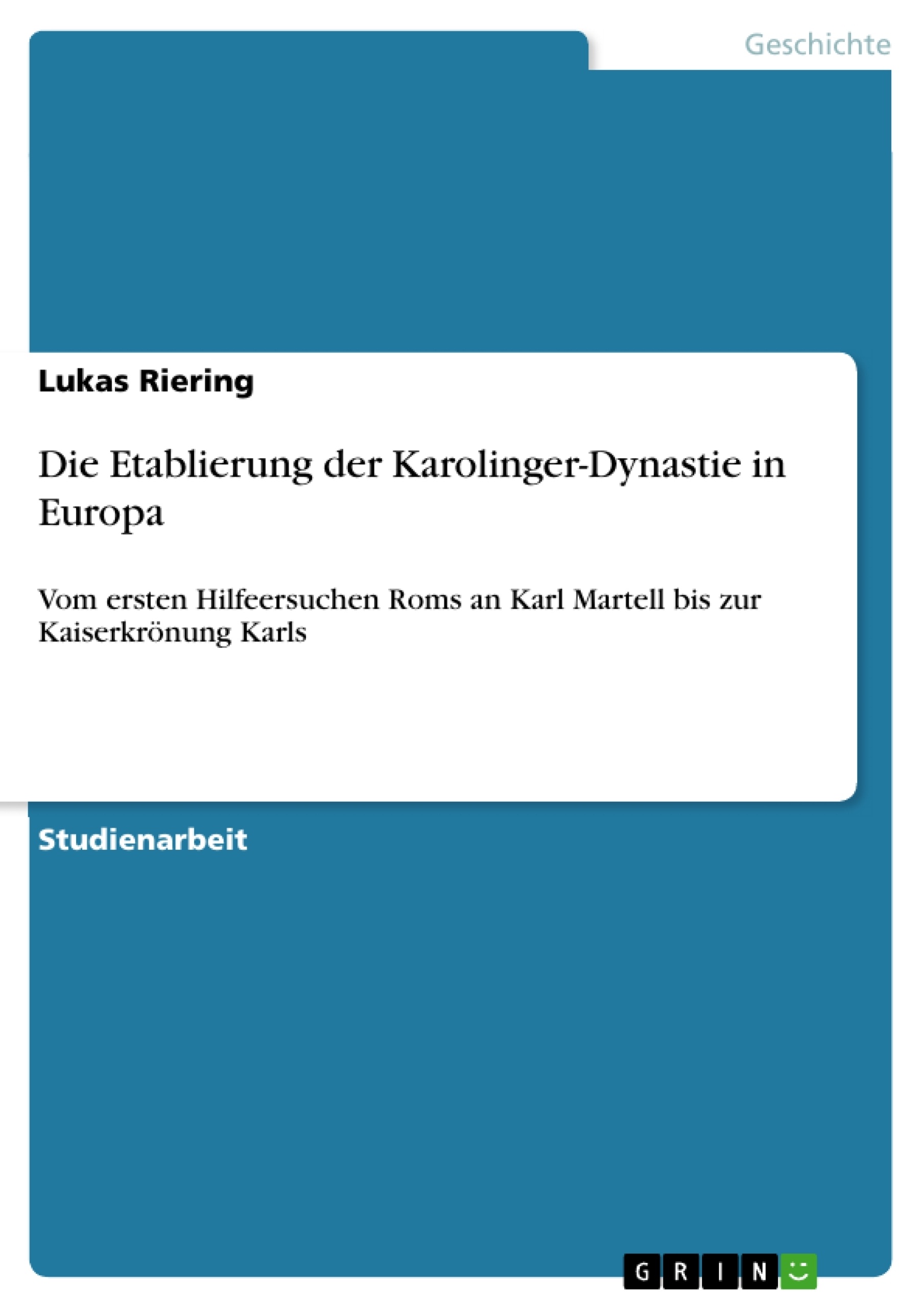Karl der Große gelang es mit seiner Kaiserkrönung im Jahre 800 nach Christus Geschichte zu schreiben. Er veränderte das Mächteverhältnis in Europa und schaffte Grundlagen, welche Jahrhunderte später noch das politische Geschäft prägen sollten. Es stellt sich die Frage, wie es die Karolinger geschafft hatten so schnell ihre Macht in Europa zu stützen. Im Inland selber hatten die Karolinger bereits Macht angehäuft, doch auch auf europäischer Bühne gelang diesen mit der Hilfe Roms ein schneller Aufstieg. Unter Karl Martell entstand ein erster Kontakt nach Rom – doch wie kam es davon ausgehend zur späteren Königserhebung und schließlich etwa 60 Jahre nach dem ersten Kontakt zur Kaiserkrönung Karls? Warum gelang es den Karolingern ein zweites Kaisertum in Europa zu etablieren?
Auch stellt sich die Frage, warum es gerade auf eine so enge Beziehung zwischen Papsttum und Karolingern hinauslief. Papst Stephan II. schreibt in einem Brief an die Karolinger, dass "Eure Hoffnung auf zukünftige Belohnung wahrhaftig in dieser apostolischen römischen Kirche Gottes, die uns anvertraut worden ist" läge. Stimmt dies und welche Vorteile erhofften sich beide Seiten von einer gemeinsamen Partnerschaft? Verlief diese auf Augenhöhe?
Diese Hausarbeit soll sich eben diesen Fragen widmen. Dazu soll in dieser Hausarbeit chronologisch die Ereignisse und die Beziehung zwischen Karolingern und Rom untersucht werden. Von Papst Gregor II. soll schließlich zu Papst Leo III. hingeführt werden und untersucht werden, wie die Ausgangslage der Kaiserkrönung 800 war. Zwei wichtige Werke wurden dabei von Sebastian Scholz und Peter Classen verfasst, welche sich mit dem Verhältnis zwischen Päpsten und Karolingern beschäftigt haben. Zudem soll auch besonderer Bezug zu den "Codex Epistolaris Carolinus" genommen werden, welche einem einen wichtigen authentischen Blick in die Zeitgeschichte erlauben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ablösung Byzanz als Schutzmacht Roms
- 2.1 Der Streit zwischen Rom und Konstantinopel
- 2.2 Hilfegesuch an Karl Martell
- 2.3 Bund zwischen Stephan II. und Pippin III
- 3. Das Duell zwischen Karl und Karlmann um den engeren Kontakt nach Rom
- 4. Der Machtausbau Karls des Großen unter Hadrian I.
- 5. Die Kaisererhebung Karls des Großen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Etablierung der Karolinger-Dynastie in Europa, insbesondere die Entwicklung der Beziehung zwischen den Karolinger und Rom vom ersten Hilfeersuchen an Karl Martell bis zur Kaiserkrönung Karls des Großen. Ziel ist es, die Schlüsselereignisse chronologisch zu analysieren und die Gründe für die enge Allianz zwischen Papsttum und Karolingern zu ergründen. Die Arbeit analysiert die Motive beider Seiten und hinterfragt das Ausmaß der Gleichberechtigung in dieser Partnerschaft.
- Der Niedergang des byzantinischen Reiches als Schutzmacht Roms
- Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Rom und den Karolingern
- Die Rolle der Langobarden im Konflikt
- Die strategischen Erwägungen des Papsttums und der Karolinger
- Die Vorbedingungen für die Kaiserkrönung Karls des Großen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die historische Bedeutung der Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahr 800 und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen des schnellen Machtzuwachses der Karolinger in Europa. Sie hebt die besondere Beziehung zwischen Papsttum und Karolingern hervor und thematisiert die Vorteile dieser Partnerschaft für beide Seiten. Die Arbeit kündigt eine chronologische Untersuchung der Ereignisse und Beziehungen zwischen Karolingern und Rom an, beginnend mit Papst Gregor II. und endend mit Papst Leo III. Schließlich werden die wichtigsten Quellen der Arbeit genannt, darunter die Briefe des Codex Epistolaris Carolinus und die Werke von Sebastian Scholz und Peter Classen.
2. Ablösung Byzanz als Schutzmacht Roms: Dieses Kapitel behandelt den Niedergang des byzantinischen Reiches als Schutzmacht Roms. Es beginnt mit dem Sturz Romulus Augustulus im Jahr 476 und dem Versuch Konstantinopels, das römische Reich zu erhalten. Der zunehmende Druck an den Grenzen des byzantinischen Reiches im 7. Jahrhundert und die schlussendliche Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 werden erläutert. Ein Schwerpunkt liegt auf der zunehmenden Schwächung des byzantinischen Reiches und der damit einhergehenden Hilflosigkeit Roms gegenüber den Langobarden. Die Briefe von Papst Gregor III. an Karl Martell aus den Jahren 739 und 740 werden analysiert, um die Notlage Roms und die Gründe für das Hilfegesuch bei den Franken statt bei den Byzantinern aufzuzeigen. Der Konflikt zwischen Papst Gregor II. und Kaiser Leo um Steuern für die Kirche und die darauffolgenden Ereignisse (Mordversuch, Bilderstreit, Gegenpapst) verdeutlichen die angespannte Beziehung zwischen Rom und Byzanz, die letztendlich zur politischen Neuausrichtung Roms und der Hinwendung zu den Franken führte.
Schlüsselwörter
Karolinger, Papsttum, Byzanz, Langobarden, Karl der Große, Kaiserkrönung, Karl Martell, Codex Epistolaris Carolinus, Machtpolitik, Mittelalter, Römisches Reich.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die Etablierung der Karolinger-Dynastie in Europa
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Beziehung zwischen den Karolingern und Rom vom ersten Hilfeersuchen an Karl Martell bis zur Kaiserkrönung Karls des Großen. Sie analysiert die Schlüsselereignisse chronologisch und ergründet die Gründe für die enge Allianz zwischen Papsttum und Karolingern, beleuchtet die Motive beider Seiten und hinterfragt das Ausmaß der Gleichberechtigung in dieser Partnerschaft.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Niedergang des byzantinischen Reiches als Schutzmacht Roms, die Entwicklung der Beziehungen zwischen Rom und den Karolingern, die Rolle der Langobarden im Konflikt, die strategischen Erwägungen des Papsttums und der Karolinger sowie die Vorbedingungen für die Kaiserkrönung Karls des Großen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit besteht aus sechs Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt die historische Bedeutung der Kaiserkrönung und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 behandelt den Niedergang Byzanz' als Schutzmacht Roms und den Hilferuf an Karl Martell. Kapitel 3 befasst sich mit dem Machtkampf zwischen Karl und Karlmann. Kapitel 4 analysiert den Machtausbau Karls des Großen unter Hadrian I. Kapitel 5 behandelt die Kaisererhebung Karls des Großen. Kapitel 6 bietet ein Fazit.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich unter anderem auf den Codex Epistolaris Carolinus und die Werke von Sebastian Scholz und Peter Classen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Karolinger, Papsttum, Byzanz, Langobarden, Karl der Große, Kaiserkrönung, Karl Martell, Codex Epistolaris Carolinus, Machtpolitik, Mittelalter, Römisches Reich.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist die chronologische Analyse der Schlüsselereignisse und die Ergründung der Gründe für die enge Allianz zwischen Papsttum und Karolingern. Die Arbeit analysiert die Motive beider Seiten und hinterfragt das Ausmaß der Gleichberechtigung in dieser Partnerschaft.
Wie ist die Struktur der Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist strukturiert mit Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Kapiteln mit Zusammenfassung, Zielsetzung und Themenschwerpunkten sowie Schlüsselwörtern.
- Quote paper
- Lukas Riering (Author), 2020, Die Etablierung der Karolinger-Dynastie in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/976577