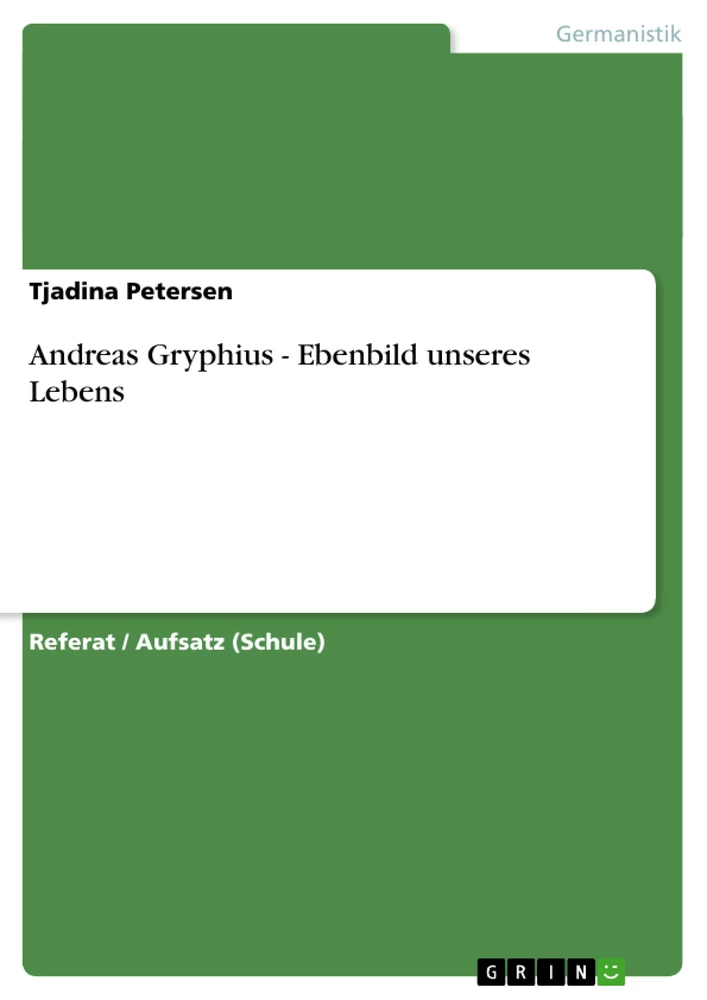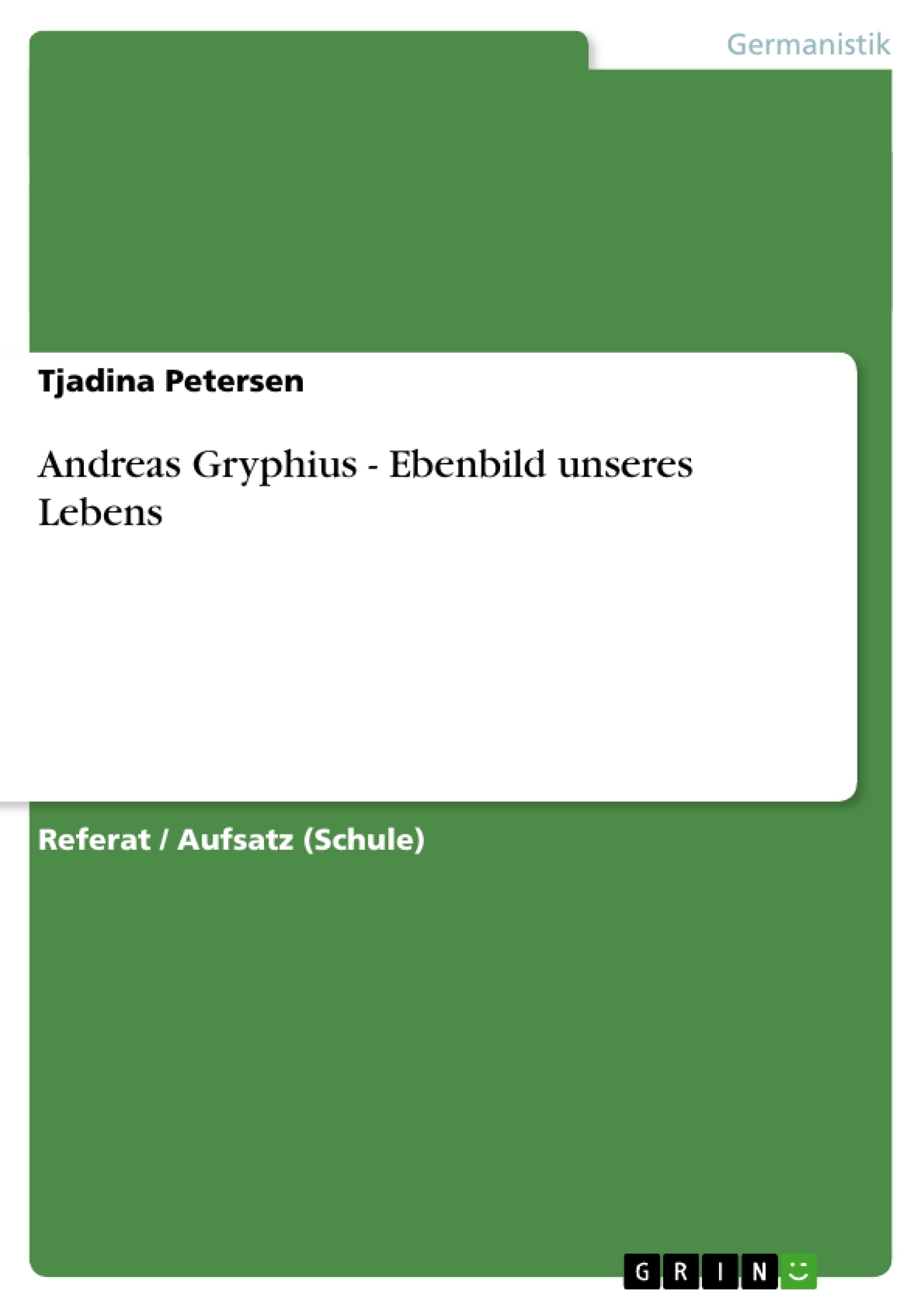Was bleibt, wenn der Vorhang fällt? Andreas Gryphius' Sonett "Ebenbild unseres Lebens," ein Spiegel der Barockzeit, enthüllt die trügerische Natur des Daseins inmitten des Dreißigjährigen Krieges. Dieses Gedicht, eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit und Schein, entführt den Leser in eine Welt, in der Ruhm, Macht und Reichtum nur flüchtige Illusionen sind. Die strenge Form des Sonetts, meisterhaft beherrscht von Gryphius, unterstreicht die barocke Vorstellung von Ordnung in einer chaotischen Welt. Die Interpretation dieses Schlüsselwerks der Barockliteratur erschließt nicht nur die Kernaussage über die Nichtigkeit irdischer Güter, sondern auch die kunstvolle Verbindung von Inhalt und Form, die dieses Gedicht so einzigartig macht. Untersuchen Sie, wie Gryphius typische barocke Motive wie Vanitas, Memento Mori und die Antithetik von Leben und Tod verwebt, um ein eindringliches Bild der menschlichen Existenz zu zeichnen. Entdecken Sie die Bedeutung des Alexandriners, des Reimschemas und der rhetorischen Figuren wie Allegorie, Metapher und Antithese, die zur eindringlichen Wirkung des Gedichts beitragen. Die Analyse beleuchtet auch den historischen Kontext, in dem das Gedicht entstanden ist, und zeigt, wie der Dreißigjährige Krieg das Lebensgefühl der Menschen prägte. Tauchen Sie ein in die Welt des Barock und erforschen Sie die zeitlosen Fragen nach Sinn, Wert und Vergänglichkeit, die Gryphius in seinem Sonett aufwirft, ein Muss für jeden Liebhaber der deutschen Literaturgeschichte und eine wertvolle Ressource für Schüler und Studenten, die sich mit Barockgedichten auseinandersetzen. Erfahren Sie, wie Gryphius' "Ebenbild unseres Lebens" die barocke Weltanschauung widerspiegelt, in der die Spannung zwischen Diesseitsfreude und Todesbewusstsein allgegenwärtig war. Die detaillierte Interpretation bietet einen umfassenden Einblick in die formalen und inhaltlichen Merkmale des Gedichts und zeigt, wie Gryphius die Sonettform nutzt, um die barocke Weltsicht auszudrücken. Eine tiefgehende Analyse der zentralen Motive und Symbole, die das Gedicht prägen, und eine vergleichende Betrachtung anderer Werke der Barockzeit runden die Untersuchung ab.
Klausur
Thema: Barockgedichte
Gryphius: ,,Ebenbild unseres Lebens"
Aufgabenstellung:
1. Interpretieren Sie das Gedicht, indem Sie die Kernaussage des Gedichts herausarbeiten und hierbei auch auf den Zusammenhang zwischen Inhalt und Form eingehen !
2. Überprüfen Sie, inwieweit das Gedicht typisch für die Epoche des Barock ist !
Einleitung
In einer Zeit des Übergangs, in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verweist Andreas Gryphius mit seinem typischen Sonett ,,Ebenbild unseres Lebens" auf die Vergänglichkeit des Glücks, die Nichtigkeit alles irdisch- materiellen Daseins sowie auf die Widersprüchlichkeit des menschlichen Lebens. Alle materiellen Werte wie ,,Kron, Weisheit, Stärke und Glut" (Z.14) sind nur geborgt, nicht dauerhaft beständig.
Aufgabe 1
Formal lässt sich Gryphius` Sonett - dem antiken Argumentationsmuster entsprechend - in zwei Quartette und zwei Terzette unterteilen, wobei alle Verse auf den letztendlich Bilanz ziehenden Finalsatz angelegt sind.
Der Titel ,,Ebenbild unseres Lebens" nennt das Thema, und wir sehen schon hier den Standpunkt des lyrischen Ich; es bezieht sich, aber auch den Leser in die gesamte Thematik ,,unseres Lebens" mit ein.
Der Überschrift folgend entwirft das erste Quartett ein allumfassendes Bild der Welt und des menschlichen Lebens; die Welt erscheint metaphorisch als Schauplatz, als Theater, in dem der Mensch, ,,das Spiel der Zeit", seine Rolle spielt. So wie der Schauspieler im Theater an seinen Handlungsort, seine Rolle und die begrenzte Spieldauer gebunden ist, so ist auch der Mensch, ,,weil er allhie lebt" (Z.1), an die Welt als Schauplatz gebunden, spielt seine ihm zugewiesene Rolle und muss gleichzeitig erkennen, dass die Spielzeit, die Lebenszeit begrenzt ist; er spielt im Spiel des Lebens, ,,er sitzt und doch nicht feste" (Z.2).
Die Verse drei und vier interpretieren das doppeldeutig gemeinte ,,nicht feste" Sitzen zunächst im Sinne von nicht dauerhaft eine bestimmte Rolle spielen. In einer asyndetischen Anordnung der einzelnen Satzteile wird antithetisch auf die Widersprüchlichkeit des Lebens, die Unterschiede in der Gesellschaft hingewiesen. Das gesellschaftliche Aufsteigen des einen steht dem Fallen des anderen gegenüber, das Dach - in der Technik des pars pro toto für das Haus stehend - erscheint als Kontrast zu den Palästen als winzig klein und das Herrschen des einen steht dem Weben des anderen gegenüber. Gryphius verweist damit sehr ausdrucksstark auf die in seinem Jahrhundert gegebene gesellschaftliche Situation, in der ein starker Kontrast zwischen dem fürstlichen Prunk einerseits und dem einfachen, oft ärmlichen (,,webt") Leben der Bevölkerung andererseits herrscht.
Der Leitlinie des Sonetts, die Thematik des Sonetts in den einzelnen Strophen auszuweiten, kommt nun auch das zweite Quartett nach.
Die Aussage des ersten Quartetts vom ,,nicht feste" Sitzen wird hier im Sinne der Vergänglichkeit alles Irdischen gesehen. Wieder in Form von Antithesen wird mit den adverbialen Ausdrücken ,,gestern", ,,jetzt", ,,morgen", ,,vorhin" und ,,nunmehr" auf das barocke Zeitbewusstsein hingewiesen; es wird der genaue Moment des Vergehens fixiert.
Alles das, was gestern noch Bestand hatte, ist schon verflossen, doch auch das Glück des Jetzt wird morgen bereits vergangen sein und die vorhin ,,grünen Äste"(Z.6) sind ,,nunmehr dürr und tot" (Z.7). Die Verse sieben und acht führen diese Beispiele der Vergänglichkeit nun bildlich auf das menschliche Leben zurück: ,,Wir Armen sind nur Gäste, ob den ein scharfes Schwert an zarter Seide schwebt."
Dieses Bild vermittelt dem Leser eine recht drastische und darum eindringlich wirkende Vorstellung von der begrenzten Dauer seines Lebens, denn das Schwert, das ,,an zarter Seide schwebt"(Z.8), kann jederzeit abreißen und das menschliche Leben beenden. Die Vergänglichkeit und Sterblichkeit ist somit im zweiten Quartett explizit ausgesprochen.
Das erste Terzett führt nun zunächst noch einmal die Verdeutlichung der gesellschaftlichen Unterschiede weiter, indem es antithetisch auf die Gleichheit ,,am Fleisch"(Z.9), aber Verschiedenheit des Standes sowie dem Tragen des Purpurkleides und dem Graben im Sande hinweist.
In Vers 11 werden dann aber die antithetischen Begriffe zu einer Synthese zusammengeführt: ,,Bis nach entraubtem Schmuck der Tod uns gleiche macht."(Z.11). Mit dem Tod sind selbst die Unterschiede in der Gesellschaft aufgehoben, die materiellen Werte wie das Purpurkleid und die Paläste erweisen sich als im Jenseits wertlos.
Das zweite Terzett bring in einem letzten Schritt die Aussagen über die kurze Lebenszeit und die Sterblichkeit aller irdischen Pracht auf eine Bilanz im Schlussvers. Die Imperative ,,spielt"(Z.12), ,,lernt"(Z.13) sind als Appell zu werten, die den Leser auffordern, sein Leben zu leben, aber beim Verlassen des Banketts, als Bild für die Welt, zu lernen, dass irdische Werte wie ,,Kron, Weisheit, Stärk und Gut sei ein geborgte Pracht" (Z.14).
In der allgemeinen Vorstellung der Barockdichter sollte bei der Wahl der Gedichtform immer auf die Angemessenheit der Verknüpfung von Thema, Gattung, Struktur und Stil geachtet werden.
Die Sonettform eignet sich in seiner strengen Form dabei ausgezeichnet, um die Thematik des menschlichen Lebens zu entfalten; bis zum letzten Terzett wird ein umfassendes Bild des menschlichen Lebens entworfen, das letztlich als bloßes vergängliches Schauspiel anzusehen ist.
Die scharf trennende Zäsur nach der dritten Hebung verdeutlicht bei diesem Sonett optimal die Antithetik, sie verdeutlicht die Unterschiede im Leben.
Unterstützt wird diese genaue Strukturierung in dem Sonett durch die rhythmische und prosaische Anordnung. Der Alexandrinervers lässt jeder Verszeile Raum und eignet sich deshalb besonders gut, um den komplexen Themenbereich des Lebens darzustellen.
Das Reimschema verknüpft dabei die einzelnen Aussagen des Gedichts miteinander, schließt sie zum Sinnabschnitt und letztlich zur Sinneinheit zusammen. Der umarmende Reim des ersten Quartetts verbindet die allgemeinen Aussagen über das Leben, der Strophenreim verdeutlicht dann die gedankliche Zusammengehörigkeit der beiden Quartette, beide beziehen sich in ihrer Thematik auf das widersprüchliche, menschliche Leben. Anschließend werden dann zusammenfassend im umarmenden Reim von Vers 11 und 14 die Aussagen zur Sinneinheit zusammengeführt.
Des weiteren sollte nun die Wahl der Gedichtform dem sprachlichen Stil entsprechen. Mit dem Bild des Theaters wird dem Leser die Möglichkeit gegeben, sich eine genaue bildliche Vorstellung vom allgemeinen menschlichen Leben zu verschaffen. Dieses wird im Sonett noch durch die Akkumulationen erreicht; das Leben wird in den Versen 2-7 und Vers 9 und 10 von allen Seiten betrachtet; die asyndetische Reihung im Vers 14 verdeutlicht dem Leser das Ausmaß der Vergänglichkeit.
Aufgabe 2
Bei Gryphius´ Sonett handelt es sich nicht nur durch Wahl und Aufbau des Sonetts, sondern auch in der Thematik um ein für die Epoche des Barock charakteristisches Barocksonett. In einer Zeit, wo gesellschaftliche und politische Umgestaltungen stattfanden und wo sich das Erleben des Dreißigjährigen Krieges im Bewusstsein der Menschen niederschlug, war das Lebensgefühl der Menschen geprägt von einer Spannung zwischen Diesseitsfreude einerseits und Bewusstsein des Todes und der Vergänglichkeit andererseits. Das Sonett in seiner strengen Form wurde deshalb von vielen Barockdichter - wie hier Gryphius - gewählt, um dieses ,,Chaos der Zeit" zu ordnen und zu gestalten; es sollte auf die Menschen der Zeit unterhaltend und belehrend wirken.
Die Darstellung des Kontrastes zwischen Sinnenfreude und Vergänglich- keitsgedanke wurde von den Dichtern - die in dieses Lebensgefühl mit eingebunden waren - vorwiegend in Form von Antithesen darstellt; das Glück an den materiellen Waren, dem Prunk stand die Vergänglichkeit dieser Werte gegenüber.
Ferner waren die Barockdichter von einem starken Ordnungsbewusstsein überzeugt. Auch Gryphius deutet mit dem im letzten Terzett hypotaktisch gestalteten Satz an, dass in der Widersprüchlichkeit des Lebens eine Ordnung liegt, die letztendlich Bestand hat.
Tjadina Petersen
Häufig gestellte Fragen zu Klausur: Thema Barockgedichte
Worum geht es in der Klausur?
Die Klausur behandelt Barockgedichte, insbesondere das Gedicht "Ebenbild unseres Lebens" von Gryphius.
Welche Aufgabenstellung beinhaltet die Klausur?
Die Aufgabenstellung umfasst zwei Teile: 1. Interpretation des Gedichts mit Fokus auf Kernaussage, Zusammenhang zwischen Inhalt und Form. 2. Überprüfung, inwieweit das Gedicht typisch für die Epoche des Barock ist.
Welche Kernaussage trifft Gryphius in "Ebenbild unseres Lebens"?
Gryphius thematisiert die Vergänglichkeit des Glücks, die Nichtigkeit alles irdisch-materiellen Daseins und die Widersprüchlichkeit des menschlichen Lebens. Materielle Werte sind nur geborgt.
Wie ist das Gedicht formal aufgebaut?
Das Gedicht ist ein Sonett, unterteilt in zwei Quartette und zwei Terzette, angelegt auf einen Bilanz ziehenden Finalsatz.
Was bedeutet der Titel "Ebenbild unseres Lebens"?
Der Titel gibt das Thema vor und bezieht den Leser in die Thematik des menschlichen Lebens ein.
Wie wird die Welt im ersten Quartett dargestellt?
Die Welt wird als Schauplatz, als Theater, dargestellt, in dem der Mensch seine Rolle spielt, aber seine Spielzeit begrenzt ist.
Was wird in den Versen 3 und 4 des Gedichts ausgedrückt?
Die Verse deuten auf die Widersprüchlichkeit des Lebens und die Unterschiede in der Gesellschaft hin, mit Kontrasten wie Aufsteigen/Fallen, Dach/Paläste, Herrschen/Weben.
Welche Rolle spielt das barocke Zeitbewusstsein im zweiten Quartett?
Das zweite Quartett thematisiert die Vergänglichkeit alles Irdischen durch Antithesen und adverbiale Ausdrücke, die den genauen Moment des Vergehens fixieren.
Was wird im ersten Terzett ausgesagt?
Das erste Terzett führt die Verdeutlichung der gesellschaftlichen Unterschiede fort, betont aber auch die Gleichheit im Tod.
Welchen Appell richtet das zweite Terzett an den Leser?
Das zweite Terzett fordert den Leser auf, sein Leben zu leben, aber zu erkennen, dass irdische Werte nur geborgte Pracht sind.
Inwiefern ist die Sonettform für die Thematik geeignet?
Die Sonettform eignet sich aufgrund ihrer Strenge, um die Thematik des menschlichen Lebens zu entfalten und als vergängliches Schauspiel darzustellen.
Wie wird die Antithetik im Sonett verdeutlicht?
Die Antithetik wird durch die scharf trennende Zäsur nach der dritten Hebung verdeutlicht, die die Unterschiede im Leben hervorhebt.
Welche Bedeutung hat der Alexandrinervers?
Der Alexandrinervers lässt jeder Verszeile Raum und eignet sich gut, um den komplexen Themenbereich des Lebens darzustellen.
Wie verknüpft das Reimschema die Aussagen des Gedichts?
Das Reimschema verknüpft die einzelnen Aussagen miteinander, schließt sie zum Sinnabschnitt und letztlich zur Sinneinheit zusammen.
Inwiefern ist das Gedicht typisch für die Epoche des Barock?
Das Gedicht ist aufgrund der Wahl des Sonetts, der Thematik (Vergänglichkeit, Kontrast zwischen Diesseitsfreude und Todesbewusstsein) und der Verwendung von Antithesen typisch für die Epoche des Barock.
Welche Rolle spielte das Ordnungsbewusstsein der Barockdichter?
Die Barockdichter waren von einem starken Ordnungsbewusstsein überzeugt, was sich in der Gestaltung des Gedichts und der Andeutung einer Ordnung in der Widersprüchlichkeit des Lebens zeigt.
- Quote paper
- Tjadina Petersen (Author), 1999, Andreas Gryphius - Ebenbild unseres Lebens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97653