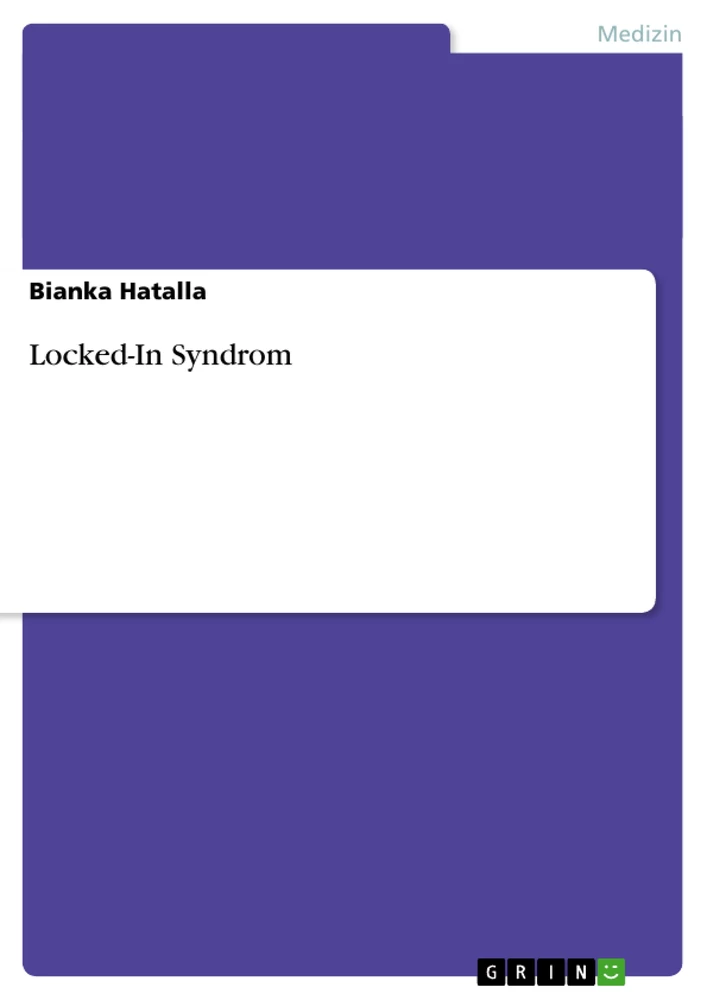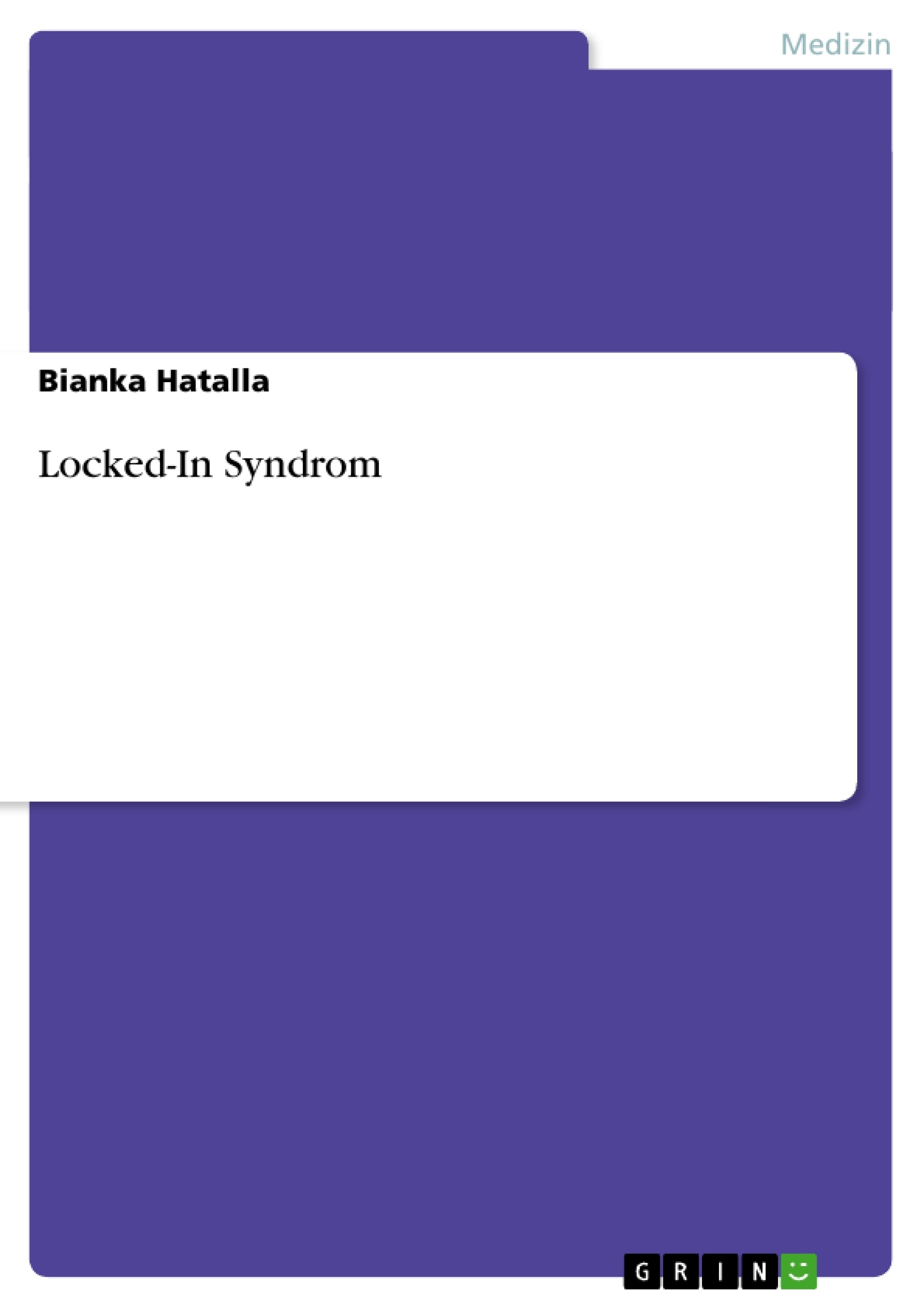Vordiplom: mündliche Ethikprüfung
Thema: Das Locked-in-Syndrom Prüfling: Bianka Hatalla
Thesenpapier zur mündlichen Ethikprüfung
Locked-in-Syndrom: ,,neurologische Unfähigkeit zu sprechen oder sich zu bewegen - bei völliger Wachheit und Bewußtseinsklarheit - als Folge einer beidseitigen querschnittartigen Unterbrechung des Tractus corticobulbaris und corticospinalis im Pons - Bereich. Infolge erhaltener Augenbeweglichkeit eine Verständigung (Sprache) möglich. Das EEG ist meist normal." (Roche Lexikon Medizin 1987:1059)
Pflege der Betroffenen: Man wußte lange nichts über dieses Krankheitsbild, so daß man diese Patienten genauso pflegte wie Patienten mit apallischen Syndrom (Wachkoma). Da Patienten mit apallischem Syndrom wahrnehmungsbeeinträchtigt sind, versucht man in der Pflege über die basale Stimulation elementare Wahrnehmungsangebote sowie Kontaktmöglichkeiten mit der Umwelt zu erschließen.
Locked-in Patienten gehören medizinisch gesehen eher zu den Hochquerschnittgelähmten und brauchen dementsprechende Rehabilitationsmaßnahmen um ihnen die Möglichkeit der Kommunikation zu geben bzw. zu erleichtern.
Ethische Problematik: Die Patienten im Locked-in-Syndrom, wie auch im apallischen Syndrom haben sehr häufig, gerade in der Anfangsphase, lebensbedrohliche Krisen. Nicht selten wird dann im Team und mit den Angehörigen besprochen, eventuell bei der nächsten Krise nicht mehr zu reanimieren oder auch lebensverlängernde Maßnahmen einzustellen. Doch was ist mit dem Selbstbestimmungsrecht der Locked-in Patienten? Da man noch vor nicht all zu langer Zeit dieses Krankheitsbild nicht genau kannte, wurde nur nach ihrem mutmaßlichen Willen entschieden. Diese Patienten sind allerdings kognitiv völlig orientiert, so daß sie von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen können. Ich werde versuchen diese Problematik anhand des christlich-humanistischen Menschenbildes sowie von Immanuel Kant zu verdeutlichen.
Argumentationslinie zu dem Thesenpapier ( in Stichpunkten):
Ethisches Dilemma:
- Man weiß als Außenstehender nicht ob der Betroffene noch Lebenswillen besitzt
- Bedeutsam wird dies, falls es zu medizinischen Komplikationen kommt
- Betroffener kann seine Meinung / Einstellung nicht mitteilen, obwohl er bei Bewußtsein ist
- Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige können nur aus der Sicht eines Gesunden über den mutmaßlichen Willen des Betroffenen ,,spekulieren"
- Erfahrungsgemäß: Betroffene in ähnlichen oder gleichen Situationen wollen nicht sterben
Lösungsansätze:
- Aus gesetzlicher Sicht wäre die Unterlassung der Reanimation unter Berücksichtigung der Einwilligung des Patienten oder seinem mutmaßlichen Willen nicht strafbar, da passive Sterbehilfe
Grundsätze der Ärztekammer:
- Behandlung bei sonstiger lebensbedrohender Schädigung
Patienten mit dieser Diagnose haben ein Recht auf Behandlung, Pflege und Zuwendung.
Lebenserhaltende Therapie ist daher geboten. Bei fortgeschrittener Krankheit kann aber auch bei diesen Patienten eine Änderung des Therapiezieles und die Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen in Betracht kommen. Bei bewußtlosen Patienten wird in der Regel zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens die Bestellung eines Betreuers erforderlich sein.
Christlich - humanistischs Menschenbild
- 5. Gebot: Du sollst nicht töten
- Achtung vor dem Wert des Lebens d.h. aber auch den Tod annehmen können
- Goldene Regel: ,,andere Menschen so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten"
Immanuel Kant
- Individuelle Freiheit und Selbstbestimmung
- Jeder hat das Recht der persönlichen Entscheidung, muß jedoch die Verantwortung dafür tragen
Was heißt das für den Betroffenen:
- Um sein Recht auf Selbstbestimmung wahrzunehmen braucht er ein Bewußtsein (ist gegeben)
- Dadurch das er ein Bewußtsein hat, steht ihm das Recht zu Entscheidungen zu treffen, weder Ärzte noch Angehörige dürfen für ihn entscheiden
- Er kann seine Entscheidungen nach Außen nicht äußern, deshalb treffen doch andere für ihn Entscheidungen
Mutmaßlicher Wille:
Ist ebenso verbindlich wie der ausdrücklich Wille (Willensforschung)
- Frühere Äußerungen des Betroffenen (Gefahr, er konnte sich als Gesunder nicht in eine Situation hineinversetzen)
- Patiententestament (Gefahr, wie oben)
- Medizinische Prognose (Erfahrungen mit gleichgelagerten Fällen sollten miteinfließen) · Erfahrungen / Einstellungen von Patienten mit ähnlicher oder gleicher Diagnose sollten miteinfließen
Fazit:
Meine persönliche Erfahrung mit Hochquerschnittgelähmten, sie besitzen trotz ihrer Diagnose einen starken Lebenswillen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Locked-in-Syndrom, wie es in "Vordiplom: mündliche Ethikprüfung" beschrieben wird?
Das Locked-in-Syndrom wird als eine neurologische Unfähigkeit beschrieben, zu sprechen oder sich zu bewegen, wobei völlige Wachheit und Bewusstseinsklarheit erhalten bleiben. Es ist eine Folge einer beidseitigen Unterbrechung des Tractus corticobulbaris und corticospinalis im Pons-Bereich. Verständigung ist durch erhaltene Augenbeweglichkeit möglich.
Wie unterschied sich die Pflege von Locked-in-Patienten früher von der heutigen?
Früher wurden Locked-in-Patienten oft wie Patienten mit apallischem Syndrom (Wachkoma) behandelt, da das Krankheitsbild nicht genau bekannt war. Heute weiß man, dass Locked-in-Patienten kognitiv völlig orientiert sind und dementsprechend behandelt werden sollten, ähnlich wie Hochquerschnittgelähmte mit Rehabilitationsmaßnahmen zur Erleichterung der Kommunikation.
Welche ethischen Probleme entstehen im Zusammenhang mit Locked-in-Patienten?
Ein zentrales ethisches Problem ist die Frage, ob und wann lebensverlängernde Maßnahmen eingestellt werden dürfen, insbesondere in lebensbedrohlichen Krisen. Dies kollidiert mit dem Selbstbestimmungsrecht der Patienten, da sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen oft nicht in der Lage sind, ihren Willen klar zu äußern. Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige müssen den mutmaßlichen Willen des Patienten berücksichtigen.
Welche Lösungsansätze werden im Thesenpapier bezüglich der ethischen Dilemmata vorgeschlagen?
Das Thesenpapier erwähnt, dass die Unterlassung der Reanimation unter Berücksichtigung der Einwilligung des Patienten oder seinem mutmaßlichen Willen aus gesetzlicher Sicht nicht strafbar wäre (passive Sterbehilfe). Es werden auch die Grundsätze der Ärztekammer erwähnt, die die Behandlung bei sonstiger lebensbedrohender Schädigung vorsehen. Bei bewußtlosen Patienten muss in der Regel zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens die Bestellung eines Betreuers erfolgen.
Welche Rolle spielt das christlich-humanistische Menschenbild in der ethischen Betrachtung des Locked-in-Syndroms?
Das christlich-humanistische Menschenbild betont die Achtung vor dem Wert des Lebens (5. Gebot: Du sollst nicht töten), aber auch die Akzeptanz des Todes. Die Goldene Regel ("andere Menschen so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten") spielt ebenfalls eine Rolle.
Welche Bedeutung hat Immanuel Kants Philosophie für die ethische Beurteilung des Locked-in-Syndroms?
Immanuel Kant betont die individuelle Freiheit und Selbstbestimmung. Jeder hat das Recht auf persönliche Entscheidung, muss jedoch die Verantwortung dafür tragen. Locked-in-Patienten haben ein Bewusstsein und somit das Recht, Entscheidungen zu treffen, aber die Umsetzung gestaltet sich aufgrund ihrer Einschränkungen schwierig.
Was versteht man unter dem "mutmaßlichen Willen" eines Locked-in-Patienten, und wie wird er ermittelt?
Der mutmaßliche Wille ist ebenso verbindlich wie der ausdrückliche Wille. Er kann ermittelt werden durch frühere Äußerungen des Betroffenen (wobei berücksichtigt werden muss, dass er sich als Gesunder möglicherweise nicht vollständig in die Situation hineinversetzen konnte), Patiententestamente (mit ähnlicher Einschränkung) und medizinische Prognosen, die Erfahrungen mit gleichgelagerten Fällen berücksichtigen. Ebenfalls sollten Erfahrungen und Einstellungen von Patienten mit ähnlicher Diagnose miteinfließen.
Welches Fazit zieht die Autorin in Bezug auf den Umgang mit Locked-in-Patienten?
Die Autorin betont die Gefahr einer Fehlentscheidung und die Schwierigkeit, zu dem Schluss zu kommen, Patienten mit solchen Diagnosen sterben zu lassen, da ihre persönliche Erfahrung mit Hochquerschnittgelähmten zeigt, dass sie trotz ihrer Diagnose einen starken Lebenswillen besitzen. Die Gefahr eine Fehlentscheidung zu treffen ist so groß, dass man eigentlich gar nicht zu der Entscheidung kommen kann Patienten mit solchen Diagnosen sterben zu lassen.
- Quote paper
- Bianka Hatalla (Author), 2000, Locked-In Syndrom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97628