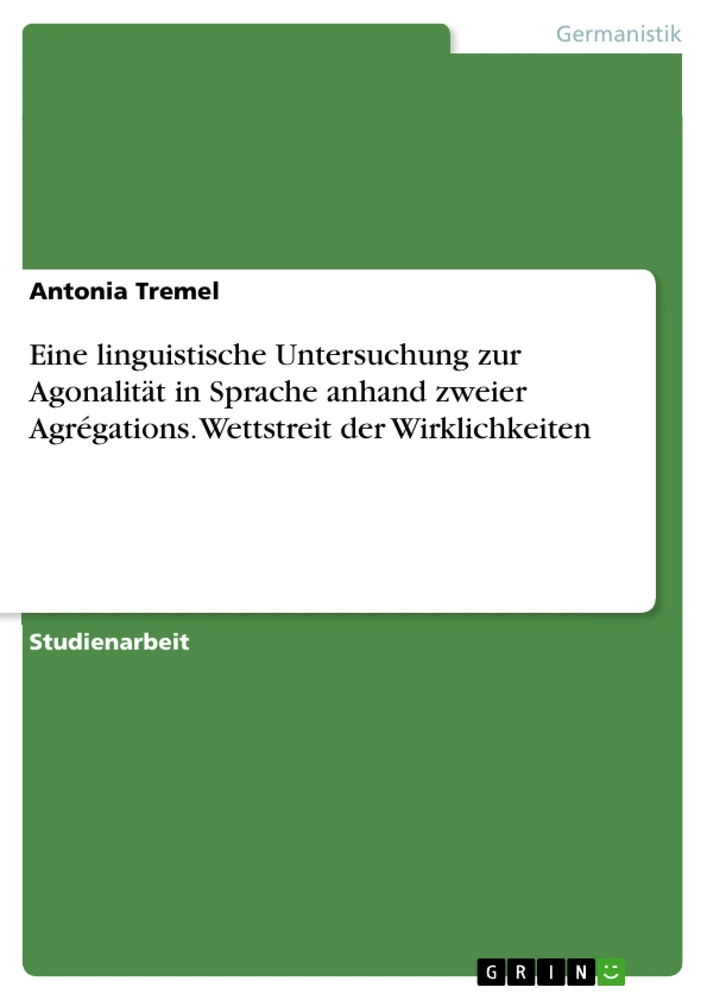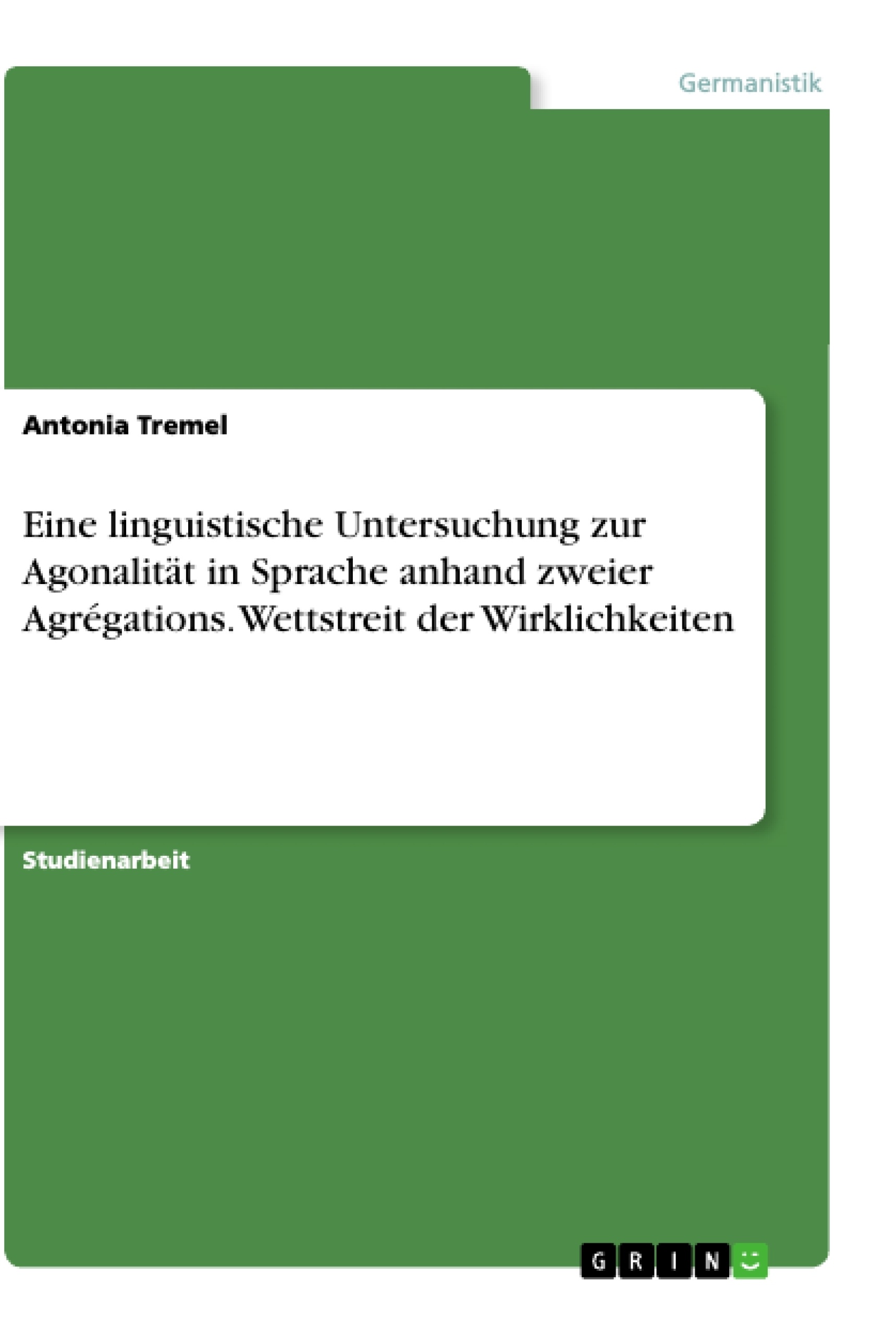Das zentrale Motiv dieser Arbeit stellt den Terminus der Agonalität dar, welcher auf die Agone im alten Griechenland zurückgeht. Diese bezeichnen die sportlichen aber auch musischen Wettkämpfe in der griechischen Antike, welche bis heute als Olympische Spiele fest in der Gesellschaft verankert sind und im Rahmen eines allgemein festlichen Programms abgehalten werden. Während heutzutage Wettkämpfe solcher Art eher als mediales Ereignis angesehen werden, machten sie in der Antike einen essentiellen Bestandteil der griechischen Identität aus. Die Bedeutung der Agone liegt in der Ansicht, dass durch einen friedlichen Wettstreit, gleich ob sportlicher, musischer oder dichterischer Art, jede Form von Despotismus verhindert werde, da im stetigen Wettstreit um Recht und Anspruch Absolutheit kein Gehör findet.
Da die Welt die Verkörperung eines kompetitiven Schauplatzes darstellt, ist es nicht verwunderlich, dass die Philosophie später das Prinzip der Agone aufgreift und als Regelordnung versteht, welche im Konflikt und der in der Aushandlung von Sachverhalten auftritt. Da die Welt und die Sprache unweigerlich miteinander verknüpft sind, worauf im weiteren Verlauf der Arbeit genauer eingegangen wird, lässt sich diese Form von Wettstreit ebenfalls in der Welt der Sprache eruieren, wo sie sich an der sprachlichen Oberfläche als „agonale Zentren“ manifestiert. Um Agonalität in der Sprache nachgehen zu können, sollen in dieser Arbeit zwei Agrégations als Untersuchungsgegenstand herangezogen werden, um hierbei exemplarisch die zentralen Thematiken der Textgrundlage zu eruieren, sowie an-schließend die antagonistischen Perspektiven herauszuarbeiten. Für dieses Vorgehen ist die Arbeit in drei Teile gegliedert, in welcher der erste die theoretischen Überlegungen zu Agonalität und Wissen darstellen, sowie das Vorgehen der Analysearbeit explizieren soll. Im zweiten Kapitel wird die Analyse mit vier Unterpunkten ausgeführt, um sie in einem ab-schließenden Schritt zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Agonalität und agonale Zentren ........
- 2.1. Vorgehensweise und Untersuchungsgegenstand…….....
- 3. Analyse
- 3.1. Agonale Thematisierung von Heteronomie: >Notwendigkeit< vs. >Überwindung<.......
- 3.2. Agonale Thematisierung von Politik und Religion: >Unterdrückung< vs. >Freiheit<...
- 3.3. Agonale Thematisierung von Moral: >Moral ist unverzichtbar< vs. >Moral ist entbehrlich,
- 3.4. Agonale Thematisierung von Egoismus: >positive Wirkung< vs. >negative Wirkung<.
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis.............
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Agonalität und untersucht dessen Manifestation in Sprache anhand zweier Agrégations. Sie analysiert den Wettstreit von Perspektiven und Ideen in diesen Texten und erforscht, wie sich sprachliche Mittel zur Konstruktion von Wirklichkeit und Wissen einsetzen lassen.
- Agonalität in Sprache und ihre Auswirkungen auf die Konstruktion von Wirklichkeit
- Die Rolle von Wissen und Erfahrung in der sprachlichen Auseinandersetzung
- Die Analyse von antagonistischen Perspektiven in den Agrégations
- Die Bedeutung von sprachlichen Zentren für die Darstellung von Argumenten
- Die Untersuchung der sprachlichen Mittel zur Darstellung von Heteronomie, Politik, Religion und Moral
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Agonalität ein, indem sie die historische Bedeutung und den Ursprung des Begriffs im alten Griechenland beleuchtet. Sie erläutert, wie die Agone als Prinzip des friedlichen Wettstreits die griechische Identität prägte und wie sie später in der Philosophie aufgegriffen wurde. Anschließend wird die Verbindung zwischen Welt und Sprache thematisiert und die Untersuchung von Agonalität in Sprache anhand zweier Agrégations angekündigt. Das Kapitel skizziert die Gliederung der Arbeit und die Methode der Analyse.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Agonalität und ihrer Auswirkungen auf die Konstruktion von Wissen. Es beleuchtet, wie Sprache in der Interaktion von Individuum und Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt, und wie sie sowohl die individuelle Erfahrung als auch die Erkenntnis über die Welt prägt. Das Kapitel stellt das triadische Zeichenmodell nach Ogden und Richards vor und erklärt, wie Sprache als Gestaltungsmedium die Konstitution von Wirklichkeit beeinflusst.
Das dritte Kapitel beinhaltet die Analyse der beiden Agrégations mit Fokus auf die thematisierten Agonalitäten. Es untersucht, wie die sprachlichen Mittel eingesetzt werden, um unterschiedliche Perspektiven zu konstruieren und zu vertreten. Es wird die Agonale Thematisierung von Heteronomie, Politik, Religion und Moral anhand von Beispielen aus den Texten betrachtet.
Schlüsselwörter
Agonalität, Sprache, Wirklichkeit, Wissen, Agrégation, Wettstreit, Perspektiven, antagonistische Sichtweisen, sprachliche Zentren, Heteronomie, Politik, Religion, Moral, Egoismus, Konzeptprägung, Bedeutungsfixierung.
- Citation du texte
- Antonia Tremel (Auteur), 2019, Eine linguistische Untersuchung zur Agonalität in Sprache anhand zweier Agrégations. Wettstreit der Wirklichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/975829